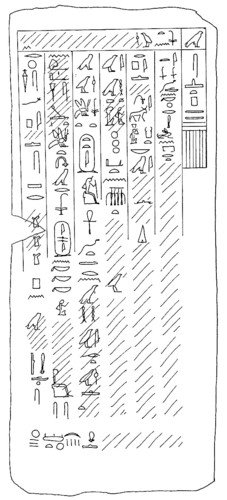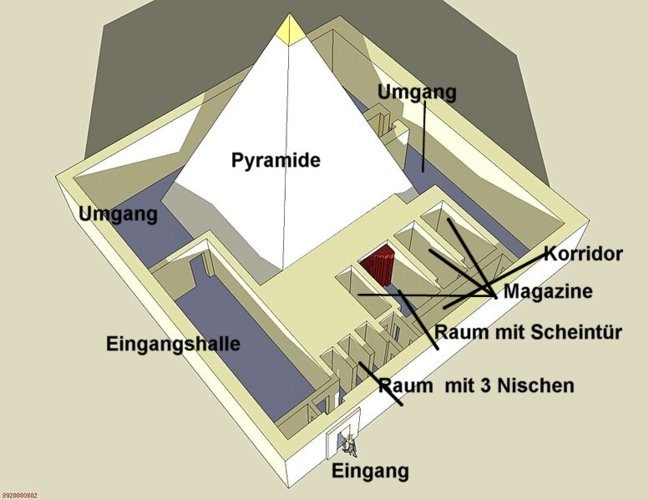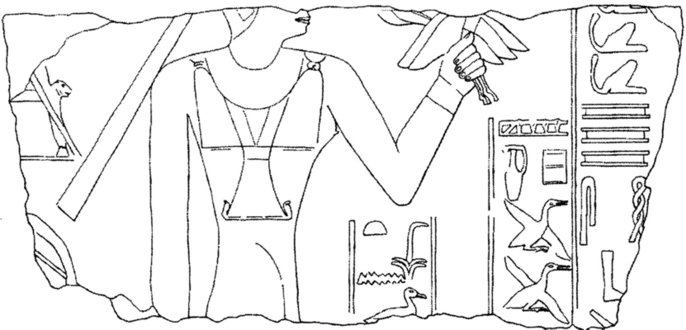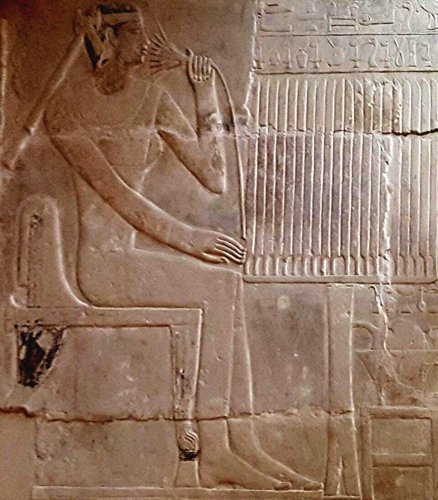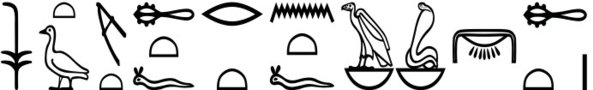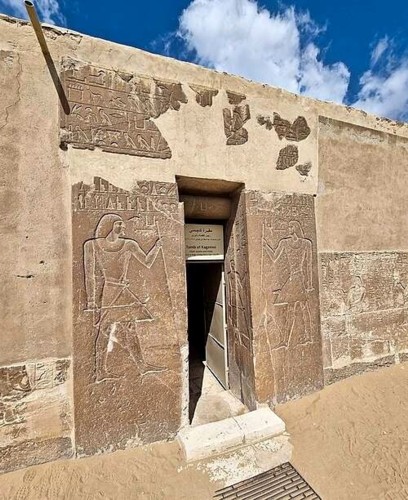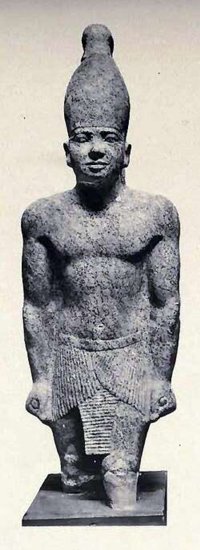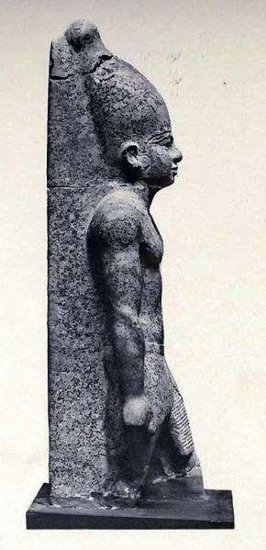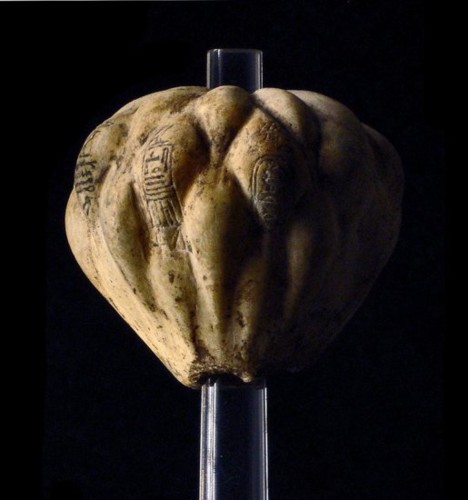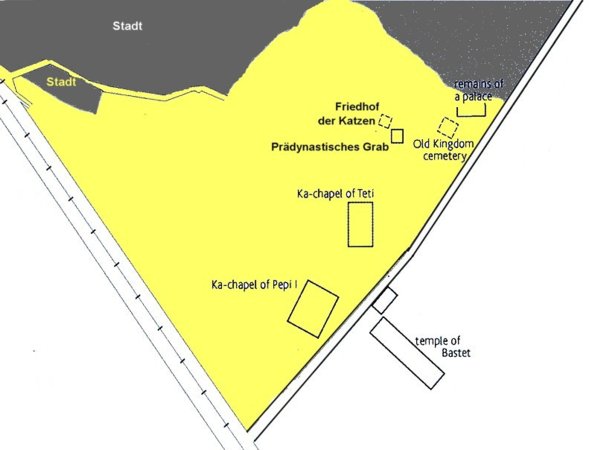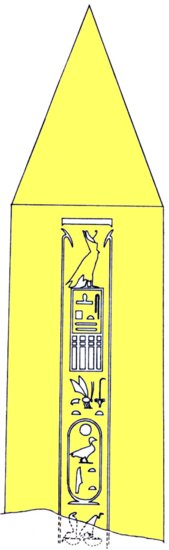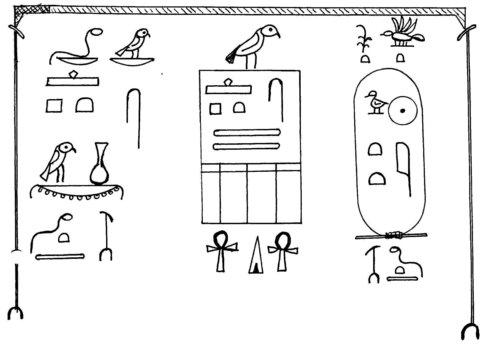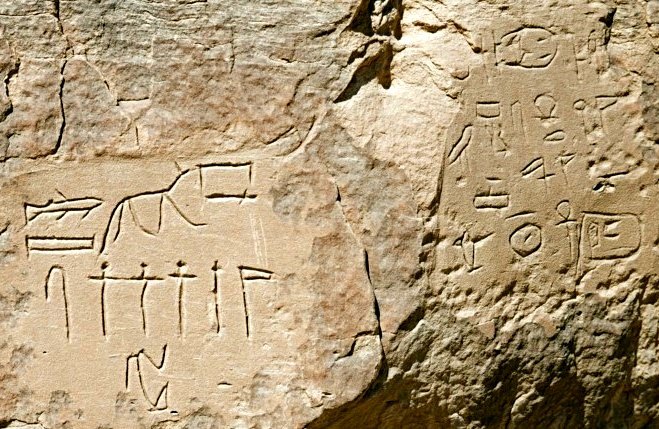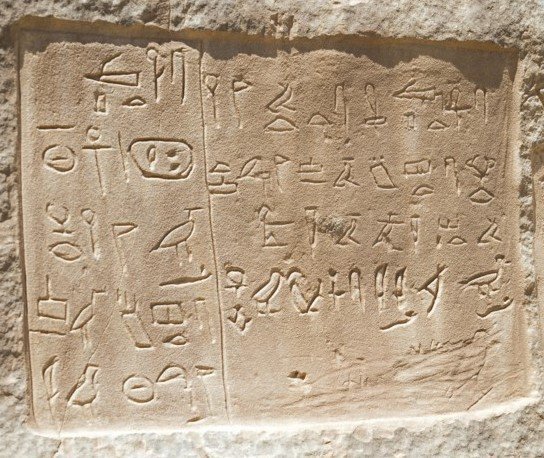zurück zur Biografie König Unas |

Pyramide König Teti |

Beamte Teti |
Quellen und Literatur-Angaben am Ende
dieser Seite -nummerierte Verweise im Text
PM = Porter Moss, Topographical Bibliography of Ancient Hieroglyphic Text,
Reliefs and paintings 1927-1952
Bilder oben: public
domain (James Edward Quibell (1906-1907)

Mit König Teti beginnt die ägyptische
Geschichtsschreibung eine neue Dynastie, die sechste - vielleicht, weil auf
ihn folgend sein Sohn und dessen Söhne in ununterbrochener Folge regierten.
Allerdings lässt sich ein gravierender Unterschied zu seinem Vorgänger Unas
nicht feststellen. Sein Horusname "Der die beiden Länder befriedet"
könnte ein Hinweis darauf sein, dass ihm wieder eine Festigung des Reiches
gelang. Hohe Beamte des Königs Teti, deren Gräber nördlich der
Teti-Pyramide liegen, wie die des Wesirs "Kagemni" oder "Nefer-sechem-ptah"
haben ihre Karriere unter König Isesi begonnen, unter König Unas fortgesetzt
und bekleideten dann unter König Teti höchste Ämter (Kagemni scheint sogar
den Bau von drei Pyramidenbezirke miterlebt zu haben).
Da der Machtwechsel von Unas zu Teti anscheinend
ohne Probleme vor sich ging, ist die dt. Ägyptologin Silke Roth der Meinung,
dass zumindest die Mutter von König Teti der königlichen Familie des Unas
entstammte. Es gibt aber auch Ägyptologen, welche Teti für einen direkten
Sohn von König Unas halten, wie z. B. Wilfried Seipel, der die 6. Dynastie
mit König Unas beginnt. Er schreibt dazu: "Als Königin kann.......S(eschseschet)
nur als Gemahlin des Königs Unas aufgefasst werden, dessen Sohn Teti sein
rechtmäßiger Nachfolger wurde" (Quelle: W. Seipel, a.a.O., 229ff). Doch
lt. Prof. Hartwig Altenmüller (Bemerkungen zur Gründung der 6. Dynastie,
Hildesheim 1990 - Festschrift für Jürgen v. Beckerath zum 70. Geburtstag, S.
5) "bricht diese Annahme in sich zusammen, sobald nicht Unas, wie Seipel
vermutet (Untersuchungen zu den ägyptischen Königinnen der Frühzeit und des
Alten Reiches, Diss. Hamburg, 1980, 222 und 259/6), sondern König Teti als
Begründer der 6. Dynastie angesehen wird, was auch vom "pTurin" und
"Manetho" unzweideutig belegt wird. Daher ist ein bisher unbekannter
Vater des Teti anzunehmen.
Da der Übergang von der 5. zur 6. Dynastie
aller Wahrscheinlichkeit nach friedlich verlief und eine Usurpation des Throns
durch Teti nicht überliefert ist, erscheint die Annahme als wahrscheinlich,
dass nach dem Tod von König Unas die 5. Dynastie erlosch, weil in direkter
Abstammung ein männlicher Thronerbe, d. h. ein Kronprinz (zA
nsw.t n Xt.f) nicht da war. Für diese
Annahme spricht auch die These, dass Prinzen vom Ende der 5. Dynastie, die
eindeutig als gebürtige Prinzen des Unas nachgewiesen werden konnten, bisher
entweder früh verstorben oder nicht belegt sind. Vielleicht zählte der Prinz
"Unas-Anch" zu diesen (siehe SAK 1, 1974, 50).
Die Thronbesteigung des
Teti könnte sich dann nach einem in der ägyptischen Geschichte gut belegten
Muster vollzogen haben, wobei zwei Konstellationen möglich sind: (Quelle:
Prof. Hartwig Altenmüller: Bemerkungen zur Gründung der 6. Dynastie 1990 -
in Festschrift zum 70. Geburtstag von Jürgen von Beckerath, S. 1-20)
- Teti war zwar kein
leiblicher Sohn von König Unas (und damit Thronfolger), aber war evtl.
ein Sohn eines Mannes, der durch die Vermählung mit einer
"leiblichen Tochter" von König Unas in die Familie der 5.
Dynastie reingeheiratet hatte. Als Sohn dieses Paares könnte Teti nach
dem Tod von Unas (ohne eigene Söhne) seinen Erbanspruch mit der
Abstammung der Mutter begründen (siehe Chentkaus am Beginn der 5.
Dynastie)
- Teti legitimierte sich
als Sohn eines ranghohen Mannes und steht hier selbst im Zentrum der
Macht, wobei er nach dem Tod des Königs aus einer leitenden Position
heraus die Herrschaft (mögliche Parallele: Amenemhet I. am Beginn der 12.
Dynastie) in Ägypten übernimmt.
König Teti ist auf der
Königsliste von Abydos (als Nr. 34), der Königsliste von Saqqara (Nr. 33)
und bei Manetho (als Othoes) belegt.
|
Namen
König Teti
|
| Geburtsname: |
&tj |
Teti |
|
| Thronname: |
--------------- |
---------------- |
|
| Horusname |
%Htp-tA.wj |
Sehotep-taui |
der
die beiden Länder zufriedenstellt |
| Nebtiname: |
%htp-nb.tj |
Sehotep-nebti |
der
die beiden Herrinnen zufriedenstellt |
| Goldname |
Bjk-nbw-smA |
Bik-nebu-sema |
der
Goldfalke, der Vereiniger |
|
Familien- und
Regierungs-Daten von König Teti
- 1. König der VI. Dynastie -
|
|
Regierungszeit:
Altes Reich - Dynastie 6
|
ca.
2345 - 2333 v. Chr.
(um 12 Jahre) |
|
| Vorgänger: |
Unas |
|
| Mutter: |
Seschet
(A) / Seschseschet |
Dodson
& Hilton, Royal families |
| Vater: |
unbekannt
(evtl. Shepsi-sipu-ptah)
|
|
| Geschwister: |
unbekannt |
|
| Ehefrauen: |
Iput
I
Chuit (II.)
Chentkaus IV.
Weret-Imtes
Naert (nach engl. Wikipedia) |
Teti hatte möglicherweise bis zu 9
Töchter, von denen viele nach seiner Mutter Sesheshet benannt sind.
|
| Kinder |
Pepi
I., Nebkauhor, Seschseschet, Seschseschet, Seschseschet Scheschit,
Seschseschet Scheschti und Seschseschet (C) Watetchethor, Teti-anch-chem (verstorben mit ca. 15) und einen weiteren Sohn
gleichen Namens. |
| Begräbnis: |
Saqqara,
Pyramide |
|
Die genaue Länge der Regierungszeit von König
Teti wurde auf der Turiner Königsliste zerstört, aber es wird angenommen,
dass es etwa 12 Jahre waren. Manetho, ein im 3. Jahrhundert v. Chr. lebender
Priester, beziffert seine Regierungszeit mit 30 Jahren (bzw. in der Version
des Pseudo-Erathosthenes 33 Jahre). Auch die zeitgenössischen Datumsangaben
bringen nur wenig Klarheit, da nur wenige erhalten sind, welche sich eindeutig
für Teti zuordnen lassen. Über die Länge seiner Regierung gibt es unter den
Ägyptologen stark unterschiedliche Meinungen: wie Thomas Schneider (Lexikon
der Pharaonen), der ihm 18 Jahre zubilligt - oder Jürgen v. Beckerath mit
etwa 10 Jahren.
Die höchste sicher zuweisbare Datierung ist
"ein Jahr nach dem 6. Mal der Zählung" (Year after the 6th Count
3rd Month of Summer day lost") - Jahr 12- wenn die Zählung alle 2 Jahre
stattfand, von Hatnub, Graffito Nr. 1 (Quelle: Anthony Spalinger: Dated Texts
of the Old Kingdom," SAK 21, 1994, p. 303). Diese Information stimmen mit
dem südlichen Saqqara Stein (Museum Kairo JE 65908.23) aus
der Zeit von Pepi II. überein, der ihm eine Regierungszeit von etwa 12 Jahren
gibt.
Mit der ein- oder zweijährigen Zählung ist die
ursprünglich als Horusgeleit eingeführte landesweite Zählung des
Viehbestandes zum Zwecke einer Steuererhebung gemeint. Nach Michel Baud
könnte auch die Nennung eines "11. Mals der Zählung" im Grab des
Nikauisesi in Tetis Regierungszeit datiert werden, wenngleich auch kein
Königsname genannt wird. Gewisse Probleme bring der Umstand mit sich, dass
diese Zählungen ursprünglich alle zwei Jahre stattfanden (d. h. auf ein
"x-tes Jahr der Zählung" folgte ein "Jahr nach dem x-ten Mal
der Zählung) - später aber auch z. T. auch jährlich stattfinden konnten. Da
neben den beiden genannten Daten nur noch einige Nennungen des "Jahres
der ersten Zählung" und des "Jahres nach der 1. Zählung" in
den Abusir-Papyren überliefert sind, können zur Regelmäßigkeit der
Jahreszählungen unter der Herrschaft von König Teti keine sicheren Aussagen
getroffen werden. Es ergibt sich daher eine minimale Regierungszeit von 13
Jahren und eine maximale von 22 oder 23 Jahren (siehe: Michel Baud: The
Relative Chronology of Dynasties 6 und 8, Leiden / Boston 2006, S.
145-146, 156),
Lt. dem ägyptischen Priester und Chronisten
Manetho ist König Teti von seinem Palast-Leibwächtern während einer
Harems-Verschwörung ermordet. Dieses könnte auch der Grund dafür sein, dass
sein Nachfolger für kurze Zeit (2-4 Jahre) der ansonsten unbekannte
"Userkare" (Mächtig ist die Seele von Ra) war. Tetis leiblicher
Sohn und legitimer Nachfolger, Pepi I. kam erst nach ihm auf den Thron.
Aus der Regierungszeit von König Teti sind uns so gut wie keine
historischen Fakten überliefert. Der Horusname "Sehotep-ptawy" (Er,
der die zwei Länder befriedet" von König Teti, deutet wahrscheinlich
darauf hin, dass am Beginn seiner Regentschaft wahrscheinlich militärische
Befriedigungsfeldzüge stattgefunden haben mussten.
Unter Teti bestanden die Handelsbeziehungen zum syrischen Byblos weiter,
hier fand man vor Ort einen Alabasterteller sowie ein Kalksteinfragment mit
dem Namen des Königs. Aus dem Sinai wurde ein Text gefunden, der in das
"Jahr nach dem 3. Mal der Zählung" datiert ist, daneben fand sich
noch die Angabe: "Der Gott ließ einen Edelstein gefunden werden in NHn-Ra,
beschrieben vom Gott selbst".
Von Tomas - nördlich von Abu Simbel in Unternubien gelegen - zeugt ein
Felsgraffiti, welches von königlichen Beamten hier hinterlassen wurde - von
Expeditionen in dieses Gebiet. Von Tomas aus führt ein Weg zu den in der
westlichen Wüste gelegenen Diorit/Gneis-Steinbrüchen, aus denen schon König
Chephren (4. Dynastie) Gestein holen ließ.
Das Reich im Inneren
Innenpolitisch gab Teti die Macht an
die Zentral-Regierung zurück und stoppte damit das unter Djedkare Isesi
eingeführte halbautonome Regierungssystem. Trotzdem besaßen seine hohen
Beamten noch immer genügend Macht und Ansehen, sich imposante Grabdenkmäler
bauen zu lassen. Die Mastaba seines Wesirs Mereruka in Saqqara z. B. umfasste
beeindruckende 33 Räume und war reich dekoriert. Es ist das größte,
bekannte Grab, das eindeutig einem Adligen des Alten Reiches gehörte. Dieses
wird als Zeichen dafür gewertet, dass der Reichtum Ägyptens vom zentralen
Königshof zu den Beamten transferiert wurde
Symptomatisch für die beginnende 6. Dynastie ist,
dass es sich bei einem der wenigen erhaltenen Dokumente des Königs um ein
Befreiungs-Dekret handelt. Dieses Dekret ist eine Stele aus Stein, die
zugunsten des Tempels von Abydos am Prozessionsweg zum
Osiris-Chontamenti-Tempel ("des Vordersten-der-Westlichen")
aufgestellt wurde (heute im Brit. Museum Nr. 626 London). Das Dekret gewährte
den Domänen, die zum hiesigen Tempel gehörten, Steuerfreiheit - zudem wird
von einem Neubau des Tempels durch den König berichtet. Es sollte diese
Praxis der Freigiebigkeit gewesen sein, die allmählich die Macht der Monarchie
im Alten Reich unterhöhlte.
|
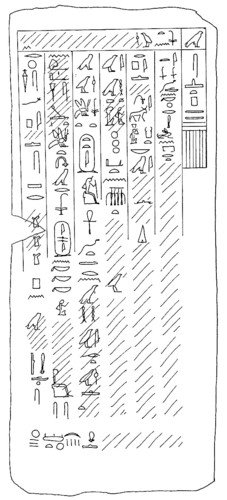
|
Königliches Edikt für den
Tempel des #ntj-Jmn tjw
in Abydos, heute im Britischen
Museum, Nr. 626:
"Horus
SHtp-Awj Der
König befahl an................................... [Bezüglich]
dessen, was du zur Majestät gesagt hast, dass herausgegangen ..........................
um zu veranlassen ...............................................................................................Vieh
und alle Pflichtarbeiten darin ............................................
[Nicht erlaubt] ...........Die
Felder und Leute sind exempiert für #ntj–[imntjw in
alle Ewigkeit] durch Befehlen des Königs von Ober– und Unterägypten,
Teti, er lebe immer und ewiglich. [Ausgestellt
wurde ein entsprechender Befehl] an [den Fürsten, Einzigen Freund]
sdAtj–bjt
j, Vorsteher von Oberägypten Spss-Ra,
(Sohn des) Nj-kAw-Izzj,
dass er unterlasse, die Zahlung (durch)
einen Magistraten, der diese Sachen macht im
.................................................................Gesiegelt
[in der persönlichen Gegenwart des Königs] 4. Monat der Axt–Jahreszeit,
Tag 3.“
|
Sesheshet
(Sesh) / ( %S
sS.t )
-
Mutter von Unas - |
Titel
mwt nsw.t bjt.j = Mutter
des Königs
Hmt nsw.t = Königsgemahlin |
Belege:
genannt wird sie in:
Papyrus Ebers Medical; Grab des Wesirs Mehi; ihr Titel
"Königsmutter" überlebte auf einem Pfeiler des
Totentempels von Pepi I. (siehe Dodson families). |
(Quelle:
Dodson: Complet Royal Families, Thames & Hudson 2004;
engl. Wikipedia, mentioned in the tomb of vizier Mehi; Papyrus Ebers |
Sescheschet (auch "Sesh"
genannt) war die Mutter von König Teti. Sie trug maßgeblich dazu bei, dass
ihr Sohn den Thron bestieg und zwei verfeindete Fraktionen der königlichen
Familie versöhnt wurden (Quelle: Ancient Egypt queen found - The Straits
Times). Im Jahre 2008 entdeckten Archäologen vermutlich ihre Pyramide (Queen's
Pyramid discovered at Saqqara, Plateau Hompage of Dr. Zahi Hawass)
Im medizinischen Papyrus Ebers
(Kolumne LXXVI) wird eine "Seshe(et)" in einem Heilmittel gegen
Haarausfall beiläufig als Mutter des Königs Teti erwähnt (Quelle: Dodson
& Hilton, The Complete Royal families). Seschseschet wird hier als
Verfasserin des Rezepts gegen Haarausfall genannt.
Ein Anwesen der
Sescheschet wird in dem Grab des Wesirs Mehu in Saqqara erwähnt, datiert auf
die erste Hälfte der 6. Dynastie und so wurden die "beiden" Frauen
oft gleichgesetzt. Als letztes ist ihr Titel auf dem Fragment einer Säule im
Totentempel ihres Sohnes Teti erhalten geblieben - der Titel dort lautet
einfach "Königsmutter" - was vermuten lässt, dass König Teti kein
Sohn eines Königs war.
Am 8. November 2008 gab Dr. Zahi
Hawass (damals Generalsekretär der ägyptischen Altertümerverwaltung
bekannt, dass Sescheschet in einer neu entdeckten, 4.300 Jahre alten, 5 Meter
hohen Pyramide in Saqqara begraben worden sei (2). Archäologische Belege
dafür fehlen bislang. Hawass teilte außerdem mit, dass diese Pyramide eine
der besterhaltenen bekannten Nebenpyramiden sei. Die damals neu entdeckte
Pyramide liegt in der Nähe zweier anderer Pyramiden, die vermutlich den
beiden Ehefrauen von Teti (II.) - Iput (I.) und Chuit gehören. Westlich
der neu entdeckten Pyramide fanden sich Lehmziegelmauern, die offensichtlich
zu Magazinen des Grabkomplexes gehören.
Die einst fünf Stockwerke hohe
Pyramide wurde unter einer 7 Meter tiefen Sandschicht, einem kleinen Schrein
und Lehmziegelmauern aus späteren Epochen entdeckt.
Der Zugang ins Innere war noch von der
Granit-Blockierung verschlossen, jedoch hatten frühe Plünderer an der
westlichen Seite einen Tunnel an der Blockierung vorbeigegraben und waren so
in die Grabkammer gelangt.
Man begann Ende November 2008
damit, ins Innere der Pyramide vorzudringen, die Ergebnisse dazu wurden im
Januar 2009 der Presse bekanntgegeben. Der. Zwar war diese - wie die anderen
Pyramiden auch - von Grabräubern teilweise geplündert - jedoch wurde ein
Sarkophag entdeckt, in dem sich das Skelett einer weiblichen Person fand, die
noch in ihrem verrotteten Holzsarg lag. Der Sarkophag aus Granit war bei
seiner Auffindung mit einem Deckel, der ca. 5. Tonnen wog verschlossen.
Im Sarkophag wurden
Schädel-, Bein- und Beckenknochen gefunden, die teilweise noch bandagiert
warten. Des weiteren fanden die Ausgräber goldene Fingerhülsen und einige
Gefäße. Der größte Teil der Keramik datiert in das Alte Reich - einige
andere Scherben stammen aus der 26. Dynastie. Im Sarg fanden sich noch einige
goldene Fingerhülsen, alle anderen kostbaren Grabbeigaben wurden wohl von den
Grabräubern geraubt. Leider fand sich im Grab auch kein Name der
Grabbesitzerin.
Aufgrund fehlender Schriftzeugnisse kann aber bislang nicht
eindeutig bestätigt werden, dass es sich um die Bestattung der Königin Sescheschet
handelt (Quelle: Mummy thought to be Queen Seshestet found in Egypt -
Reutersbericht über den Mumienfund (englisch) auf: reuters.com vom 8. Jan.
2009). Das Bauwerk (Nummer 118) war wohl ursprünglich 14 Meter hoch, an der
Basis 22 Meter - da ihre Basis in einem Winkel von 51 Grad stand.
Iput
(I.)
-
Gemahlin von König Teti (II.)
- Mutter von
König Pepi I. - |
Titel
sAt-njsw.t bjtj =
Tochter des Königs von Ober- u. Unterägypten
sAt-njsw.t-nt-ht.f = Königstochter
von seinem Leib
sAt-ntr = Gottestochter
sAt-ntr-wt =
große Gottestochter
weitere Titel verdankte sie ihrer Heirat mit einem König (Teti)
Hmt-njsw-mery.t = Königsgemahlin,
seine Geliebte
smrt-hrw = Gefährtin
des Horus
wrt-hts = Große
des Hetes-Zepters
mAAt-hrw-stsh = die
Horus und Seth sieht
wrt-Hzwt = Große
des Lobes
weitere Titel
nach der Thronbesteigung ihres Sohnes (Pepi I.)
mwt-njsw.t =
Königsmutter
mwt-njsw.t-bjtj
= Mutter des
Doppelkönigs
mwt-njsw.t-mm-nfr-ppy
= Königsmutter
der Pyramide
Mennefer-Pepy
|
| Pyramidengrab
in der Nähe ihres Gemahls in Saqqara |
Belege:
1) Saqqara-Analenstein - ein als Sarkophagdeckel der Königsmutter
anx-n=s-Pepi III.
wiederverwendeter Monolith mit der Angabe seiner Mutter: Ipw.t (Kairo,
JdE 65908)
2) Opfertafel aus dem Totentempel der Königsmutter
3) Scheintür aus der Nordkapelle
4) Trennwände der Statuennischen ihrer Pyramidenanlage
5) Relieffragmente im Pyramidentempel
6) Drei Gefäße aus der Sarkophagkammer der Königin (Kairo,
JdE 4885 – 6;
JdE
63237 oder
JdE 63238)
7) Stele / Königliches Dekret Pepi I. aus Koptos (Kairo JdE 41890 -
siehe Biografie Pepi I.) mit Geierhaube und Geierkopf;
8) Überreste der Grabanlage des "Sn=j"
und seiner Gemahlin "Zzj" im Umfeld der Teti-Pyramide,
der als Gottespriester der Königsmutter Iput " im
Totenkult der Königsmutter tätig war.
9) Scheintür - entdeckt in der Nähe des Totentempels der Iput I.
(nahe der Nordost-Ecke der Mastaba des "#nt.j-kA"
(eines Untervorstehers der Gottespriester der Königsmutter
Iput I.) mit der Nennung ihres Namens.
10) Ka-Haus der Königsmutter Iput in Koptos, |
Quellen:
Dodson: Complet Royal Families, Thames & Hudson 2004;
engl. Wikipedia,
W. Grajetzki, Altägyptische Königinnen, Hieroglyphenwörterbuch,
Golden House Pub., London 2005 - ISBN 978-0-9547218 -
Tyldesley, Joyce (2005), Chronik der Königinnen von Ägypten, Great
Britain, Thames & Hudson. |
Königin
Iput (I.) - die Ehefrau von König Teti II. - könnte evtl. eine Tochter von
König Unas aus der 6. Dynastie gewesen sein. Ihre Mutter war dann die
Königsgemahlin Nebet oder Chenut. Sie war die Mutter von Tetis Nachfolger Pepi I. und ist
zusammen mit ihrem Sohn auf einer Dekret-Steöe aus Koptos dargestellt (3).
Wenn die Skelettreste, die man in ihrer Pyramide fand, wirklich zu der
Königin gehören, starb sie als Frau in einem mittleren Alter (Grajetzki,
Altägyptische Königinnen: Ein Hieroglyphisches Wörterbuch, Golden house
Publication,London 2005).
Die
Ehefrau von König Teti II. und Mutter von König Pepi I. wird auf mehreren
Belegen aus der Zeit ihres Sohnes Pepi I. identifiziert - und unterscheidet
sich auch als solche deutlich von der einer Königin gleichen Namens aus der
Zeit Pepi II. Sie wird u. a. in der Titulatur ihres Sohnes Pepi I. auf dem
Annalenstein von Saqqara genannt (der später als Sarkophagdeckel der
Königsmutter Anchnes-Pepi verwendet wurde (siehe Baud/Dobrey BIFAO 95, 1996,
23-92). Wie üblich beginnen die Aufzeichnungen für einen neuen Herrscher auf
dem Annalenstein von Saqqara mit der Titulatur und der Angabe des Namens
seiner Mutter: "Horus Mery-taui, König von Ober- und Unterägypten,
Mery-het-Nebtj, Goldhorus, Sohn des Re, Pepi, Mutter des Königs von Ober- und
Unterägypten, Iput".
Die
Abstammung von Königin Iput I. ist aber nicht so gesichert, wie es den
Anschein hat. Zwar trägt sie den Titel "Tochter des Königs von Ober-
und Unterägypten" und "Königstochter, leibliche", welche sie
eindeutig als Tochter eines Königs und Prinzessin ausweisen, aber der 2.
Titel könnte nach Silke Roth (siehe: "Königsmütter") zu "[zA.t–nTr
nj.t] X.t [= f], "leibliche
Gottestochter" oder mit Michel Baud (Dissertation: Famille royale et
pourvoir dans I'Ancien Empire égyptien 1999) zu [zA.t – nTr
nj.t] X.t [= f] zu "leibliche
Gottestochter" als Teil des Herrinnen-Namens von Pepi I. ergänzt werden
und scheidet als sicherer Beleg für eine königliche Herkunft evtl. aus. Lt.
Roth und Baut ist der verbleibende Titel "zA.t– jswt–bit" so ungewöhnlich, dass es sich
evt. um einen Ehrentitel handeln muss. Nach Silke Roth hat Pepi I. seine
Mutter hier nachträglich als "Tochter des Königs von Ober- und
Unterägypten bezeichnet, um damit eine genealogische Anbindung seiner Familie
an die königlichen Ahnen der 5. Dynastie herzustellen. Bettina Schmitz (Untersuchungen zum Titel Königssohn,
1976, Rudolf Habelt-Verlag, Bonn) geht sogar davon aus, dass Iput I. gar
nicht königlicher Herkunft sein kann, weil die Könige einer neuen Dynastie,
in diesem Fall Teti, niemals eine Tochter der Vorgängerdynastie geheiratet
hätten. Nach der Meinung des brit. Ägyptologen Arthur R. Callender
(Assistent von Howard Carter bei den Ausgrabungen von KV 62), weisen die erste
sekundär zur Pyramide umgebaute Mastaba von Iput I. und die einfache
Ausstattung ihres Grabes darauf hin, dass sie ursprünglich einen niedrigeren
sozialen Status hatte als Chuit (II.), die andere Gemahlin von König Teti.
Daher stellt sich bei manchem Ägyptologen die Frage: wer war die
Königsgemahlin von Teti II. eigentlich, bevor sie ihn heiratete und die
Mutter seines Nachfolgers König Pepi I. wurde? (5).
Nach
der Meinung von R. Bußmann (siehe SAK 39) könnte hier das sog. "Koptos-Dekret"
von Pepi I. den entscheidenden Hinweis für die Herkunft der Königin Iput I.
geben. Ebenso wie später Merenre I. und Pepi II. es in Abydos getan haben,
besteht die Möglichkeit, dass Pepi I. einen Statuenkult für die Familie
seiner Mutter Iput I. in deren Herkunfsort Koptos (Hauptstadt des 5.
Oberägyptischen Gaus) errichten lassen hat. Iput I. wäre demnach die Tochter
einer einflussreichen Gaufürstenfamilie in Koptos zur Zeit der 6. Dynastie
gewesen.
Pepi
I. wurde für seine Mutter Iput I. (die zunächst unweit des Bezirks ihres
Gemahls Teti II. in einer Mastaba bestattet wurde) als Bauherr tätig und
verwandelte postum ihre Mastaba zu einer Pyramide einer Königsmutter um,
sowie der Einrichtung eines Ka-Hauses für seine Königsmutter in Koptos.
Zudem verlieh er ihr den Titel "Gottestochter" und stiftete eine
Opfertafel, in welcher Iput I. als "Königsmutter des Pepi in Pepi
Men-nefer" bezeichnet wird. Von der ursprünglichen Mastaba-Form der
Grabanlage der Iput I. zeugen heute nur noch die für eine Pyramide untypische
senkrechte Schachtanlage, in der sich ein Kalkstein-Sarkophag in einer
einfachen Kammer befand (siehe dazu Janosi/Pyramidenanlagen, 181) sowie die
Bauweise des im Osten vorgelagerten Totentempels, der sich durch die Abfolge
und Gestaltung seiner Räume von den sonst üblichen Pyramidentempel der
Königinnen-Pyramiden unterscheidet (siehe Silke Roth/Königsmütter des Alten
Ägyptens, 2001, Harrassdowitz-Verlag).
Pyramide
der Iput (I.)
Der
Pyramidenkomplex der Königin Iput I. (ebenso wie der von Königin Chuit
II.) befindet sich in nördlicher Richtung - sehr nahe bei der Pyramide von
König Teti. Diese Komplexe wurden ursprünglich 1898 von Victor Loret
untersucht, aber eine intensivere - wenn auch nicht vollständige - Ausgrabung
von Cecil Firth und Battiscombe Gunn wurde 1926 durchgeführt und publiziert. Victor Loret hielt den
Bau allerdings nicht für eine Pyramide, sondern für eine Mastaba. Vito
Maragioglio und Celeste A. Rinaldi haben in den 1960er Jahren die Grabstätte
genau vermessen. Viele
Jahre später äußerte Rainer Stadelmann die Überzeugung, dass die Pyramide
der Königin Iput I. zuerst als Mastaba erbaut worden war und später unter
König Pepi I. (dem Sohn von Iput I.) in einen Pyramiden-Komplex umgewandelt
worden ist. Abschließend
wurde der Bezirk 1996 von einem ägyptischen Team unter Leitung
von Dr. Zahi Hawass nochmals erforscht.
Die Königin starb
wahrscheinlich am Ende der Regierung des Königs
Userkares, auf jedem Fall aber noch vor dem Regierungsantritt ihres
Sohnes Pepi I. Nach
seiner Thronbesteigung ließ Pepi I. die Mastaba teilweise abtragen und durch eine Pyramide
ersetzen, was parallel zu den Arbeiten an der Pyramide seines Vaters Teti
stattgefunden haben dürfte. Es hat den Anschein als hätte Pepi
I für den Bau der Pyramide seiner Mutter Iput
I. Material von der Pyramide Königin Chuit
II. verwendete, dabei wurde diese so stark abgetragen dass es bis in
die jüngste Zeit hinein nicht möglich war. sie als Pyramide zu
identifizieren. Ob sich an der Südseite der Teti-Anlage weitere
Nebenpyramiden befinden, muss unbeantwortet bleiben, da in diesem Gebiet
bisher keine Untersuchungen durchgeführt wurden (4).
Die
Iput-Pyramide liegt etwa 90 m nördlich der Teti-Pyramide. Bei der Anlage der
Iput I. beträgt der Abstand zur Umfassungsmauer des Teti-Bezirks ca. 75 m und
ist vom Bezirk der anderen Königin von Teti, Chuit II., durch eine eigene
Umfassungsmauer getrennt. Sie liegt mit der Chuitanlage auch nicht in einer
Flucht. Die Iput-Pyramide hatte eine Basislänge von 21 m (=40 Ellen), bei
einem Winkel von 63-65° und hatte somit eine Höhe von ca. 21 m = 60 Ellen,
bei einem Bauvolumen von 4.689,30 m³.
Der
Iput-Komplex hat keinen Taltempel, keinen Aufweg und keine Kultpyramide, weist
aber eine Reihe von ungewöhnlichen Merkmalen auf: der Totentempel, der sich
auf der Ostseite der Pyramide befindet, besitzt einen ungewöhnlichen - nicht
standardmäßigen Grundriss. Er ist von der Teti-Pyramide aus von Süden zu
betreten. Heute zeugen von der Grabanlage der Königin Iput I. nur noch die
für eine Pyramide untypische senkrechte Schachtanlage mit dem originären,
grob gearbeiteten Kalkstein-Sarkophag, der in einer einfachen Kammer stand,
sowie möglicherweise die grundlegende Struktur, des im Osten vorgelagerten
Totentempels. Die Pyramide selbst hatte einen
dreistufigen Kern. Der von einer eigenen Umfassungsmauer begrenzte Bezirk der
Iput I. weist an der Ostseite der Königinnenpyramide auch eine kleine
Kultpyramide auf (Quelle: Stadelmann, Pyramiden, 192).
Der Eingang zur Pyramide selbst ist aber einzigartig.
Er besteht aus einem vertikalen Schacht, der auf Höhe der zweiten Schicht des
Kerns beginnt, worauf die Vermutung basiert, dass die Pyramide ursprünglich -
wie schon von Prof. Rainer Stadelmann festgestellt - als Mastaba gebaut wurde und später nach der Thronbesteigung von Iputs Sohn
in eine Pyramide umgewandelt wurde. Leider ist von der eigentlichen Pyramide
nur noch der ursprüngliche Mastaba-Abschnitt erhalten. Vom Eingangsportal aus
rosafarbigen Granit des Pyramidenbezirks der Iput zeugte bis vor kurzem nur
der Bericht des ersten Ausgräbers, Victor Loret. Dieser sah die Türpfosten
noch in situ und er fand den Türsturz noch auf dem Boden liegend
(siehe Loret, BIE 10, 1899, 89). Im "Livre des Rois" von Gauthiers
wurden dann später einige Titel der Königin wiedergegeben (LR I, 146 m. Anm.
I.). Diese hatte Loret offenbar auf den Inschriften der Opfertafel, der
Scheintürstele in der Nordkapelle und den Trennwänden der Statuennischen des
Totentempels gesehen.
In der Grabkammer (Tiefe ab
Bodenniveau ca. 11 m; Länge ca. 4 m und Breite 2,80 - 3,60 m) wurde ein grob
behauener Kalkstein-Sarkophag (Länge 2,50 x 1,50 x 1,75 m) mit Fragmenten
eines Zedernholzsarges und Knochen einer Frau mittleren Alters entdeckt (Alter
zwischen 35 -45 Jahren). Allerdings erklärte Dr. Zahi Hawass, dass es sich um
die Knochen einer jungen Frau handelt (?). Von den Grabausstattung der
Königin haben sich 5 Kalkstein-Kanopen, eine Kopfstütze aus Alabaster, zwei
Alabastertäfelchen mit dem Namen der 7 heiligen Öle, ein goldener Armreif,
Modellgefäße aus Alabaster und Kupfer sowie blattvergoldete Werkzeugmodelle
aus Kupfer, die zum Teil mit Namen und Titel der Königsgemahlin beschriftet
sind. Die fünf Kanopen sind merkwürdig, da es normalerweise nur vier
pro Set gab, was bedeutet, dass die fünfte zu einer anderen Bestattung
gehören muss (5).
Bei seinen jüngsten
Nachgrabungen entdeckte Dr. Zahi Hawass auch einen Türpfosten aus Kalkstein,
der mit Bildern von Schlangen, liegenden Schakalen und Löwen verziert war.
Allerdings glaubt Dr. Hawass, dass dieser Türpfosten wahrscheinlich aus dem
nahen Djoser-Komplex stammt.
Der Totentempel der Iput I.
Der kleine Totentempel von Iput an
der Ostseite ihrer Pyramide hat einen etwas a-typischen Grundriss - vermutlich
aufgrund anderer, bereits in der Nähe vorhandener Monumente, die den für den
Bau des Pyramidenkomplexes verfügbaren Platz einschränken. Der Totentempel
besaß
- hinsichtlich der Abfolge und Gestaltung der
Räume gegenüber den Pyramidentempeln anderer Königinnen, Besonderheiten. Z.
B. musste man, um den Totenopferraum zu erreichen, nicht - wie sonst in
anderen Pyramidentempeln üblich - den Hof überqueren, wie bei
Mastaba-Tempeln der Königinnen Nebet und Chunet aus der Regierung
von König Unas.
|
Hypothetischer Grundriss
des Iput-I.-Pyramidenbezirks in Saqqara
(der Plan von Neithsabes entspricht
hinsichtlich der Säulen nicht der Forschung!) |
Die Eingangshalle
bestand aus vier Kalksteinsäulen, gefolgt von einem Vorraum mit zwei Säulen.
Der Eingang mit Türpfosten und Türsturz aus Rosengranit befand sich auf der
der Königspyramide zugewandten Süd-Seite.
Hinter dem 3-Kapellenraum (Länge 5,70m, Breite 2,70m) mit den drei tiefen
Nischen für die Königinnenstatuen folgt der Totenopferraum (A) mit
einer Scheintür aus Kalkstein, die Granit imitieren soll (Länge
6,40m; Breite 2,10m / ca. 3 ½ x
12 Ellen = 1,85 x 6,30m), dem im Norden ein Magazinraum (B) annähernd
gleicher Größe und Ausrichtung folgt.
Der ganze Komplex war von einer Umfassungsmauer aus Kalkstein
umgeben. |
Umzeichnung: Pyramide
Iput I.
Autor: Neithsabes, Wikipedia 2008
Lizenz: CC
BY 3.0
re-worked by Nefershapiland / beschriftet
- Lizenz CC BY-3.0 - |
Nördlich einer Nord-Süd
ausgerichteten Eingangshalle mit den 4 Kalksteinpfeilern (fehlen im obigen
Plan leider) liegt ein kleiner
Ost-West orientierter Raum mit drei Türen. Die nördliche der Türen gewährt
den Zutritt zu einem offenen Nord-Süd-ausgerichteten Achtpfeilerhof in
Zweierreihe (dem sog. Verehrungshof - im Plan oben hat dieser nur 6 Säulen !)
(Länge 11,60 x 5,90 m). Die westliche Türe des
Durchgangsraumes führt in den inneren Teil des Totentempels.
Als erstes trifft man
im inneren Teil des Totentempels auf einen Raum mit zwei Kalksteinpfeilern (im
Plan von Neithsabes nicht vorhanden). Im Norden eines Drei-Kapellenraumes
(Länge 5,70 x Breite 2,70 m) befinden sich drei tiefe Nischen, in denen sich
wohl Statuen der Königin befanden. Von hier aus gelangt man nach Norden in
einen Ost-West orientierten Totenopferraum mit einer Länge von 6,40 m und
einer Breite von 2,10 m. Im Norden ist ein Magazinraum mit gleichen
Abmessungen und Größe angegliedert.
An der Westwand des
Totenopferraumes befand sich eine bemalte Scheintür aus Kalkstein, die wohl
einst Granit imitieren sollte. Davor stand eine Opferplatte aus Rosengranit,
deren Inschrift - zusammen mit den Inschriften der Scheintür aus Granit in
der Nordkapelle - für die Datierung der Änderungen der Mastaba in eine
Pyramide ausschlaggebend waren.. Die Inschrift darauf nennt Iput I. als
"Königsmutter [der Pyramide] von Dauer ist die Schönheit des
Pepi". Diese Inschrift stellt den ältesten Beweis für eine Verbindung
zwischen einer Königin und dem Königskult dar.
Zum
Dekorationsprogramm:
Im kleinen „Durchgangsraum“, dem
Pfeilerhof und dem Kapellenraum sind Teile der unteren Register erhalten, die
dem Totenopferraum zustrebenden Opferträger u.ä. zeigen. Eine stehende
Königin befindet sich auf den Außenseiten der Trennwände zwischen den 3
Kapellen - eine Reihe von lose aufgefundenen Reliefblöcken mit
großformatigen Darstellungen der Königsmutter zeigen sie im Umgang mit den
Göttern oder unter dem schützenden Horus-Falken schreitend. Des weiteren
ihren königlichen Sohn Pepi I., begleitet von seinem Ka. Auf einem weiteren
Fragment ist die Göttin Hathor in ihrer Kuhgestalt mit Kuhgehörn und
Sonnenscheibe geschmückt zu sehen. Sie verheißt dem König Pepi I.
"Leben und viele Sed-Feste". Auf einem anderen Fragment steht die
Göttin Hathor vor der Königsmutter und übergibt ihm ein "was-Szepter",
was sie wesensgleich mit den Göttern erscheinen lässt.
(Quellen für den obigen Artikel
über die Iput-Pyramide: ÄAT 46 – "Die Königsmütter im Alten Ägypten",
Silke Roth; "Zum Dekorationsprogramm des Pyramidenbezirks König Teti II.
Dagmar Stockfisch; Peter Janosi / MDAIK 45)
*
In
den dem Totentempel im Osten vorgelagerten Magazinräumen, wurde zu einem späteren
Zeitpunkt das Grab des Prinzen &t i–anx /
Tt - anch
eingerichtet, dessen Scheintür an der östlichen Mauer des Hofes der Königsmutter
angrenzt (4). Ganz in der Nähe des Totentempels der Iput I. - nahe der
Nordost-Ecke der Mastaba des "Chenti-ka" (#nt.j-kA),
wurde die Scheintür eines
"Untervorstehers der Gottespriester der Königsmutter Iput" (jmj-x.t
Hm.w nTr mw.t nswt Ipw.t)
entdeckt.
C
huit (II.) "Die Beschützte"
-
Ehefrau von König Teti II. - |
Titel
Hmt nsw.t = Königsgemahlin
mt-njswt mryt=f =
Königsfrau, seine Geliebte
smrt-jrw = Gefährtin
des Horus |
Belege:
Opfertisch mit den Titeln und dem Namen der Königin, gefunden im
Bestattungskomplex (Totentempel ?) ihrer Pyramide nordöstlich der
Pyramide des Königs Teti in Saqqara. |
(Quelle:
Dodson: Complet Royal Families, Thames & Hudson 2004;
engl. Wikipedia, franz. Wikipedia /Pyramide Khouit II.) |
Chuit
(II.), (Chuit A nach Dodson) deren Name "die Beschützte" bedeutet,
war evtl. die erste königliche Gemahlin von König Teti II. Wenn dieses
zutrifft, wurde ihre Position später von Iput I. (siehe oben) übernommen.
Evtl. war Chuit - lt. der Ägyptologen Peter Jánosi und Arthur Callender
(Quelle: Miroslav Verner, The Pyramids: The Mysterie, Culture, and Science of
Egypt's Great Monumentes. Grove Press 2001) - die Mutter des kurzfristigen
Königs Userkare - was aber überhaupt nicht sicher ist (einige der Forscher
halten aber auch eine Königin Chentkaus III - genannt auf einem Block von der
Pepy I.-Pyramide -. als Mutter von Userkare) (siehe Dodson & Hilton:
Complete Royal Families, Thames & Hudson 2004). Die Königin Chuit (II.)
war die Mutter des Königssohnes "Tetianch-chem" und möglicherweise
der Königstochter "Seshseshet Sheshit".
Pyramide
der Königin Chuit (II.)
Die Pyramiden der beiden Königinnen Iput I. und Chuit (II.) wurden zwischen
Juli 1897 und Februar 1898 von Victor Loret nördlich des Pyramidenkomplexes
König Tetis in Saqqara entdeckt und teilweise ausgegraben. Die unterirdische
Anlage des Grabes fand Loret damals nicht, doch legte er die Kultanlage frei
und identifizierte die Besitzerin der Grabanlage aufgrund der von ihm
gefundenen Relieffragmente (siehe Jean Phillipe Lauer, Saqqara, Die
Königsgräber von Memphis, Gustav Lübbe-Verlag 1977). Firth und Gunn, welche
an der Pyramidenanlage der Königin Iput I. gruben, untersuchten die Anlage
der Königin Chuit II. nicht, obwohl ihr Grabkomplex direkt im Süden an den
der Königin Iput I. angrenzt - nur etwas seitlich nach Westen versetzt und
näher zur Königspyramide als dieser.
Unsicher
blieb lange Zeit, ob diese Stätte überhaupt eine Pyramide gewesen ist.
Loret, ihr Entdecker, dachte zunächst, das Grab der Chuit (II.) sei eine
Mastaba. Erst die Ausgrabungen durch Maragioglio und Rinaldi in den 1960er
Jahren deuteten darauf hin, dass Chuit in einer Pyramide begraben wurde - es
wurden auch Reste von Mauerwerk gefunden, die zu den Ruinen eines kleinen
Totentempels gehörten. Der französische Ägyptologe und Direktor der
französischen archäologischen Mission von Saqqara (Leiter der Ausgrabungen
in der Nekropole des Königs Teti in Saqqara 1990 - 1997) Audran Labrousse
ermittelte erneut die Position der mittlerweile völlig verschwundenen
Grabanlage, die seit den Ausgrabungen von Loret in den Jahren1897-1898 und
Firth im Jahre 1922 in Vergessenheit geraten war.
Weitere
Ausgrabungen von Dr. Zahi Hawass im Jahre 1995-1997 haben dann den
Pyramidencharakter der Grabanlage bestätigt. Die Anlage hatte die gleichen
Abmessungen wie die Pyramide der Königin Iput (I.) und auch einen ganz
ähnlichen Totentempel wie diese auf ihrer Ostseite. Die Pyramide war
ursprünglich wohl 20 m hoch - heute stehen davon nur noch ca. 7 m. Die solide
gebauten unterirdischen Grabräume sowie der Sarkophag aus rosa Granit
führten lt. Hawass zu der berechtigten Annahme, dass Königin Chuit (II.) -
ähnlich wie Iput (I.) eine bedeutende Stellung am Königshof innehatte.
In
einem der Grabräume der Chuit-Pyramide wurde der Sarkophag eines
Würdenträgers namens "Abed" aus der Hyksoszeit gefunden, was wohl
beweist, dass die Pyramide zumindest noch einmal geöffnet und für weitere
Bestattungen benutzt wurde.
|
Hypothetischer Grundriss
des Chuit-Pyramidenbezirks in Saqqara
|
| Das Bauwerk hat eine
Seitenlänge von 21 m und wurde 1898 von Victor Loret entdeckt. Lange
Zeit war umstritten, ob es sich bei diesem Grabmal tatsächlich um
eine Hyramide handelte. Erst erneute Graburnen, die 1995 unter der
Leitung von Dr. Zahi Hawass begannen, konnten dies bestätigen.
Ausgrabungen ergaben, dass die Pyramide
eine Grabkammer mit einem rosa Granitsarkophag beinhaltete. Der
Totentempel, der mit dem Bestattungskomplex verbunden ist, befindet
sich östlich der Pyramide. Der Tempel enthielt einen Opferraum mit
einer Scheintür und einem Altar. Die Wände waren dekoriert und
zeigten Szenen mit Opferträgern. |
Umzeichnung: Pyramide
Khout II.
Autor: Neithsabes, Wikipedia 2008
Lizenz: CC
BY 3.0
re-worked by Nefershapiland / beschriftet
- Lizenz CC BY-3.0 - |
Umzeichnung
aus dem Grabbezirk der Königin Chuit in Saqqara |
| Darstellung aus dem Grabbezirk der
Königin Chuit II. - Gemahlin von König Teti II. Die Königin
steht in einem kleinen Papyrusboot und hält zwei Vögel in ihrer
linken Hand. Die Inschrift vor ihr weist die Königin als
Königstocher aus (zAt-nsw.t) (?).
Den Nachgrabungen des SCA an der
Grabanlage der Chuit II. in Saqqara unter Leitung von Audran Labrousse
im Jahre 2008 zufolge ist lt. Dr. Zahi Hawass dieser Pyramidenbezirk
"älter" als der der Königin Iput I. - somit müsste Chuit
II. die erste Gemahlin von König Teti gewesen sein und somit spricht
einiges dafür, dass Chuit die Position der "Großen Königlichen
Gemahlin" innehatte.
|
| Bild aus: drawing after fig. 11 in Zahi
Hawass §Report discoveries in the pyramid complex of Teti at Saqqara
in Abusir and Saqqara 2000, n the Year
p. 444,
- nach Vivienne Gae Callender Jan. 2010, 246-260 - |
Der einzige inschriftliche Beleg für Königin Chuit II.
stammt von einem Fragment ihrer Kultanlage, auf der ihr Name aber leider nicht
vollständig erhalten ist. Die in der Totenkultanlage gefundene Scheintür
bestand aus Rosengranit - davor stand ein Altar, der auf einem heute noch in
situ befindlichem Sockel ruhte. An der Nordwand stand - ebenso wie bei
Königin Iput I. - eine Steinbank. Die Tempelwände des Totentempels waren
dekoriert und zeigten Szenen von Opferträgern (sie M. Verner, Die Pyramiden,
Grove Press 2001).
Chentkaus
III. oder IV / Khen
-evtl.,
Ehefrau von König Teti II. -(?)
und evtl. Mutter von Userkare (?) |
Titel
mwt-nsw.t = Königsmutter |
Belege:
known from a relief-fragment in the mortuary-temple of Pepi I.
(Quelle: Dodson - families) |
| (Quelle:
Dodson: Complet Royal Families, Thames & Hudson 2004; |
Lt. Dr. Aidan Dodson (Complete
Royal families) ist Chent[kaues III] (?) evtl. eine weitere Gemahlin von
König Teti und die Mutter des kurzzeitigen Nachfolgers Userkare, der ihm auf
den Thron folgte. Sie ist auf einem Relieffragment aus dem Totentempel von
Pepi I. belegt. Es ist möglich, dass sie die Eigentümerin einer Mastaba war,
die südlich der Gräber der Königin Iput I. und Chuit II. liegt. Später
wurde dieser Bau in die Mastaba des Beamten Chentika integriert.
Nearit
/ Nebnahit oder Neith (?)
-
evtl.,
Ehefrau von König Teti II. -(?) |
Titel
Erbprinzessin, Tochter des Geb, Königsfrau, seine Geliebte,
Neith;
Erbprinzessin, Tochter des Königs von seinem eigenen Leib, Neith;
Königsfrau und Königstochter;
Tochter des Geb |
Belege:
Inschrift im neu gefundenen Totentempel einer neu entdeckten
Königinnenpyramide in Saqqara und Inschrift auf einem Obelisken, wo
der Name "Neith" erwähnt war. |
| Grabungsbericht
von Zahi Hawass, November 2022; National Geographic: Geheimnisvoller
Pyramiden-Fund in Ägypten: Wer war Königin Neith? |
Zu den neuesten Funden
eines Archäologenteams unter Leitung von Dr. Zahi Hawass gehört das Grab
einer unbekannten Königin, das unweit von Kairo in Saqqara ausgegraben wurde
und im Zusammenhang mit König Teti steht. Dr. Hawass, der ehemalige Minister
für Altertümer in Ägypten, ließ verlauten, dass es "erstaunlich ist,
unser Geschichtswissen buchstäblich neu zu schreiben und unseren
Aufzeichnungen eine neue Königin hinzuzufügen".
Die Reste einer unbekannte
Königinnen-Pyramide wurden schon 2008 nahe der Teti-Pyramide entdeckt. Der
Bau steht heute noch ca. 5 m hoch an und hat eine Abmessung von 15 x 15 m. Er
war mit feinem weißen Kalkstein verkleidet. Lt. Dr. Hawass, damals
Generalsekretär der ägyptischen Altertümerverwaltung ist diese neu
entdeckte Pyramide "eine der besterhaltenen bekannten
Nebenpyramiden". Schon Ende 2008 begannen die Archäologen damit, ins
Innere der Pyramide vorzudringen. Der
Zugang ins Innere der Pyramide war durch eine Stein-Blockierung aus Granit
verschlossen, aber frühe Grabräuber hatten an der westlichen Seite einen
Tunnel an der Blockierung vorbeigegraben und waren in die Grabkammer
eingedrungen.
Im Januar 2009 wurden erste
Einzelheiten über die Grabkammer bekannt. Es wurde ein großer
Granit-Sarkophag gefunden, der mit einem 5 Tonnen schweren Deckel verschlossen
war und noch Reste eines Begräbnisses enthielt. Die Mumienfragmente einer Frau
lagen einst in einem Holzsarg, der in den Steinsarkophag gestellt wurde.
In ihm wurden Schädel-,
Bein- und Beckenknochen eines weiblichen Skelettes gefunden, das noch
teilweise bandagiert war. Des weiteren fanden die Ausgräber goldene
Fingerhülsen und die Scherben von einigen Keramikgefäßen, die man ins Alte
Reich datierte. Alle anderen Grabbeigaben waren wohl von den Grabräubern
mitgenommen worden. Aufgrund fehlender Schriftzeugnisse konnte man aber damals
nicht eindeutig feststellen, wer die Besitzerin dieser Pyramide war.
Dr. Zahi Hawass ging zuerst wohl
davon aus, dass es sich hier um das Grab der Königsmutter von König Teti,
die Königin Seschseschet (Sesch) handelt, weil die neu entdeckte Königin die
Titel "Königsfrau" und "Königstochter" trug und daher
ihr Vater nur ein König der 5. Dynastie sein kann. Dr. Hawass sagte damals in
seiner Erklärung: "Obwohl man den Namen der in der Pyramide begrabenen
Königin nicht gefunden hat, deuten alle Anzeichen darauf hin, dass es sich um
Seshestet handelt, die Mutter von König Teti, dem ersten König der sechsten
Dynastie." (Zitat Dr. Hawass lt. Reuters am 8. Jan. 2009). Doch
das wurde nach den forensischen Untersuchungen der Dame im Sarkophag wohl
wieder verworfen, weil die Mumie dafür zu jung war.
Das Alter der Dame muss bei
ihrem Tod ungefähr zwischen 17 und 25 Jahre gelegen haben - womit sie
nicht die Mutter von König Teti II. gewesen sein kann (Quelle: Sokar Nr. 18 /
2009).
Aufgrund der Unruhen im
arabischen Raum mussten die Ausgrabungsarbeiten in Saqqara jedoch unterbrochen
werden, nachdem bereits ein Teil der Pyramide freigelegt worden war. Erst im
Jahre 2019 konnte das Team von Dr. Zahi Hawass nach Saqqara zurückkehren und
die Ausgrabungsarbeiten fortsetzen. Die neue Königinnen-Pyramide ist Teil
einer ganzen Gruppe von Bauten, zu denen auch die Teti-Pyramide sowie die der
beiden Gemahlinnen von ihm gehören.
Erst in der Grabungssaison 2019
wurde östlich der neu entdeckten Königinnenpyramide der dazugehörige
Totentempel entdeckt. Zuerst fand man den Tempelboden aus Kalksteinplatten in
unterschiedlichster Form und Größe, später kamen die aus Kalkstein
errichteten Tempelwände zum Vorschein. Der Tempel misst ca. 5 x 2 m und die
Wände besitzen eine Breite von 1,22 m bei einer Höhe von 1,29 m.
Westlich der
Königinnen-Pyramide fanden die Ausgräber nun Lehmziegelmauern, die wohl zu
Magazinen des Pyramidenkomplexes gehören. Die aus Lehmziegeln errichteten
Magazine befanden sich an der Südseite des Totentempels und bestanden aus
drei rechteckigen Räumen. In nord-südlicher Richtung befindet sich der
westlichste Raum, der ca. 4 m lang ist und 1,5 m breit ist. Die Westseite des
Raumes wird von einer Lehmziegelwand gebildet und endet mit den Überresten
einer gewölbten Decke. Der Zugang in den Raum befindet sich an der Südwand.
Der zweite Raum, der von Osten
her betreten wird, befindet sich östlich davon und misst 10,2 m in
Ost-West-Richtung mit einer Breite von 4,2 m. Der Boden besteht aus
Kalksteinplatten von unterschiedlicher Größe und Form. Der dritte Raum ist
der kleinste von allen (1,75 m x 1,12 m) - der Zugang wurde noch nicht
entdeckt, da die nördliche Ausdehnung des Tempels noch nicht ermittelt wurde.
Nun fand sich auch auf der
Ostseite der östlichen Wand des Totentempels der Name seiner Besitzerin. Die
Inschrift lautete: "Erbprinzessin, Königsfrau, die er liebt,
Neith". Es gab bisher keinerlei Aufzeichnungen über diese Frau, sagte
Hawass. "Ich habe noch nie von dieser Königin gehört. Dies wird ein
Stück der Geschichte zu der des alten Königreichs hinzufügen", sagte
der Ausgrabungsleiter Zahi Hawass im Interview mit dem US-amerikanischen
Nachrichtensender CBS News.
Dennoch war er sich nun sicher, dass es sich bei Neith um eine weitere
Gemahlin von König Teti II. handelt - eine Königin für die diese Pyramide
gebaut wurde. Über dem Namen der Königin scheint es Ungereimtheiten zu geben
- dieses reicht von "Nearit" über "Nebnahit" und
schließlich "Neith".
Das Team unter Dr. Zahi Hawass
war nicht nur vom Grab der Königin, sondern auch von der riesigen Nekropole,
die es umgibt, erstaunt. Die Stätte ist wahrhaft bahnbrechend, denn sie ist
eine "Zeitkapsel", welche das später Alte Reich bis in die noch
wenig erforschte Erste Zwischenzeit umfasst. Bei der Ausgrabung des
ägyptischen Teams wurden in einer Tiefe von 10-12 m mehr als 50 Grabschächte
freigelegt, viele mit Holzsärgen, die Mumien aus dieser Übergangszeit
enthielten, aber auch aus dem Neuen Reich, was zeigt, dass dieses Gebiet in
Saqqara noch viele Jahrhunderte lang eine wichtige Begräbnisstätte blieb -
lange nachdem das Alte Reich schon zusammengebrochen war. Des
weiteren wurden drei Lagerhäuser aus Ziegeln freigelegt, die in dem Alten
Reich datieren (wohl aus der Zeit von König Teti II.). Einige der geborgenen
Sarkophage werden von den Wissenschaftlern den Angehörigen eines Kults
zugeordnet, der offenbar der Verehrung des Königs Teti diente. Die neuen
Funde in Saqqara sollen demnächst im Großen Ägyptischen Museum ausgestellt
werden, das unweit der Giza-Pyramiden entstanden ist.
Auf einem kleinen Obelisken aus
Kalkstein, der traditionell zusammen mit einem heute nicht mehr vorhandenen
Zwilling vor dem Eingang des Grabbezirks stand (H. 1,37m x Grundfläche 40 x
40) fand man eine Inschrift auf seiner Vorderseite: "Erbprinzessin,
Tochter des Geb, Königsfrau, seine Geliebte, Neith". Auf dem Fragment
einer Tür aus Kalkstein stand die Inschrift: "Erbprinzessin, Tochter des
Königs von seinem eigenen Leib......Neith".
Allerdings stand nirgends der
Name ihres Vaters oder ihrer Mutter. Die neu entdeckte Königin trug aber auch
den Titel "Tochter des Geb", einen Titel, den in der 6. Dynastie
auch die "Wesirin" Nebet, die Gemahlin des Chui trug. Der gleiche
Titel ist auch für die Königin Inenek (Frau von König Pepi I.) belegt.
Damit wäre dann die neu entdeckte Königin Neith die erste, welche diesen
Titel trug. Vivian G. Callender schlägt vor, den Titel Tochter des Geb mit
einer nichtköniglichen Abstammung einer Königin gleichzusetzen. Im Falle der
Königin Neith kann dieses aber nicht stimmen, denn sie trug den Titel einer
"Königstochter von seinem Körper".
Userkare
-
Evtl. Sohn von Teti I. und Nachfolger von Teti I. |
Titel
Wsr-kA-Ra =
Stark ist das Ka des Re (Thronname) |
Eltern:
Vater: evtl. Teti I. (?)
Mutter: möglicherweise Königin Chentkaus III. (?) |
Belege:
Granitsarkophag-Deckel der Anchenespepi IV. mit Überreste einer
Inschrift.
3 Rollsiegel und einem Werkzeug;
Königsliste im Sethos I-Tempel von Abydos, und Königspapyrus
Turin. |
Dodson &
Hilton, Royal Families, S. 73;
Thomas
Schneider, Lexikon der Pharaonen, 1994, S. 306;
Michel Baud: The Relative Chronology of Dynastie 6: in Erik Hornung
Ancient Egyptian Chronologie, Brill, Leiden 2006. |
Userkare
war der 2. König der 6. Dynastie, der nur kurz (etwa 2 Jahre ?) regiert hat.
Manetho erwähnt ihn nicht - evtl. diente er auch nur als Interimskönig bevor
der damals noch unmündige Pepi I. auf den Thron kam. Möglicherweise hatte er
aber auch den Thron usurpiert. Es gibt Hinweise, dass die Königin Chentkaus
III. (?) seine Mutter war (siehe Schneider, Lexikon der Pharaonen, S.
306).
Pepi
I.
-
Sohn von Teti I. und späterer König von Ägypten - |
Titel
Nfr-sA-@r.w = Mit
vollkommenem Schutz - ein Horus (Thronname) |
Belege:
Königsliste von Karnak;
Königspapyrus Turin;
Annalenstein von Süd-Saqqara (Nr. 34):
Königsliste von Abydos - Sethos I. - (Nr. 36) |
| Quellen: Michel
Baud: Famille royale et pouvois sous l'Ancient Empire ègyptien,
Band 2, Kairo 1999, S. 565 |
Pepi I. war der Sohn
von König Teti II. und seiner Königsgemahlin Iput I. - und er regierte (nach
Userkare) etwa innerhalb eines Zeitraums von 2295e bis 2250 v. Chr. (nach
Schneider/Lexikon der Pharaonen 2002).
Seschseschet (C)
Watetchethor (%S sS.t Wat.t-xt-!r)
- Tochter von König Teti II.
-
- Ehefrau des Wesirs Mereruka - |
Titel
zAt-nsw-smst
(n Xt,f) = Älteste
Königstochter (von seinem Leib) |
Belege:
Sie wurde im Grab ihres Gemahls Mereruka bestattet. |
| (Quelle:
Dodson: Complet Royal Families, Thames & Hudson 2004 und
Vivienne G. Callender: in The Old Kingdom Art and Archaeology,
Editor Miroslav Bart, Prag 200: The iconography of the princess in
the Old Kingdom, p. 120); |
Nebtynubkhet
Seschseschet (C)
- Tochter von König Teti II.
-
- Ehefrau des Wesirs Kagemni - |
Titel
zAt-nsw-(n
Xt,f) = Königstochter
(von seinem Leib)
(der Titel ist im Alten Reich auch für die Enkelkinder belegt) |
Belege:
Sie wurde im Grab ihres Gemahls, dem Wesir Kagemni bestattet.
- Mastaba Tomb LS10 in der Teti-Nekropole |
| (Quelle:
Dodson: Complet Royal Families, Thames & Hudson 2004 und
Vivienne G. Callender: in The Old Kingdom Art and Archaeology,
Editor Miroslav Bart, Prag 2006: The iconography of the princess in
the Old Kingdom, p. 120); |
Zwei der Töchter von
Teti II. wurden mit hohen Beamten verheiratet. Dieses waren die Prinzessinnen
Seschseschet (C) Watetchethor, die mit dem berühmten Wesir Mereruka
verheiratet wurde und die Prinzessin Nubkhetor Sescheschet (D) - verheiratet
mit dem Wesir Kagemni - beide mit dem Beinamen der Mutter von König Teti
(ihrer Großmutter Seschseschet A (auch "Sesch") benannt. Die
Knochen der Prinzessin Watetchethor befinden sich heute im Nationalmuseum von
Kairo (vorher im Qasre el-Aini Medical School - lt. Dodson families, p.
78).
Seschseschet
Watetchethor
Über die Mutter der Prinzessin Seschseschet
Watetchethor ist nichts bekannt. König Teti hatte mindestens 3 königliche
Gemahlinnen: Chuit, Iput I. und eine Frau, deren Name nur unvollständig
überliefert ist und die evtl. Chentkaus (?) hieß. Welche der Frauen nun die
Mutter der Prinzessin Watetchethor war, ist unbekannt. Zahlreiche Geschweister
von Seschseschet Watetchethor sind bekannt. Ihre Brüder Userkare (nicht
gesichert) und Pepi I., die beide nach dem Tod von Teti II. den ägyptischen
Thron bestiegen, sowie mehrere Schwestern mit den Namensbestandteil
"Seschseschet" (Nebtinubchet/Nebtynubkhet Sescheseschet,
Seschsesschet Scheschit und nochmals Seschseschet Scheschti) und eine
Schwester mit dem Namen "Inti.
Seschseschet
Watetchethor war mit dem Wesir Mereruka verheiratet. Aus dieser Ehe gingen
mehrere Kinder hervor, darunter ein Sohn namens "Meriteti", der
später ebenfalls das Amt des Wesirs übernahm. Weitere Söhne waren Chenti,
Chentu, Ihiemsat, Memi (Name unvollständig erhalten) und evtl. Aperef. Die
einzig bekannte Tochter war [...]ib-nub (der Name ist nur unvollständig
erhalten (Quelle: Dodson & Hilton, Royal families)
Seschseschet
Watetchethor trug folgende Titel: (Quelle: Michel Baud, Famille royale et
pouvoir sous l'Ancien Empire égyptien, Band 2, Kairo 1999)
-
Gottesdienerin der
Hathor
-
Gottesdienerin der
Neith,
-
leibliche
Königstochter,
-
geliebte älteste
Königstochter
-
älteste
Königstochter, versorgt durch ihren Vater, [Versorgte] durch ihren Vater,
von ihm geliebt.
In der Mastaba des Wesirs
Mereruka (Gemahl der Prinzessin Seschseschet Watetchethor) befindet sich auch
ein abgetrennter Bereich, von denen südwestlich sechs für den Totenkult
seiner Gemahlin bestimmt war. Eine Tür, die
links hinter dem Mastabaeingang abzweigt führt in diesen Bereich, ebenso
beinhaltet die Mastaba auch einen kleinen Bereich für ihren gemeinsamen Sohn
am Ende des Gang- und Kammerkomplexes.
|
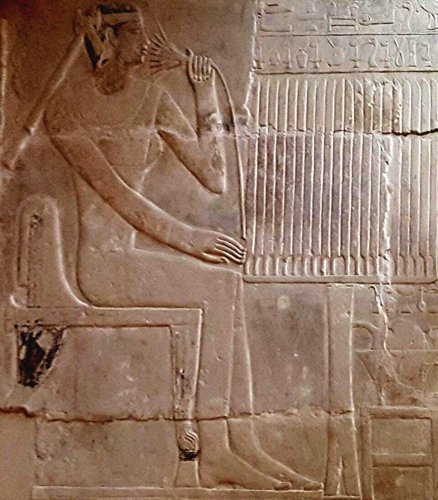
|
Darstellung von Seschseschet Watet-chet-hor
in der Mastaba ihres Gemahls Mereruka
Ein Bildnis der Prinzessin befindet sich in der
Mastaba ihres Gemahls, dem Wesir Mereruka, in Saqqara. Es zeigt sie
sitzend vor einem Opfertisch. Sie riecht an einer Lotusblüte, die sie
in ihrer linken Hand hält. |
Bild:
Mastabaa
of Mereruka-20 (cropped).jpg
Autor: Ovedc, Wikipedia, 5. 10 2017
Lizenz: CC
BY-SA 4.0 |
Eine interessante Szene, die
hier besonders hervorgehoben werden soll, aus dem Grab ihres Gemahls Mereruka,
zeigt den Grabherrn auf einem Bett seiner Gemahlin Watetchethor Seschseschet
gegenüber sitzend und die Prinzessin spielt auf einer Harfe, was von
Buchberger (1995 in Kessler & Schulz in Gedenkschrift Barta, 98) als
eindeutige Relation zwischen Sexualität bzw. Geburt und Harfenspiel im Alten
Reich gedeutet wird.
Nebtinubchet
Seschseschet (D)
Nebtinubchet Seschseschet wurde -
wie viele ihrer Schwestern - nach Tetis Mutter Seschseschet benannt. Es ist
ebenfalls unbekannt, welche der Frauen des Königs ihre Mutter war. Sie war
mit dem Wesir Kagemni verheiratet. Aus der Ehe gingen mehrere Kinder hervor,
von denen aber nur der älteste Sohn Teti-anch namentlich bekannt ist. Sie
trug den Titel einer "geliebte leibliche Königstochter".
Nebtinubchet
Seschseschet wurde in der Mastaba ihres Gemahls nahe der Teti-Pyramide in
Saqqara beigesetzt. Sie ist im Grab zweimal bildlich dargestellt - aber nur
einmal namentlich benannt (Quelle: Michel Baud, S. 486 und Porter & Moss,
Band III., Memphis, Part 2, Saqqara to Dahshur, Oxford 18981, S. 523)
|
Der Name und der Titel der Prinzessin
Nebti-nub-chet Seschseschet
im Grab von Kagemni
"zAt-nswt mr.t
xt=f
wr.t n.t=f Nb.tj-nwb-Xt" =
Geliebte Königstochter von seinem Leib, ihr großer Name ist
Nebty-nub-chet.
|
Datei Nebty-nebu.khet
daughter of Teti.png
Autor: Zemanst, Wikipedis 19. Juli 2024
Lizenz: CC
BY 4.0 |
|
Mastaba-Eingang Kagemni, Saqqara
Nebtinubchet
Seschseschet wurde in der Mastaba ihres Gemahls, des Wesirs Kagemni, nahe der Teti-Pyramide in
Saqqara beigesetzt. Sie ist im Grab zweimal bildlich dargestellt - aber nur
einmal namentlich benannt |
Datei: Tomb
of Kagemni, Saqqara
Autor: Prof. Mortel, Wikipedia 5. Mai 2022
Lizenz: CC
BY 2.0 |
Seschseschet
Scheschit
-
Tochter von Teti I. - |
Titel
zAt-nsw.t-(n Xt,f) = Königstochter
(von seinem Leib)
zAt-nsw.t = Königstochter
zAt-nsw-mr.t-smst
(n Xt,f) = geliebte älteste
Königstochter (von seinem Leib) |
Belege:
Darstellungen
und Inschriften im Grab ihres Gemahls Wedjahateti Nefer-seschem-ptah,
Saqqara |
| Quellen: Michel
Baud: Famille royale et pouvois sous l'Ancient Empire ègyptien,
Band 2, Kairo 1999, S. 565 |
Seschseschet Scheschit
war eine Tochter von König Teti und wurde offenbar nach seiner Mutter
Seschseschet (ihrer Großmutter) benannt. Welche von den mindestens 3
königlichen Ehefrauen des Königs nun ihre Mutter war, ist unbekannt.
Seschseschet Scheschit hatte zahlreiche Geschwister und Halb-Geschwister.
Einige ihrer Schwestern trugen ebenfalls den Namenszusatz
"Seschseschet". Die Prinzessin trug folgende Titel:
-
Sat-nesut = Königstochter
-
Sat-nesut-en-chetef =
leibliche Königstochter
-
Sat-nesut-mer(i)-semset-en-chet
= geliebte älteste Königstochter von seinem Leib
Die Prinzessin Seschseschet
Scheschit war mit dem Beamten Wedjahateti Nefer-Sesch-em-ptah verheiratet, der
u. a. als Aufseher des Großen Hofes, Superintendent der Priester der Teti-Pyramide
und königlicher Kammerherr fungierte (Quelle: Michel
Baud: Famille royale et pouvoir sous l'Ancien Empire égyptien Band 2, Kairo
1999, S. 440). Sie wurde auch in der Mastaba ihres Mannes nahe der
Teti-Pyramide beigesetzt. In der Mastaba befinden sich mehrere bildliche
Darstellungen von ihr.
Inti
-
Tochter von Teti I. - |
Titel
zAt-nsw.t = Königstochter
zAt-nsw.t-(n Xt,f) = Königstochter
von seinem Leib
zAt-nsw-mr.t-smst
(n Xt,f) = Älteste
Königstochter (von seinem Leib) |
Belege:
Darstellungen
und Inschriften in einer Pyramide in Saqqara. |
| Quellen: Michel
Baud: Famille royale et pouvois sous l'Ancient Empire ègyptien,
Band 2, Kairo 1999, S. 565 |
Prinzessin Inti, eine
der ältesten Töchter von König Teti, war ebenfalls mit besonderen Titeln
und Beinamen versehen. Welche der Gemahlinnen von König Teti II. ihre Mutter
war, muss aber ungeklärt bleiben .
Inti trug folgende Titel:
-
Sat-nesut = Königstochter
-
Sat-nesut-en-chetef =
leibliche Königstochter
-
Sat-nesut-mer(y)-semset-en-chetef
= älteste geliebte leibliche Königstochter
Der Aufzählung ihrer Titel in
ihrem Grab sind zudem die Namen der Teti-Pyramide und der Pepi-Pyramide
beigestellt, was zu der Vermutung führt, dass Inti in irgendeiner Weise mit
diesen Anlagen verbunden war (Quelle:
Michel Baud: Famille royale et pouvoir sous l'Ancien Empire égyptien Band 2,
Kairo 1999, S. 417).
Die Prinzessin wurde in ihrer
Mastaba nahe der Teti-Pyramide beigesetzt. Die Mastaba besitzt einen
beschrifteten Türsturz und beschriftete Türlaibungen sowie eine Scheintür
(Quelle: Porter & Moss, Band III, Teil 2, Oxford 1981).
In ihrem Fall war es
wahrscheinlich König Pepi I. (der wohl ihr Bruder war) der ihre Bestattung
organisieren ließ. Dieser erwiesene Gunstbeweis eines eigenen Pyramidenbezirkes
zeugen deutlich von einer besonderen Wertschätzung von Seiten des Königs,
die in diesem Fall auf eine Geschwisterbeziehung zurückzuführen sein könnte
(siehe: V. G. Callender: "Princess Inti of the Ancient Egyptian Sixth
Dynastie", JNES 62 / 2002).
Statuen und Nennungen
von König Teti
- auf
Gegenständen - |
Von König Teti II. ist
nur eine einzige bekannte rundplastische kleine Standstatue aus rotem Granit
erhalten, die James Edward Quibell während der Grabungskampagne 1906/1907 in
Saqqara etwas östlich der Teti-Pyramide in der Verfüllung eines
Grabschachtes gefunden hatte. Sie befindet sich heute im Ägyptischen Museum
in Kairo (JE 39103).
|
Statue des Teti - heute in Kairo JE 39193 -
Höhe 74 cm - roter Granit
- gefunden in der Nähe seiner Pyramide -
Die Statue besteht aus rotem Granit und hat eine
erhaltene Höhe von 74 cm. Die Beine unterhalb der Knie sind nicht mehr
erhalten. Die Statue besitzt einen Rückenpfeiler und zeigt den König
in schreitender Haltung mit nach vorn gesetztem linken Bein. In seinen
Händen hält er den sog. "Schattenstab". Der König trägt
den dreiteiligen "^nDwt"–Schurz
mit Gürtel und auf dem Kopf die Weiße Krone von Oberägypten.
Die Augenlider und Brauen sind plastisch ausgearbeitet. Ein Bart scheint
nicht vorhanden gewesen zu sein.
Eine Inschrift, welche die Statue eindeutig für
König Pepi belegt, ist nicht erhalten. Quibell sah in ihr deshalb ein
mögliches Bildnis von Merikare aus der 1. Zwischenzeit. Diese Zuweisung
erfolgte wohl sicherlich nur deshalb,
weil man damals vermutete, dass die Reste einer Pyramide östlich
der des Teti gelegen, eventuell König Merikare
aus der 1. Zwischenzeit gehören könnten.
Die Zuschreibung für König Teti erfolgte dann durch
William Stevenson Smith anhand von zwei Kriterien: Zum einen dem
Auffindungsort, der sehr nahe an der Teti-Pyramide liegt. Zum anderen
erschien ihm die Qualität der Arbeit deutlich höher als bei
vergleichbaren Statuen der Ersten Zwischenzeit. Auch die neueren
Grabungen des SCA weisen die Reste der Pyramide, die Quibell östlich
der Teti-Pyramide gefunden hatte, eher König Menkauhor aus der 5.
Dynastie zu als König Merikare aus der 1. Zwischenzeit und damit
entfällt wohl der Hauptgrund der Zuweisung der Statue durch Quibell.
|
| Bilder: James Edward Quibell (1867-1935) - Excavations
at Saqqara (1906-1907), Pl. XXXI - Gemeinfrei |
In der ägyptischen Sammlung
Berlin befindet sich ein Salbgefäß aus Kalzit (Höhe: 16 cm; Volumen 256
m³ - Berlin Inv.-Nr. 19/67) mit dem Namen König Tetis
und dem widderköpfigen Gott von Mendes - die Herkunft ist allerdings unbekannt. Es ist ein schlanker, konischer
Becher, auf dem ein flacher, scheibenförmiger Deckel lag. Das
Inschriftenfeld wird gebildet aus zwei "was-Szepter", die von
der Himmelshieroglyphe überwölbt werden. Rechts ist der Horusname des
Königs im Serech mit dem Falken darüber zu sehen, darunter steht der
Segenswunsch: "mit Leben beschenkt, ewiglich". Links sieht man den
Widdergott von Mendes, von dem der König "als geliebt" bezeichnet
wird.
In London, Petrie-Museum
UC 16423) befindet sich ein Bruchstück eines Alabastergefäßes mit den
Namen des Teti.
In Abydos fand man eine Alabastervase mit der
Kartusche König Tetis, auf ihr
wird der König „geliebt vom Widder von Mendes" bezeichnet. Heute im
Nationalmuseum Kairo CG 16037.
Im Imhotep–Museum
in Saqqara befindet sich ein Keulenkopf, der die Namen des Königs zeigt. Der
Keulenkopf ahmt ein florales Motiv nach.
|
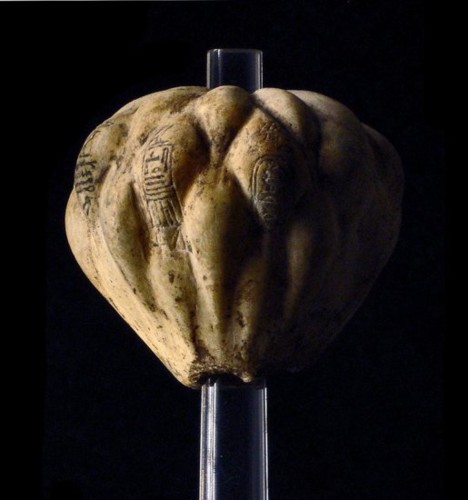
|
Keulenkopf mit der Kartusche von König Teti
Saqqara - Imhotep Museum
Kopf einer birnenförmigen Keule, beschriftet mit dem
Namen und den offiziellen Titeln von König Horus Seheteptawy Teti. |
Bild:
Teti
II.
Autor: Courtesy to Juan R. Lazaro (Flickr 8. Jan. 2007)
Lizenz: CC
BY 2.0 |
Vom
Bauprogramm König Teti II. ist kaum etwas erhalten. Seine Pyramide in Saqqara
ist ziemlich verfallen - genau wie die drei Nebenpyramiden für die
Königinnen. Das einzige bekannte Abbild des Königs ist die Standfigur, die
von James Edward Quibell während der Grabungskampagne 1906/07 etwas östlich
der Teti-Pyramide in der Verfüllung eines Grabschachtes gefunden wurde (siehe
weiter oben).
| Bubastis / Tell Basta / Per Bastet |
In Bubastis/Tell Basta, etwa 250 m nördlich des
dortigen Bastettempels aus der Zeit von Osorkon II. - im Nordteil des
Grabungsareals (im Schnittpunkt der Schari Mustafa Kamil und der Schari
Bilbeis) fand man die Reste eines sog. "Ka-Hauses" von König Teti.
Die
Siedlungstätigkeit in Bubastis begann auf dem "Westkorn", auf dem
sich frühdynastische Friedhöfe befinden. Der westliche "Kom" blieb
auch während des Alten Reiches das Zentrum der Siedlung, als dort in der 4.
Dynastie ein Gouverneurspalast und in der 6. Dynastie zwei Tempel für die
Verehrung der königlichen Ka der Herrscher Teti II. und Pepi I. errichtet
wurden. Die Anlage von Pepi I. ist die besser erhaltene. Königliche
Ka-Anlagen aus dem Alten Reich sind aus den Inschriften gut bekannt.
Der
andere Ka-Tempel gehört König Teti 1. Dessen 4 m dicke Umfassungsmauer aus
Schlammziegeln war etwa 112 x 56 m groß, der eigentliche Tempel ist aber nur
noch schlecht erhalten (siehe Ahmad El-Sawi: Excavations at Tell Basta, Prag
1979, S. 75-76). Teti leitete mit seinem Bau eine neue richtungsweisende
Entwicklung ein, als er ein "Hut-Ka" getrennt von seiner Grabanlage
in Saqqara hier beim Tempel der Göttin Bastet errichten ließ. Die Baureste
der Anlage von König Teti sind die ältesten noch "in situ"
(vor Ort) feststellbaren Kultbauten
|
Plan von Bubastis mit Ka-Häusern von Teti II.
und Pepi I. |
| Bubastis befindet sich im
südl. Teil des östlichen Nildeltas. Am südöstlichen Rand der
modernen Stadt Zagazig (Hauptstadt der Provinz Sharkiys) befinden sich
die Überreste der Stadt. Das Gelände der antiken Siedlung wird im
arabischen als "Tell Basta" bezeichnet (Ruinenhügel in
Verbindung mit der Göttin Bastet, deren Hauptkultort Busiris ist).
Ausgräber in Bubastis war Edouard
Naville, der seit 1887 dort gegraben hatte. Aber auch Günter Roeder
(1929) und Labib Habachi gruben später in Bubastis. Ahmed El-Sawi,
der im Nordwestteil des antiken Siedlungsgebietes - dieses Gebiet ist
heute durch moderne Bebauung überdeckt - grub entdeckte 1967-1971 die
Reste einer Ka-Anlage von König Teti. Nordwestlich dieses Bauwerkes
entdeckte er die Reste eines Katzenfriedhofes.
Die Universität Zagazig unter Leitung von
Mohamed Bakr erforschte dann ab 1978 Gräber aus dem Alten Reich in
der nordwestlich gelegenen Nekropole.
Die größte erhaltene Anlage des antiken
Bubastis war der Tempel der Göttin Bastet, der sich heute als großes
Trümmerfeld präsentiert, da der Tempel nach einem Erdbeben um die
Zeitenwende herum eingestürzt war. Dieser Tempel wurde von Edouard
Naville freigelegt. Das Erscheinungsbild dieser Anlage geht auf die
Bautätigkeit von Osorkon I., Osorkon II: und Nektanebos II. zurück |
Plan nach E. R. Lange / D.
Rosenow , der demotische u. hierogl. Text des Kanopus Dekrets von Tell
Basta, Archiv für Papyrusforschung 51.1, 2005
- modifiziert von Nefershapiland - |
Im
Dezember des Jahres 1972 wurde in Heliopolis von einer ägyptischen
Grabungsmission unter Leitung von Muttawi Balbush (dem damaligen Oberinspektor
der ägyptischen Altertümerverwaltung) ein überraschender Zufallsfund
gemacht. Als Muttawi Balbush Untersuchungen in der Gegend
des einen noch stehenden Obelisken von Sesostris I. in Heliopolis vornahm,
stieß er auf zwei große Quarzitblöcke, die beide den Namen von König Teti
trugen.
Einer
dieser Blöcke war ein Türsturz, der andere der obere Teil eines ehemals etwa
3 m hohen Obeliskeh, der nur noch auf einer der Schaftseite zwei der Namen des
Königs trug" "Horus Sehetep-taui, König von Ober- und
Unterägypten, Sohn des Re, Teti". Weitere Inschriften und Namen des
Königs sind heute leider nicht mehr vorhanden. Der Türsturz muss einst zu
einer von Teti in Heliopolis erbauten Kapelle gehört haben, das
Obeliskenfragment aber zu einem Obeliskenpaar, das vor dieser Kapelle
aufgestellt war (Quelle: Labib Habachi: die unsterblichen Obelisken Ägyptens,
Verlag Philipp v. Zabern, Mainz 1982).
| Umzeichnung des oberen Teils eines einst 3 m hohen
Obelisken von Teti |
Fragment (oberer Teil) des Teti-Obelisken -
Ostseite
(Höhe ca. 1 m) - Freilichtmuseum Matariya
|
| Der Obelisk von König Teti aus der 6.
Dynastie gilt als einer der ältesten pharaonischen Obelisken mit einem
vierseitigen geometrischen Design und einer Pyramidenspitze, der in der
Sonnenstadt Heliopolis aufgestellt wurde. |
|
Zeichnung: aus Habachi: die unsterbl. Obelisken
Ägyptens 1982
- modifiziert von Nefershapiland - |
Bild: Courtesy to Friedrich Graf
- alle Rechte vorbehalten - |
Das unten gezeigte Objekt befindet sich heute im
Metropolitan Museum of Art (MET) in New York und stammt möglicherweise aus
der Region Memphis (Mit-Rahina). Es ist ein Geschenk aus dem Kauf von Edward
S. Harness aus dem Jahr 1926. Trotz seines ungewöhnlichen Materials könnte
dieses Sistrum tatsächlich benutzt worden sein, denn an seiner Basis befinden
sich Löcher für kleine Kupferstäbe, die mit klirrenden Scheiben
ausgestattet sind. Die Stäbe sind zusammen mit einer der
Wände, die einen Resonanzkörper bildeten, heute verschwunden, aber ihre
frühere Anwesenheit wird durch Spuren von Grünspan bezeugt.
Das Sistrum ist eine Art von musikalischer Rassel und
wurde im Takt geschüttelt und gab so den Rhythmus bei religiösen Zeremonien
vor. "Das Schütteln des Papyrus" wehrte die Gewalt von
gefährlichen Gottheiten ab, insbesondere der Göttin Hathor, die sich lt.
Überlieferung in eine furchteinflössende Löwin verwandeln konnte. In der
vertikalen Inschrift auf dem Sistrum erscheint sie als junge Frau mit zwei
Kuhhörnern, auf denen die Sonnenscheibe ruht. (Quelle: Online-Katalog MET).
|

|
Sistrum beschriftet mit dem
Namen von Teti
Inv. Nr. 26.7.1450 - Egyptian Alabaster
- H: 26,5 x 7 x 2,7 cm - evtl. aus Memphis Der
geschnitzte Griff dieses Objekt scheint einem Papyrusstiel
nachempfunden zu sein, gekrönt von einer Dolde, die einen kleinen
Naos (Schrein) trägt, überragt von einem Hohlkehlengesims. Ein Falke
sitzt auf dem Dach des Naos - vor ihm eine sich aufbäumende
Kobra. Dieses ist
ein königliches Objekt, wie die Inschriften mit dem Namen König
Tetis belegen. Auf der Vorderseite des Naos erscheinen die fünf Namen
des Königs, umrahmt vom Zeichen von der Himmelshieroglyphe, gestützt
von zwei Was-Zeptern. Eine
lange vertikale Inschrift verläuft den Griff hinunter:
"König von Ober- u. Unterägypten, Sohn des Re, Teti, Geliebter
von Hathor, Herrin von Dendara, möge er ewig leben". |
| Bild:
MET-Museum
of Art
Lizenz: - Public domain CC0 1.0 Verzicht auf das Copyright
|
Von rechts: Eigenname:
"Der König von Ober- und Unterägypten, Sohn des Re, Teti;
Mitte: Horusname: " shtp-tA.wj"
(Sehotep-taui) = Der die beiden
Länder zufriedenstellt - (nach Schneider L.d.Ph.)
Links: Nebti-Name: "shtp-nb.tj"
(Sehotep-nebti = Der die beiden
Herrinnen zufriedenstellt.
Goldname: "Bjk-nbw-smA"
(Bik-nebu-sema) = Der Goldfalke,
der Vereiniger" (nach Schneider)
Als letzte Zeile unten (auf dem Bild nicht graphisch nicht ganz
richtig dargestellt - es ist eine zusammenhängende Zeile) - die
Segensformel:
"Beschenkt mit Herrschaft, Leben, Dauer in Ewigkeit (für alle
Zeiten)". |
|
Umzeichnung: Johann Pirzer für Nefershapiland
- alle Rechte vorbehalten - |
Geht man in Elkab weiter
ins Wade Hilal (Wadi Hellal) - vorbei an der Kapelle der Gottheiten
Re-Harachte, Hathor, Amun, Thot und Nechbet (das von den Einheimischen "el-Hammman"
(das Bad) genannt wird - hinein, passiert man nach einiger Zeit einen sehr
markanten Felsen, der aus dem Sand herausragt und den Namen
"Geierfelsen" trägt (in Anlehnung an die Geiergöttin Nechbet). Der
Felsen ist übersät mit Felsinschriften sowie historischen und
prähistorischen Graffitis. Hinter dem Nechbet-Tempel aus der Zeit von
Amenhotep III./Thutmosis IV, der ungefähr fünf Kilometer von der Strasse
entfernt steht, befinden sich weiter oben im Tal an einem Felsen eine
größere Anzahl Felsinschriften aus der 6. Dynastie - auch welche aus der
Zeit von König Teti.
|
Felsinschrift aus der Zeit
König Teti
im Wadi Hilál in Elkab
Bild: Courtesy to Kairoinfo4U
- alle Rechte vorbehalten - |
|
Felsinschrift aus der Zeit
König Teti
im Wadi Hilál in Elkab
Die Kartusche von König Teti befindet
sich rechts im Bild (oben und unten)
Bild: Courtesy to Kairoinfo4U
- alle Rechte vorbehalten - |
|
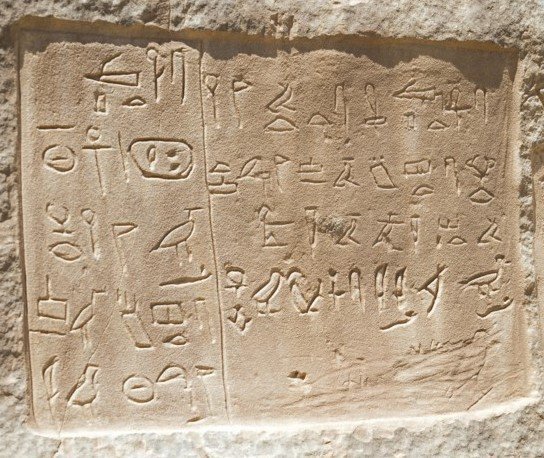
|
Felsinschrift aus der Zeit
König Teti
im Wadi Hilál in Elkab
Die Kartusche König Tetis befindet sich im linken
Teil der Felsinschrift.
Bild: Courtesy to Kairoinfo4U
- alle Rechte vorbehalten - |
|

|
Felsinschrift aus der Zeit
König Teti
im Wadi Hilál in Elkab |
|
Bild: Courtesy to Kairoinfo4U
- alle Rechte vorbehalten -
|
In Edfu wurde ein Alabaster-Gefäß aus der Zeit von König Teti
gefunden, dass sich heute im Nationalmuseum Kairo (JE 6689) befindet. Es zeigt
um die Öffnung herum ein Inschriftenband mit dem hieroglyphischen Text: "Lebender
Horus, der die Beiden Länder zufrieden stellt, König von Ober- und Unterägypten
(Sohn des Re, Teti)|, beschenkt mit Leben, Dauer und Herrschaft ewiglich “
Auf dem Gefäßkörper befindet
sich ein Falke mit ausgebreiteten Schwingen, der in seinen Fängen Sen–Ringe
mit Anchzeichen hält, in denen ein Zepter steckt. Am Gefäßboden befindet sich
eine Lotosblume. Wie bei einem ähnlichen Gefäß aus der Zeit König Unas
findet sich auch hier in einem Serech der Horusnamen und der Geburtsname des
Königs in einer Kartusche, sowie der Zusatz „Mit Leben beschenkt ewiglich"
(Quelle: Göttinger Miszellen 249)

Quellen und Literatur
1. Prof.
Hartwig Altenmüller: Bemerkungen zur Gründung der 6. Dynastie 1990 - in
Festschrift zum 70. Geburtstag von Jürgen von Beckerath, S. 1-20
2. dt. und engl. Wikipedia: König Teti
3. Dodson:
Complete Royal Families, Thames & Hudson 2004, p. 70)
4. Wikipedia: Iput I. und Khuit II.
5. ÄAT 46 – „Die Königsmütter im Alten Ägypten" - Silke Roth
6. Jean Phillipe Lauer, Saqqara, Die
Königsgräber von Memphis, Gustav Lübbe-Verlag 1977
| home |
Sitemap |
Pyramide Teti |
Beamte Teti |
Biografie Pepi I. |
![]()