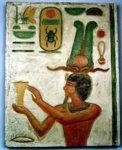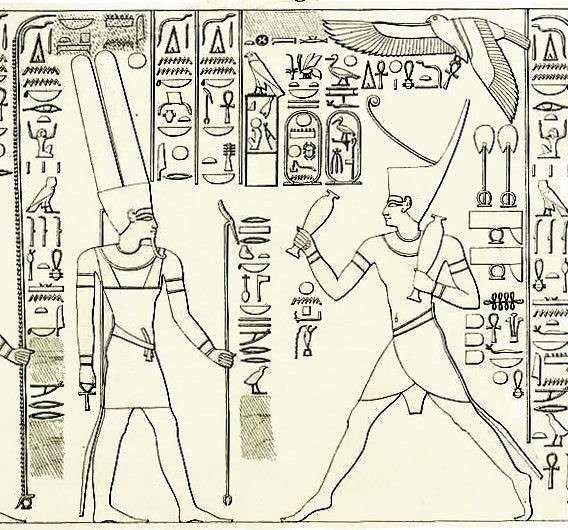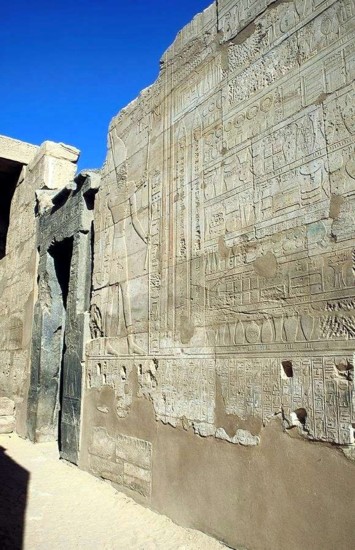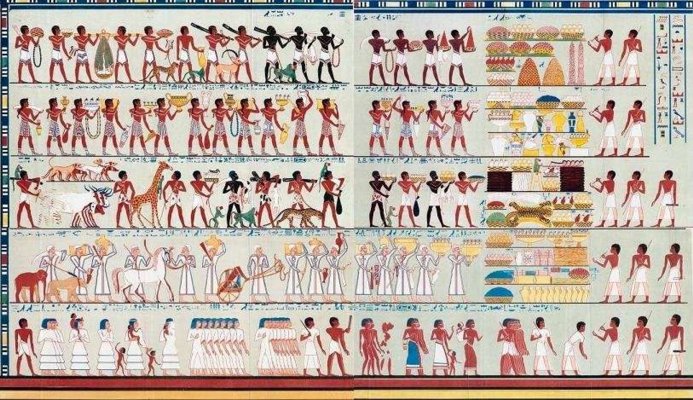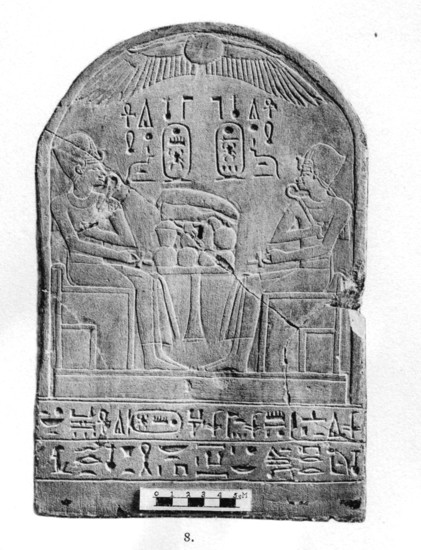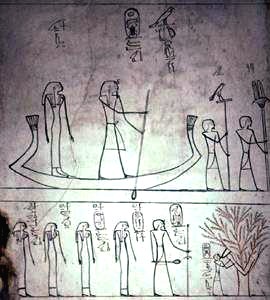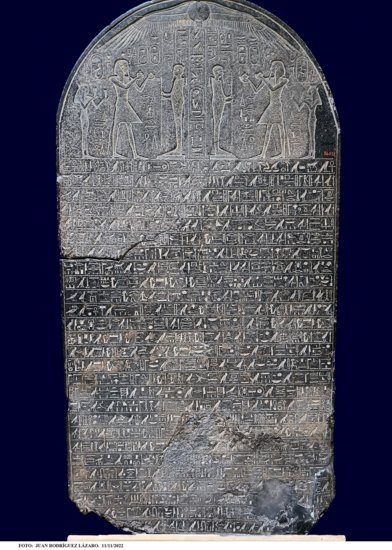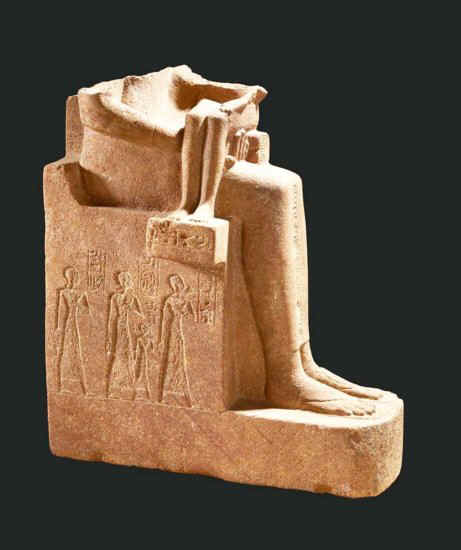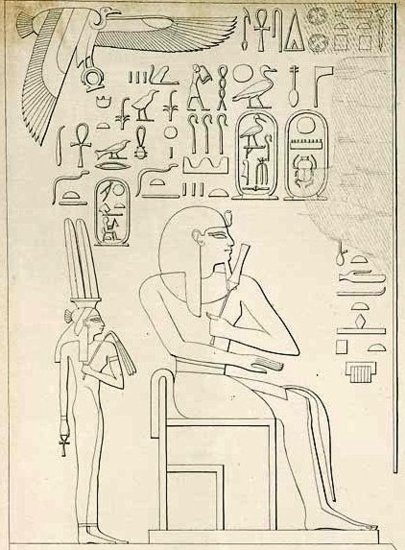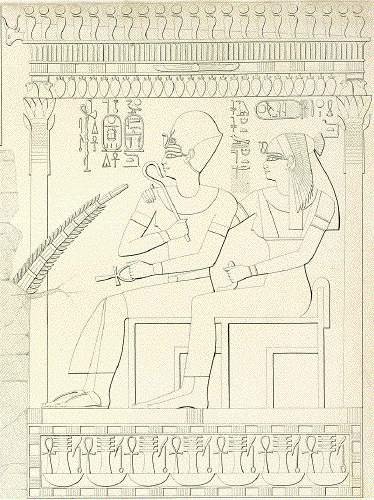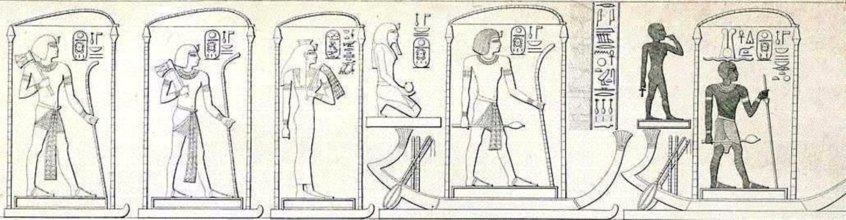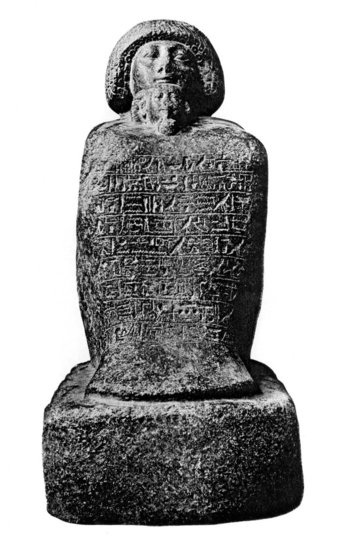Quellen und Literatur-Angaben am Ende dieser Seite -nummerierte Verweise
im Text
PM = Porter Moss, Topographical Bibliography of Ancient Hieroglyphic Text,
Reliefs and paintings 1927-1952
Bilder oben: links Autor unbekannt, Wikipedia, public domain - rechts: Autor:
Husky, Wikipedia, Wien ÄS. 70 / gemeinfrei
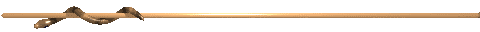
Allgemein:
Thutmosis III. war der 6. König der 18. Dynastie
und bestieg den Thron von Ägypten als Nachfolger seines Vaters Thutmosis II.
mit einer Nebenfrau namens Isis. Hauptgemahlin seines Vaters war die Königin
Hatschepsut. Von seiner Mutter Isis, die offensichtlich nicht aus der
königlichen Familie stammt, sondern wahrscheinlich eine Jugendgespielin war,
die zusammen mit den Kindern seines Großvaters Thutmosis I. am königlichen
Hof aufgewachsen war, ist nur eine einzige Statue aus schwarzem Granit
erhalten geblieben (heute im Ägyptischen Museum Kairo, JE 37417 / CG 42072)
(siehe weiter unten bei Familie).
So stammt Thutmosis III. selber - wie auch
offensichtlich sein Vater und Großvater - auch mütterlicherseits nicht aus
einer königlichen Blutlinie. Da Thutmosis III. offensichtlich bei seiner
Thronbesteigung noch im kindlichen Alter war, führte seine Stiefmutter
Hatschepsut (gleichzeitig auch seine Tante) als Regentin die
Regierungsgeschäfte für ihn. Wie alt Thutmosis III. war, als sein Vater
Thutmosis II. verstarb (Beckerath geht von einer Regentschaft Thutmosis II.
von 12-14 Jahren aus; Grimm und Schoske (1999) dagegen nur von 3 Jahren. Da er
aber - einschließlich der Regentschaft von Hatschepsut - 54 Jahre regierte
und seine Mumie nicht die eines sehr alten Mannes war, kann man davon
ausgehen, dass er wohl ein kleines Kind war, kaum älter als 10 Jahre,
wahrscheinlich eher jünger (2).
| Werdegang des jungen Königs |
Wenn man den Inschriften aus der Zeit
des Königs Glauben schenken mag, erhielt der junge Prinz Thutmosis eine
Ausbildung zum Iunmutef-Priester, ein Amt, das häufig von den Prinzen
ausgeübt wurde und welches im Zusammenhang mit dem Bestattungskult
zusammenhing und wobei das reale Alter der Prinzen keine Rolle gespielt zu
haben scheint. Nach dem Tode seines Vaters Thutmosis II. scheint er wohl -
mangels eines weiteren, älteren männlichen Erbens - trotz seines kindlichen
Alters zum König gekrönt worden zu sein. Über diese Erwähnung (durch
Amun-Re selbst, wie Thutmosis betonte) berichtet der König in seinem 42.
Regierungsjahr:
|
"Amun, mein Vater ist
er, ich bin sein Sohn, er befahl mir, dass ich auf seinen Thron sei,
als ich noch einer war, der in seinem Neste ist. Er erzeugte
mich in der Mitte des Herzens; [ … ] [es ist keine] Lüge; es ist
keine Unwahrheit darin – seitdem ich ein Junge war, als ich noch ein
Säugling war in seinem Tempel und meine Einführung als Priester noch
nicht stattgefunden hatte. [ … ] Ich war in Aussehen und Gestalt
eines Iunmutef–Priesters, wie (da) Horus jung war in Chemmis. [ …
] Re selbst setzte mich ein, ich wurde geschmückt mit [seinen]
Kronen, die auf seinem Haupte warten. Seine Einzige weilte an [meiner
Stirn … Ich wurde versehen] mit allen seinen Vortrefflichkeiten, ich
wurde gesättigt mit den Vorzüglichkeiten der Götter, wie Horus, als
er selbst gefordert hatte, zum Tempel meines Vaters Amunre; ich wurde
versehen mit den Würden des Gottes".
(Inschrift des Thutmosis III. in
Karnak - Kurt Sethe: Urkunden der 18. Dynastie I, Leipzig 1914, S.
75-78)
|
Thutmosis III. war bei seiner
Thronbesteigung offensichtlich noch ein Kind und so übernahm seine
Stiefmutter (und Tante) Hatschepsut für ihn die Regentschaft Dieses war
durchaus im antiken Ägypten üblich, dass die Große königliche Gemahlin des
verstorbenen Königs die Regierungsgeschäfte so lange führte, bis der
eigentliche Thronfolger alt genug war, selbst zu regieren. Im thebanischen
Grab des Baumeisters Ineni gibt es darüber eine Inschrift.
|
„Sein
Sohn trat an seine (des verstorbenen Thutmosis II.) Stelle als König
der Beiden Länder, er herrschte auf dem Thron dessen, der ihn
erzeugt hatte. Seine (Thutmosis II.) Schwester, die Gottesgemahlin
Hatschepsut sorgte für das Land, die beiden Länder lebten nach ihren
Plänen, man diente ihr, indem Ägypten in Demut war; der
vortreffliche Samen des Gottes´, der aus ihm kam, das Vordertau Oberägyptens,
der Landepflock der Südvölker, das vortreffliche Hintertau Unterägyptens
war sie, eine Herrin des Befehlens, deren Pläne vortrefflich waren;
die die Beiden Länder beruhigte, wenn sie redete".
(Quelle:
Georg Steindorff, Kurt Sethe: Urkunden der 18. Dyn. - 1. Teil,
bearbeitet und übersetzt von Kurth Sethe, Leipzig 1914, S. 32 / Urk.
IV. 59-60 PDF - online -)
|
Irgendwann zwischen dem 2. und 7. Regierungsjahr des
legitimen Herrschers Thutmosis III. erklärte sich seine Stiefmutter
Hatschepsut zum gleichberechtigten Herrscher (König) neben ihrem Stiefsohn.
Es handelt sich hierbei um ein absolutes Paradoxum in der ägyptischen
Geschichte, dass zwei Horuskönige über das Reich herrschten und vor allem wo
einer der beiden auch noch eine Frau war. Über das Verhältnis beider
Regenten zueinander wird unter den Gelehrten gestritten. Dass die
Thronbesteigung von Hatschepsut in dem Zeitraum von Jahr 2 bis etwa Jahr 7
erfolgte, wird durch mehrere Funde belegt:
- das letztgenannte Datum Jahr 7 geht auf Funde
in der Nähe bzw. in der Grabstelle der Eltern (Scheich abd el-Qurna) von
Senenmut (Titel: "sab" Ramose und "nebet-per" / Herrin
des Hauses Hatneferet) zurück. Beide wurden etwa vor oder kurz nach dem
Jahr 7 (sein Vater wohl eher, da die Grabausstattung seiner Mutter viel
kostbarer war als die seines Vaters), bestattet. Im Grab, das 1935/36
entdeckt wurde, befanden sich einige Tonkrüge, von denen einer das Datum
"Jahr 7, 2. Monat der Peret-Zeit" trug und einer das Siegel der
"Gottesgemahlin Hatschepsut" mit der Aufschrift "Jahr 7,
Satuwina" trug. Auf zwei weiteren Krügen befand sich das Siegel der
"Guten Göttin Maat-ka-Ra", was bedeutet, dass sie zu diesem
Zeitpunkt schon den Thron von Ägypten bestiegen hatte (2).
- Weiheinschrift im Tempel von Semna - Jahr 2, 2.
Monat des Schomu, Tag 2:
Im Tempel von Semna (Nubien / eine Stiftung von Sesostris III.) befindet
sich eine Weiheinschrift auf der östlichen Außenwand des Tempels, die
häufig als "die letzte Inschrift, in welcher Hatschepsut noch ihre
Titel als Königsgemahlin trägt, aufgeführt wird". Dieses Datum wird
daher als das "früheste Datum, das für eine Thronbesteigung von
Hatschepsut infrage kommt", aufgeführt. Der Text auf der östlichen
Außenwand des Tempels aus dem Jahre 2 enthält die 5 Titel von Thutmosis
III. und die Anweisung an den Vizekönig von Kusch, für die Restaurierung
des Tempels und dass man die Opferrituale für den vergöttlichten König
Sesostris III. wieder aufnehmen solle. Auch auf der westlichen Außenwand
befindet sich eine Dekoration, welche in ihrer Mitte den sitzenden
nubischen Gott Dedwen zeigt, der Thutmosis III. mit der Weißen Krone von
Oberägypten krönt. Die Königin ist hier nicht die zentrale Figur,
sondern sie wird weiter links erwähnt (diese Darstellung hat allerdings
keine Datierung). (2).
|
Relief im Tempel von
Semna - Außenwand West
Die Reste des Tempels befinden sich heute im National Museum
Sudan, Karthum |
| Der thronende Gott Dedun (Dedwen - rechts)
krönt den vor ihm knienden Thutmosis III mit der Weißen Krone.
Hinter dem thronenden Gott steht eine Königin, deren Namen vor
ihr gelöscht wurde (siehe Dorman 1988). Ihre Stellung in Bezug
auf Thutmosis III. ist hier eindeutig - es muss ein Zeitpunkt
sein, wo sie noch als Regentin für ihn untergeordnete war. Bei
der Königin kann es sich eigentlich nur um Hatschepsut handeln. |
Bild: Relief
in the Semna-temple
Autor: Hans Birger Nilsen, Wikipedia
2017
Lizenz: CC
BY-SA 2.0 |
- Die Einsetzung des Wesir User-Amun -
beschrieben in seinem 2. Grab TT 131:
User-Amun wurde im "Jahre 5, 1. Monat der Achet-Jahreszeit, Tag
1" als "Stab des Alters" für seinen Vater Ahmose-Amethu in
das Amt des Wesirs eingesetzt. Dieses Ereignis wurde in seinem Grab TT 131
beschrieben (aber auch auf dem Papyrus Turin 1978). Lt. Wolfgang Helck
(die Berufung des Wesirs User, Ägyptologische Studien, Nr. 29, 1955)
beschreiben beide den gleichen Vorgang, wobei das Papyrusfragment aber
auch ein Datum für diesen Vorgang nennt, nämlich "Jahr 5, 1. Monat
der Achet-Jahreszeit, Tag 1". Beide Texte belegen, dass dieser
Vorgang der Einsetzung in das Amt des Wesirs durch Thutmosis III. erfolgte
(und nicht durch die Königin Hatschepsut). Es ist also anzunehmen, dass
zu diesem Zeitpunkt Hatschepsut noch Regentin war (obwohl sie sicherlich
im Hintergrund "die Fäden zog"), die offizielle Einsetzung in
das Amt als Wesir des User-Amun also immer noch im Namen des
rechtmäßigen Herrschers Thutmosis III. erfolgte und Hatschepsut noch
nicht den Thron Ägyptens bestiegen hatte (2).
In der Ägyptologie wird das
"Zurückdrängen" des eigentlichen Thronfolgers Thutmosis III. durch
seine Stiefmutter Hatschepsut unterschiedlich interpretiert. Einige sehen
Hatschepsut als "skrupelose, ehrgeizige" Frau, deren einziges
Streben darin bestand, die Macht über Ägypten an sich zu reißen und dabei
den jungen Thutmosis in den Schatten drängte (1), wobei Susanne Ratié (La
reine-pharaon, Julliard, Paris 1972, S. 246f) sogar Parallelen zu Echnaton
sah, aufgrund einer gewissen Rigorosität, großer Entschlusskraft und einem
hartenäckigen Willen, sich durchzusetzen (1). Andere Ägyptologen, wie
Gabriele Höber-Kamel, sahen keine Zeichen einer Ausgrenzung des jungen
Königs durch seine Stiefmutter und Tante, da sich an vielen Stellen ihres
Totentempels in Deir el Bahari, dessen Bau sie im 5. Regierungsjahr anfing zu
bauen, viele Darstellungen des jungen Thutmosis III. im Königsornat und mit
verschiedenen Kronen bei der Durchführung von Opferhandlungen, fanden (1).
Dieses ermöglichte dem jungen König, in das Amt hineinzuwachsen und
Erfahrungen zu sammeln.
Nach Tyldesley (1996) stieg der "Horus
Maat-ka-Ra Hatschepsut" nach 22 Jahren und 6 Monaten zum Himmel empor.
Auch Manetho billigte in seiner "Geschichte Ägyptens" einer
Königin "Amesses" (wobei es sich wohl um Hatschepsut handelte), die
ihm als 4. Herrscher der 18. Dynastie bekannt war, eine Regierungszeit von 21
Jahren und 9 Monaten zu. Thutmosis III. änderte daraufhin seinen Thronnamen
von "Men-cheper-ka-Ra (Dauerhaft sind Erscheinungen und Ka des Ra) in
"Men-cheper-Ra" (Dauerhaft ist die Erscheinung des Ra) (nach
Schneider, Lexikon der Pharaonen). Wir können auch davon ausgehen, dass
Thutmosis III. seiner Pflicht nachkam und seine Vorgängerin Hatschepsut
standesgemäß bestatten ließ.
Unter den Gelehrten ist es aber auch unstrittig,
dass Thutmosis III. irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt das Andenken von
Hatschepsut verfolgen ließ. Ihre Darstellungen und Kartuschen wurden
ausgehackt, ihre Obelisken in Karnak eingemauert und ihre Statuen zerschlagen.
Zeitpunkt und Gründe dieser Verfolgung sind in der Wissenschaft
umstritten.
Wichtigster Beleg für eine mögliche
Datierung dieser "Damnatio memoriae" ist die Rote Kapelle in Karnak. Da der Bau
beim Tode von Hatschepsut noch unvollendet war, führte ihn Thutmosis III. in
seinem Namen zu Ende. Da eine fragmentarische Inschrift im Karnaktempel, die
wohl aus dem 42 Regierungsjahr Thutmosis III. stammt, die Rote Kapelle erwähnt,
kann dies als frühestmöglicher Zeitpunkt eine Verfolgung angesehen werden.
Kurz darauf muss Thutmosis III.
die Rote Kapelle durch einen Neubau aus Granit ersetzt haben, ein damals
durchaus üblicher Vorgang. Der Abbau wurde mit äußerster Sorgfalt abgebaut.
Dormann bemerkt, dass auf diesen Blöcken die Namen und Darstellungen der
Hatschepsut ausgemeißelt wurden, jedoch ist unbestimmt wann dies geschah.
Besonders König Amenophis III. verwendete dann diese Blöcke als Fundament für
seinen 3. Pylon in Karnak (1).
Die Länge der Herrschaft von
Thutmosis III. ist heute dank der Informationen, die man im Grab des
Militärkommandanten Amenemheb Mahu gefunden hatte, bekannt. Dieser nannte in
seiner Grabinschrift als Todesjahr seines Königs Thutmosis III. dessen 54.
Regierungsjahr, Tag 30 des 3. Monats der Peret-Jahreszeit (siehe James Henry
Breasted, Ancient Records of Egypt, Bd. II., S. 234, Oriental Institut
Chicago, 1906). Der Tag der Thronbesteigung von Thutmosis III. war der Tag 4,
der 1. Schemu-Jahreszeit. Das würde bedeuten (unter Annahme der konventionalen Chronologie - in akademischen Kreisen anerkannt seit 1960),
dass seine Herrschaft nach der modernen Zeitrechnung vom 28. April 1479 v.
Chr. bis zum 11. März 1425 v. Chr. dauerte (Quelle: Jürgen v. Beckerrath,
Chronologie des Pharaonischen Ägyptens, Mainz, Ph. v. Zabern-Verlag 1997, S.
189)
|
Familien- und
Regierungs-Daten von Thutmosis III.
|
|
Regierungszeit:
Neues Reich - Dynastie 18
|
1479
- 1425 v. Chr. (nach moderner Zeitrechnung |
(1)
54 Jahre |
| Vorgänger: |
Thutmosis
II. / Hatschepsut (D) |
|
| Mutter: |
Iset
(A) |
|
| Vater: |
Thutmosis
II. |
|
| Geschwister: |
Nefer-ru-re
(Halbschwester) |
|
| Ehefrauen: |
Satiah
(als Hauptgemahlin / Gr. königliche Gemahlin)
Hatschepsut-Meryet-Re (Große königliche Gemahlin
Nebtu,
Menwi, Merti, Menhet
Nebsemi |
1) nach Gabriele Höber-Kamel: Thutmosis III. Leben und Werk in
Kemet, Bd. 10, Nr. 3, Berlin 2001
2) Dodson, Families |
| Kinder: |
Amenemhat
(B), Amenhotep II., Beketamun, Iset (B), Nefertari (B), Sa-Amun
(B), Tija, Mencheper-re (A), Meritamun (C), Meryamun (D),
Nebetiunet (B), |
nach
Dodson, Families |
Thutmosis
III. trug während seiner Herrschaft
verschiedene Titulaturen, wobei aufgrund seines kindlichen Alters bei seiner
Thronbesteigung ihm Tempelbeamte oder sogar seine Stiefmutter Hatschepsut bei
der Auswahl halfen - auch wenn er später lt. Inschriften darauf bestand, dass
der Gott Amun-Re diese für ihn auswählte. Wie auch andere Könige der 18.
Dynastie es schon taten, übernahm Thutmosis III. Elemente seiner Titel aus
der Titulatur seiner Vorgänger und Könige früherer Zeiten, um die
Kontinuität der Herrscherabfolge zu wahren (1).
Ab dem 22. Jahr seiner Regierung
(nach dem Beginn seiner Alleinherrschaft) fügte er seiner früheren Titulatur
einige neue Elemente hinzu, vielleicht um die neue Zeit zu betonen -
ebenso ließ er neue Epitheta für bestimmte Anlässe verfassen (wie für
Jubiläumsfeste).
|
Namen
Thutmosis III.
|
| Geburtsname: |
_Hwtjmsj(w) |
Djehutimes
(Thot ist geboren) |
| Thronname: |
1)
Mn-xpr(w)-Ra(w)
2)
Mn–xpr–Ra
jwa-Ra
|
1)
Men-cheper-Re (Der von dauernder Gestalt ist der Re (auf Erden)
2)) Mit bleibender Gestalt, ein Re, Erbe des Re (nach Schneider)
(von Jahr 22 an) |
| Horusname: |
1)
KA-nxt xaj-m-WAst
2) Ka-nxt xaj-m-MAat
3) Mrj-Ra qAj-HDt
und andere.... |
1)
Ka-nechet-chaiu-em-Waset (bis zum Jahr 21)
2) Starker Stier, der maatgerecht erscheint ( ab Jahr 22)
3) Geliebt von Re, mit hoher weißer Krone (nach Schneider) ab Jahr
22)
|
| Nebtiname: |
1)
WAH-nsyt
2) WAH-nsyt mj-Ra-m-pt |
1)
Wah-nesit (Mit beständigem Königstum) (bis Jahr 22)
2) Mit beständigen Königstum, wie Re im Himmel (nach Höber-Kamel |
| Goldname |
1)
+sr-xaw
2) Dsr-xaw sxm-pHtj |
1)
Djeser-chau (Mit heiligen Erscheinungen) - bis Jahr 22
2) Mit heiligen Erscheinungen und mächtiger Kraft (nach
Schneider)
|
Obwohl in den ersten
Regierungsjahren seine Stiefmutter oder die hohen Palastbeamten in Karnak die
Regierungsgeschäfte für den jungen Thutmosis III. führten, sprechen einige
Zeugnisse dafür, dass er in den ersten Regierungsjahren auch offiziell einige
politischen Entscheidungen traf (oder zumindest offiziell dafür
verantwortlich zeichnete). Der früheste Beleg für seine Herrschaft ist eine
Besucherinschrift im Djoserbezirk in Saqqara, die von einem gewissen Ptahhotep
aus dem 7. Monat seiner neuen Regierung stammt. Ptahhotep hebt in dieser
Inschrift die Wohltätigkeit Thutmosis hervor, ohne dass der Name der Regentin
Hatschepsut dort erwähnt wurde (siehe P. F. Dorman: The Early Reign of
Thutmosis III: in Unorthodox Mantle of Coregency).
Ein Befehl aus dem 2. Regierungsjahr
von Thutmosis III. an den Vizekönig von Kusch befindet sich im Tempel von
Semna, der zu Ehren des Gottes Dedwen und des vergöttlichten König Sesostris
III. errichtet war und ordnete an, dass der Tempel neu gebaut werden sollte.
Dieser Befehl befindet sich an der Ostwand des neuerrichteten Tempels, wobei
aber die Frage erlaubt sein muss, ob der damals noch im Kindesalter
befindliche König sich den Bauplan für diesen Tempel selbst ausgedacht
hatte, oder wohl eher von einem der hohen Verwaltungsbeamten, die "hinter
dem König standen" getroffen wurde (wobei natürlich der Entscheid als
"Wille des Königs selbst" deklariert war.
Der Vermögensverwalter
Sennenmut berichtete, dass ihm der König auftrug, eine Stiftung für den
Amun-Tempel in Karnak durchzuführen. In dem Stiftungstext gibt Sennenmut
sogar das Datum für diese Stiftung an: Jahr 4, 1. Schemu-Jahreszeit, Tag 16,
wobei aber die ersten Zeilen unter Echnaton beschädigt und später
nachlässig restauriert wurden und manche Ägyptologen auch schon andere Daten
nennen (siehe Publ.: L.– A. Christope, Karnak–Nord III.
p. 85ff., pl 15; W. Helck, ZÄ 85 (1960). 23 ff. - kleine
Ägyptische Texte / Historisch-Biograf. Texte der II. Zwischenzeit und neue
Texte der 18. Dynastie von Wolfgang Helck, S. 122-126).
In einer weiteren offiziellen
Handlung aus dem 5. Regierungsjahr von Thutmosis III. ernannte er Useramun zum
Wesir, wobei dieser seinen Vater Ahmose Aametja in diesem Amt ersetzte (1).
Diese Handlung wird im Papyrus Turin 1878 überliefert in Form einer
literarischen Darstellung, wobei Thutmosis III. persönlich kam und Useramun
aufgrund seiner vorzüglichen Eignung für das Amt auswählte (siehe Wolfgang
Helck, die Berufung des Wesirs User: in O. Firchow - Ägyptologische Studien,
Berlin 1955, S. 111-115). Eine weitere Darstellung (undatiert) dieses
Ereignisses befindet sich in der autobiografischen Inschrift in Useramuns Grab
in Theben, wobei aber keine dieser beiden Belege zeitgenössisch ist mit dem
Ereignis. Die Grabinschrift wurde eingemeißelt als Useramun seine
Grabvorkehrungen traf (also wohl in der Mitte oder Ende der Regierungszeit von
Thutmosis III. - also nach dem Tod von Hatschepsut) und der Papyrus datiert
noch später - sicherlich nach der 18. Dynastie (1).
*
In der
Verwaltung waren die obersten Beamten des Reiches sehr wichtig. Informationen
und Quellenmaterial erhalten wir aus den Biografien in ihren Beamtengräbern -
insbesondere in Theben-West, wobei der "Königsdienst" eine Vorrangstellung
einnahm, wie aus den Biografien zu entnehmen ist. Der Übergang von der
Herrschaft von der Koregentschaft mit Hatschepsut und für die anschließenden
Alleinregierung von Thutmosis III. war die "neue Beamtenklasse" in
dieser Zeit sehr wichtig. Diese rekrutierte sich zum großen Teil aus den
Veteranen der Asien-Feldzüge, wobei die Männer sich ihre Positionen in der
neuen Verwaltung des Landes durch ihre Treue als Krieger und ergebene Freunde
des Königs erwarben (1).
Der Wesir
(Tjati) war der oberste Beamte im Staat und spätestens unter der Regierung
von Thutmosis III. wurde das Wesirat geteilt. Es gab nun jeweils einen Wesir
für Ober- und Unterägypten (1). Der Wesir Ahmose Aametju amtierte bis zum
Jahr 5 von Thutmosis III. - dann folgte sein Sohn Useramun in dieses Amt und
nach einer langjährigen Amtszeit sein Neffe Rechmire. In den Gräbern der
Wesire Useramun (TT61 und TT 131) und Rechmire (TT100) wurden gute Einblicke
in die Organisation des Wesiramtes gefunden - insbesondere TT61 und TT100
überliefern eines der bedeutendsten Dokumente zur ägyptischen Verwaltung
(die Dienstanweisung für den Wesir), wo die wichtigsten Aufgaben und
Pflichten eines Wesirs in 27 Paragraphen beschrieben wird (lt. Julia Budka:
Hohe Verwaltungsbeamte unter Thutmosis III. / in Kemet, Bd. 10, Nr. 3, Berlin
2001, S. 25f).
Der Wesir "Neferweben"
ist als Wesir für Unterägypten belegt und ist auf zwei Kanopenkrüge
genannt, die aus Saqqara stammen, was vermuten lässt, dass er auch dort
bestattet wurde.
Das Amt des Vizekönigs
von Nubien war das mächtigste Staatsamt neben dem Wesirat, war aber unabhängig
von diesem. Der Vizekönig von Nubien war allein dem König unterstellt.
Bereits unter Thutmosis III. verwaltete
der „Königssohn und Vorsteher der südlichen Fremdländer“ wie der
offizielle Titel des Vizekönigs zu dieser Zeit lautete, auch den südlichen
Teil von Ägypten bis in die Höhe von Elkab. Damit war der Großteil des
Goldabbaus in der Ostwüste einer einzigen Behörde unterstellt (1).
Die Vizekönige waren sich ihrer
außerordentlichen Stellung und Machtfülle bewusst, Selbstsicherheit
spricht aus ihren Inschriften. Nehi,
einer der Vizekönige unter Thutmosis
III., sagt beispielsweise von sich und seinen Aufgaben: "………
Ich bin ein Diener, der wahrhaft nützlich ist für seinen Herrn, der sein
Haus mit Gold füllt, der das Gesicht seines Horus erhellt mit den Abgaben der
südlichen Fremdländer". Gleichzeitig wurde das Amtsgebiet des Vizekönig
von Kusch bis zum Gebiet um El-Kab erweitert, was einen weiteren Machtverlust
von Oberägypten gleichkam. Theben blieb zwar weiterhin das religiöses
Weltzentrum, aber die Hauptstadt wurde nach Memphis verlegt, das bisher nur
Nebenresidenz war, wo allerdings das Hauptquartier des Heeres lag.
Weitere hohe Beamte
in der Verwaltung von Thutmosis III. waren der Schatzmeister, dem die
Verwaltung der königlichen Einkünfte oblag und die Hohepriester des Amun in
Karnak, wobei der HPA Mencheperreseneb einer der höchsten Beamte in der
religiösen Verwaltung unter Thutmosis III. war. Er überwache die Arbeiten
des Königs im Amun-Tempel. Ein weiterer mächtiger Beamter in der religiösen
Verwaltung war der 2. Amunpriester, dem die Inspektion der Werkstätten im
Amun-Tempel und die Überwachung der Tributeinnahmen an den Amun-Tempel
oblagen - wobei als Beispiel der 2. Amun-Priester "Puiem-re"
genannt werden muss, dessen außergewöhnliches Grab in El-Choca (TT39) lag.
Auch die Erzieher
der Königskinder, die sowohl männlich als auch weiblich waren, hatten
in der 18. Dynastie großen Einfluss. Unter Thutmosis III. war einer dieser
Prinzenerzieher ein Mann mit dem Namen "Benber-merut", von dem ein
Würfelhocker (CG 42171) erhalten ist, der ihn zusammen mit Merit-Amun, der
Tochter von Thutmosis III. zeigt. Den Titeln auf diesem Hocker zufolge war
Benber-merut auch Bauleiter und in der königlichen Verwaltung tätig (Julia
Budka: Hohe Verwaltungsbeamte unter Thutmosis III. in Kemet, Bd. 10, Nr. 3,
Berlin 2001, S. 28).
Als letztes sollen
hier die Beamten des Militärs und der Polizei genannt werden, wobei der
berühmteste General dieser Zeit wohl "Djehuti" war. Auch der
"Oberst und Stellvertreter des Heeres" Amenemheb ist durch seine
Autobiografie in seinem Grab TT85 bekannt, wobei er seine hohe Stellung aber
wohl seiner Frau Baki als Amme eines Königskindes am Hofe zu verdanken hatte
(1).
Die Wüstenpolizei
(Medjau oder auch Medjai) bewachte polizeilich und auch militärisch die
Wüste. Sie verfolgte flüchtige Personen in die Wüste und bot den
Expeditionen Schutz gegen Beduinen. Einer dieser Wüstenpolizisten war der
Polizeioberst "Dedi", den wir aus seinem Felsengrab TT200 in
El-Choca kennen. Die Polizeitruppe in Theben-West bestand im übrigen
größtenteils aus Nubiern und schütze auch die Gräber und die
Nekropolenarbeiter im Tal der Könige.
*
Eines der
wichtigsten kultischen Feste für den König war das Sedfest, das der
Herrschafts- und Krafterneuerung des Königs diente. Dieses wurde
üblicherweise nach 30 Regierungsjahre zum erstenmal gefeiert. Ein
"erstes Mal" der Erneuerung unter Thutmosis III. fand in dessen 30.
Regierungsjahr statt und wird auf den Pfeilern seines Tempels in Medinat Habu
erwähnt (siehe Erik Hornung, E. Stahelin: Neue Studien zum Sedfest (Aegyptiaca
Helvetia 1) Genf/Basel 1974, S. 64-65). Während der Sedfeste vollzog der
alternde König Kultläufe, die ein wichtiger Bestandteil des Festes waren und
wo er seine erneuerte Kraft unter Beweis stellte. Er feierte offensichtlich
auch noch ein 3. Sedfest, das auf dem Obelisk aus Heliopolis erwähnt wird
(dieser befindet sich heute in London) (1).
|
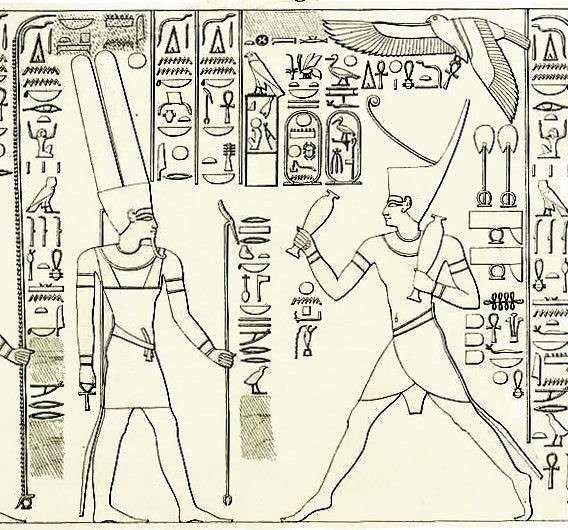
|
Thutmosis III. beim Sedfestlauf
König Thutmosis III. bei einem kultischen Lauf
während des Sedfestes - Darstellung in der Festhalle (Achmenu) im
Karnak-Tempel.
Umzeichnung: Richard Lepsius, 1845, Denkmäler aus
Ägypten und Äthiopien.
- public domain - |
Unter der Alleinregierung von
Thutmosis III. wurde eine zentrale Getreideverwaltung eingerichtet, wodurch es
möglich war, die gesamte Getreideproduktion des Reiches aktenmäßig zu
erfassen und zu kontrollieren (und auch zu verteilen) war (Quelle: Gabriele
Höber-Kamel / Thutmosis III. Leben und Werk eines bedeutenden Königs, in
Kemet. Bd. 10, Nr. 3, Berlin 2001).
Thutmosis III. hatte nach dem Tod von
Hatschepsut die Verwaltung des Reiches umorganisiert (Residenzverlegung nach
Memphis, Teilung des Wesirats - wobei die Wesire jetzt
"Provinzgouverneure" waren. (Quelle: Rolf Gundlach: Das ägyptische
Königtum im Spannungsfeld zwischen Innen- und Außenpolitik im 2. Jahrt. v.
Chr., Harrassowitz-Verlag 2004).
Das Hauptmerkmal der staatlichen und
administrativen Gliederung Ägyptens nach der Verwaltungsreform unter
Thutmosis III. lässt sich nun wie folgt darstellen:
-
auf administrativer Ebene:
die Staatsspitze (der König selber); die obersten Zentralbehörden, die
nachgeordneten Zentralbehörden, die obersten Lokalbehörden und die
nachgeordneten lokalen Behörden. Die administrative Aufgliederung des
Staates ist jetzt: die Landesverwaltung, Tempel/Tempelverwaltung und das
Militär/Militärverwaltung.
-
Ägypten wurde in vier
"Provinzen" gegliedert, wobei der Leiter als oberste
Zentralbehörde unmittelbar dem König unterstellt war:
a) das Vizekönigtum Kusch - das den gesamten nubischen Raum und nun auch
das südliche Oberägypten bis zur Höhe von Elkab umfasste
b) der Zuständigkeitsbereich des Wesirs von Oberägypten (von der Höhe
von Elkab im Süden bis nach Mittelägypten)
c) der Zuständigkeitsbereich des Wesirs von Unterägypten (von
Mittelägypten bis zu den Grenzen des Deltas)
d) Palästina und Syrien mit drei Vorstehern der nördlichen
Fremdländern, welche die Stadtfürsten zu beaufsichtigen hatten und nur
dem König von
Ägypten unterstellt waren.
-
die zentrale Getreideverwaltung,
die getrennt war von den territorial-administrativen obersten
Zentralbehörde. Diese stand unter einem "Vorsteher der Scheunen von
Ober- und Unterägypten.
-
Das Hauptquartier des Militärs
lag in Memphis
-
Im Tempelbereich waren die
obersten Leiter die Hohenpriester. Diese waren die oberste Zentralbehörde
- zumindest soweit es sich hierbei und die großen Tempel des Amun von
Karnak, des Re von Heliopolis und auch des Ptah von Memphis handelte. Sie
standen der Priesterschaft und den einzelnen Tempelverwaltungen vor. Die
Hohenpriester waren meist höhere Beamte, die vom König in dieses Amt
eingesetzt wurden.
-
die Vermögensverwalter: diese
waren für die Versorgung der Haushalte des Königs und der Königsfamilie
zuständig. Diese Versorgung erfolgte ebenso wie auch die Bezahlung der
Verwaltungsbehörden und der Tempel, aus den Erträgen der
landwirtschaftlichen Besitztümer, die den einzelnen Institutionen
zugeteilt waren.
(Quelle: Ägyptens Aufstieg zur Weltmacht, Rolf Gundlach, Phillip v.
Zabern-Verlag, Mainz, und Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim 1987)
Zu Beginn der Herrschaft von
Thutmosis III. / Hatschepsut verlor Ägypten wohl einige wichtige Gebiete in
Vorderasien, die unter der Regierung von Thutmosis I. (dem Vater von
Hatschepsut) erobert worden waren. Auch unter Thutmosis II., dem Vater von
Thutmosis III. hatte Ägypten noch die Vormachtstellung in Vorderasien.
Während der gemeinsamen Regierungsjahre von Hatschepsut und Thutmosis III.
und auch noch während der Zeit von Hatschepsut findet man nur wenige
Erwähnungen über Asien. Vermutlich fielen in dieser Zeit wichtige Gebiete
von Ägypten ab und das Einflussgebiet Ägyptens erstreckte sich, wenn
überhaupt, auf den südlichen Teil Palästinas.
| Feldzüge im
syrisch-palästinensischen Raum |
Im 22. Regierungsjahr von Thutmosis
III. (und Beginn seiner Alleinherrschaft) leitete sein erster Feldzug die
Reihe von fast nun jährlich unternommenen Feldzügen nach Asien ein, wohl
hauptsächlich um den größer werdenden Einfluss des Mitanischen Großreichs
entgegenzuwirken. Diese Ereignisse und weitere Details, wie die Zahl der
gefangenen Feinde und die sonstige Beute wurden in den Annalentexten Tuthmosis
III. im Karnaktempel geschildert, die er in seinem 42. Regierungsjahr
aufzeichnete. Diese Feldzüge wurden auch auf Stelen aus Napata und Armant und
in den Biografien der beteiligten Soldaten geschrieben (1).
|
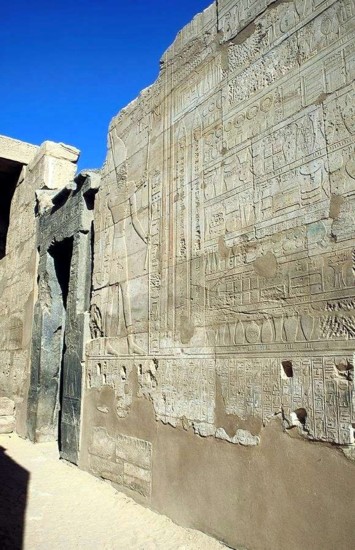
|
Wand des Annalensaals
in welchem Thutmosis III: über die Feldzüge
berichtet.
Die detaillierteste und ausführlichste Inschrift
über den 1. Feldzug von Thutmosis III. im Jahre 22/23 über die
Schlacht von Megiddo befindet sich an der Wand im Karnaktempel.
Insgesamt nahm Thutmosis vor seinem Tod an insgesamt 17 Feldzügen teil.
Die "Annalen" von Thutmosis III. bestehen
aus zahlreichen Inschriften von Militäraufzeichnungen, die von den
Feldzügen seiner Armee im Syrisch-Palästinensischen Raum während
seiner Regierungsjahre 22-46 gesammelt wurden. Während die Berichte
über die "Megiddo-Kampagne" stark ins Detail geht, scheinen
sich die anderen Inschriften mehr auf die Tribute und Kriegsbeute zu
konzentrieren.
Im Laufe der Regierungszeit von Thutmosis III. werden
die Inschriften an der Wand von Karnak immer weniger aussagekräftig.
Der König steht auf dem Relief vor den Opfergaben,
die ihm am Ende seiner Kriegszüge überreicht werden.
Bild: Jon Bodsworth, Wikipedia
- Copyrighted free use - |
Beim 1., 8. und 10. Feldzug handelte
es sich um richtige Feldschlachten, bei den anderen waren es vermutlich kleine
militärische Unternehmungen. Unmittelbar nach dem Tod von Hatschepsut und dem
Beginn seiner Alleinherrschaft über Ober- und Unterägypten organisierte er
einen Feldzug (eine Schlacht, die später allgemein als synonym für die
"entscheidende Schlacht" an sich wurde) gegen
eine Allianz syrischer Fürsten, die sich unter der Führung des Königs von
Kadesch bei Megiddo versammelt hatten. Durch seine ungewöhnliche Taktik - ein
Überraschungsangriff auf das Lager des federführenden Königs von Kadesch,
der seine Truppen weit vom Lager entfernt an anderen, taktischen Orten
aufgestellt hatte, die er für einen Angriff auf die Ägypter für geeignet
hielt - kam der ägyptische Angriff, der bei Sonnenaufgang erfolgte für die
Syrer völlig überraschend. Zwar konnte sich der König von Kadesch mit
seinem kleinen Herr in die nahegelegene Festungsstadt Megiddo retten, da die
ägyptischen Truppen - zum Leidwesen von Thutmosis III. - den Fliehenden nicht
nachsetzten, sondern das Lager des Königs plünderten, aber nach fast 7
Monaten Belagerung gelang es Thutmosis III. schließlich Megiddo einzunehmen.
"Hätte sich das Heer Seiner Majestät nicht damit
abgegeben, die Sachen dieser Feinde zu plündern! [Sie] hätten
Megiddo in diesem Augenblick [eingenommen]. Man zog aber (auch) den
elenden Feind von Kadesch und den elenden Feind dieser Stadt mit Mühe
herauf, um sie in ihre Stadt gelangen zu lassen. Die Furch S. M war
[in ihre Glieder] gefahren, ihre Arme [waren erschlafft], als seine
Stirnschlange über sie Macht gewann. Da erbeutete man ihre Pferde und
ihre Streitwagen von Gold und Silber, gemacht zur Kampfbeute. Ihre
Krieger lagen hingestreckt wie die Fische im Bausch des Netzes, das
siegreiche Herr S. M. aber zählte ihre Habe".
(Annalen des Thutmosis III. - Elke
Blumenthal, Ingeborg Müller, Walter F. Reinecke (Hrsg.): Urkunden der
18. Dynastie, Berlin 1984, S. 194, Urk. IV. 657) |
Die Ägypter erbeuteten 340 Gefangene, 2041 Pferde, 191
Fohlen, 6 Hengste, einige Jungpferde, 2 Streitwagen mit Goldbezug, 922 weitere
Streitwagen, 1 Panzerhemd aus Bronze, 200 Panzerhemden aus Leder, 502 Bogen, 7
Zeltstangen mit Silberbeschlag aus Meria-Holz des Königs von Kadesch, 1.929
Stück Rindvieh, 2000 Ziegen, 20.500 Schafe und 207.300 Sack Weizen des Tales
Jesdraelon (heute Jesreel) (1).
| Jahr |
Militärisches
Ereignis
Tabelle nach Thomas Kühn, Die Feldzüge Thutmosis III.
in (Kemet, Heft 3/2001, S. 16) in (1). |
| 22-23 |
1. Feldzug nach Megiddo |
| 24 (?) |
2. Inspektionsfeldzug nach Palästine |
| 25 (?) |
3. Feldzug nach Retjenu |
| 26 (?) |
4. Feldzug |
| 29 |
5. Feldzug gegen die phönizischen
Küstenstädte |
| 30 |
6. Feldzug gegen Kadesch |
| 31 (?) |
7. Feldzug gegen Ullasa an der
phönizischen Küste |
| 33 (?) |
8. Feldzug gegen Mitanni im nördlichen
Syrien |
| 34 (?) |
9. Feldzug gegen drei Städte in
Nordsyrien |
| 35 |
10. Feldzug gegen Mitanni in Nordsyrien,
Aruna |
| 36 (?) |
11. Feldzug |
| 37 |
12. Feldzug, Gegner und Ziel unbekannt |
| 38 (?) |
13. Feldzug nach Nordsyrien, Gegner nicht
sicher bekannt |
| 39 |
14. Feldzug, gegen Beduinen im Negev |
| 40 |
15. Feldzug, Gegner und Ziel unbekannte |
| 42 |
16. Feldzug, Irqata, Tunip, 3 Orte bei
Qadesch, Mitanni |
Durch die Vernichtung der Gegner im
syrisch-palästinensischem Raum strebte nun das ägyptische Reich eine Art
Hegemonie über Vorderasien an, wobei die eroberten Gebiete als eine Art
"Vasallenstaaten" angesehen wurden. Thutmosis III. legte nun in
einer klugen Außenpolitik die Grundlage für viele Frieden im
syrisch-palästinensischen Raum. Er tötete seine Feinde nicht, sondern ließ
sie teilweise weiterhin in Amt und Würde, zwang sie aber zu Tributen und
jährlichen Steuern. Ein genialer Schachtzug war, dass man die Kinder der
Herrscher als Faustpfand nach Ägypten führte, wo insbesondere die Söhne in
allen Belagen der Staatsführung ausgebildet wurden und so ganz nebenbei zu
"treuen Untertanen des Königs von Ägypzten" wurden. Dieses hatte
zur Folge, wenn ein König der Vasallenländer starb, folgte ihm sein von
Ägypten geschulter Sohn auf dem Thron und erwies sich fortan als
zuverlässiger treuer Verbündeter und Steuerzahler, wobei dadurch
großflächige Pufferzonen entstanden, welche Ägypten in seinen eigentlichen
Grenzen vor Überfällen und Invasionen schützten. Thutmosis III. schuf das
ägyptische Reich mit der größten Ausdehnung aller Zeiten (1).
| Feldzug gegen die Mitanni im
Jahre 33 |
Der Hauptgegner kam nun nicht mehr
aus dem syrisch-palästinensischen Raum, sondern aus dem Reich der Mitanni, so
dass der Höhepunkt unter den Kriegszügen von Thutmosis III. sein 8. Feldzug
(in seinem 33. Regierungsjahr) bis an den Euphrat ins Reich der Mitanni war.
Der Feldzug war bestens vorbereitet. Thutmosis ließ sich von erfahrenen
phönizischen Handwerkern kleinere Schiffe bauen, die sich problemlos
auseinandernehmen und wieder zusammensetzen ließen. Diese wurden auf
Ochsenkarren auf dem Landweg von Byblos an den Euphrat mitgeführt. Dort
wurden wieder zusammengesetzt, um den Fluss zu befahren. Thutmosis III. ließ
am Euphrat eine Stele neben der seines Großvaters Thutmosis I. errichten. Am
westlichen Ufer des Euphrats traf die ägyptische Armee bei der Festung
Karkemis auf das feindliche Herr der Mitanni. Über den Verlauf der Schlacht
ist nichts bekannt, aber die Ägypter gewannen die Oberhand und die Mitanni
flohen ins Hinterland. Danach begnügten sich die Ägypter damit das Grenzland
links und rechts zu durchstreifen und zu plündern.
Es ist überliefert, dass König
Thutmosis III. nach der Schlacht bei Karkemisch an einer Elefantenjagd
teilnahm. Dabei kam es wohl zu einem Zwischenfall, bei dem der König durch
einen Elephanten in ernsthafter Gefahr geriet. Ein Offizier (wohl aus seiner
Leibgarde) namens Amenemheb rühmte sich in seiner Grabbiografie (TT 85), dass
er den König aus einer lebensbedrohlichen Situation rettete, indem er dem
Elephanten den Rüssel abschnitt (Quelle: Thomas Kühn, Ägyptens Aufstieg zur
Weltmacht. Die Feldzüge Thutmosis III - in Kemet, Bd. 10, Nr. 3, Berlin 2001,
S. 22-23).
| Feldzug gegen die Mitanni im
Jahre 35 |
In dem 35. Jahr seiner
Regierung wurde Ägypten erneut von einer Armee aus dem Reich der Mitanni
bedroht und Thutmosis III. setzte sich umgehend an die Spitze seiner Armee und
stellte sich dem Gegner entgegen. Die Annalentexte sind dazu leider teilweise
stark zerstört, aber das ägyptische Herr traf auf jeden Fall in der Nähe
der syrischen Stadtfestung Aleppo auf die feindlichen Truppen, die unter dem
Oberbefehl des Königs von Mitanni standen. Lt. der Schilderung der Ägypter
kam es wahrscheinlich zu zwei Schlachten, die wohl von den Ägyptern ohne
große Probleme gewonnen wurden. Die gegnerische Armee flüchtete in das
Hinterland und auch diesmal wurden sie nicht von den ägyptischen Truppen
verfolgt, da in den Annalen nichts über einen Vorstoß bis zum Euphrat
berichtet wird. Über die Gründe kann nur spekuliert werden (siehe Thomas
Kühn, Ägyptens Aufstieg zur Weltmacht, die Feldzüge Thutmosis III. in
Kemet, Bd. 10, Nr. 3, Berlin 2001, S. 23)
| Feldzug gegen Nubien im Jahre
50 |
Seinen letzten Feldzug führte
Thutmosis III. in seinem 50. Regierungsjahr. Der Feldzug führte ihn bis zum
4. Katarakt des Nils in Nubien. Schon sein Großvater Thutmosis I. stieß weit
über die festgelegte Südgrenze von Ägypten hinaus und beendete die Existenz
des Königreichs von Kerma (dem ersten bedeutenden eigenständigen nubischen
Königreich). Thutmosis II. und auch Hatschepsut intervenierten ebenfalls
militärisch, um Aufständische niederzuschlagen. Unter Thutmosis III. wurde
dauerhaft über den 4. Katarakt hinaus expandiert und er legte nun das
südliche Ende des Reiches beim Gebel Barkal (Reiner Berg) mit Napata als
Grenzort und Handelsstützpunkt fest (siehe: Michael Höveler-Müller / Am
Anfang war Ägypten. Die Geschichte der pharaonische Hochkultur von der
Frühzeit bis zum Ende des Neuen Reiches, Darmstadt 2005, S. 180ff).
Von diesem Feldzug zeugt eine
Inschrift aus dem 50. Jahr auf der Insel Sehel, die zur Erinnerung an die
Wiedereröffnung des Kanals, der durch den 1. Katarakt führt, errichtet wurde
- als der König von einem siegreichen Feldzug aus Nubien zurückkehrte
(1).
Heute ist es schwierig zu beurteilen,
wieviel Kontrolle Thutmosis wirklich über das Gebiet stromaufwärts des 4.
Katarakts ausüben konnte. Auf der "Gebel-Barkal-Stele", die in das
47. Regierungsjahr von Thutmosis III. datiert, befindet sich eine Inschrift,
dass er die Stadt Napata am Gebel Barkal gegründete, wobei es sich bei der
Inschrift lt. A. Spalinger (Covetous Eyes Soth. in E. H. Cline, D. O'Connor:
Thutmose III. A New Biography, Ann Arbor 2006, S. 355) evtl. um eine
später ausgearbeitete Rede handelt, welche Thutmosis III. vor seinen hohen
Beamten und Leute aus dem Südland hielt.
Lt. Donald B. Redford unternahmen die
Ägypter mindestens vier militärische Interventionen in Nubien während der
Zeit der Koregentschaft von Hatschepsut und Thutmosis III. Eine der wenigen
datierten Inschrift legt einen Nubienfeldzug im 12. Regierungsjahr von
Hatschepsut / Thutmosis III. fest. Dieses Graffito in Tangur-West (zwischen
der Insel Sai und dem 2. Katarakt) nennt Kusch als Haupt-Feind (1).
*
In den 20 Jahren seiner
Alleinherrschaft - nach dem Tod von Hatschepsut - gelang es Thutmosis III.,
die Grenzen seines Reiches auszuweiten - im Norden bis an den Fluss Euphrat
und im Süden bis zum 4. Katarakt. Thomas Schneider zitierte Wolfgang Helck
(2002) als: ".....[....] denjenigen König der 18. Dynastie, der
zielbewusst versucht hat, Ägypten zu einer Weltmacht zu erheben" (Zitat
Ende). Wenn man die seine "Mitherrschaft" während der gemeinsamen
Jahre zusammen mit Hatschepsut und seine Alleinherrschaft danach
zusammenzählt, unternahm Thutmosis III. mindestens 16 Feldzüge, darunter die
berühmte Schlacht von Megiddo.
| Außenwirtschaft und
Diplomatie |
Durch
die aggressive Außenpolitik in der frühen 18. Dynastie wurden neue
Wirtschaftsräume geschaffen. In den Annalen von Thutmosis III. erhalten wir
nicht nur Informationen über seine Feldzüge, sondern auch über den direkten
und indirekten Handel mit Gütern nach Ägypten. In den Inschriften werden
Menschen, Tiere, landwirtschaftliche Güter, Rohstoffe und Artefakte
aufgelistet, die als Tribut, Kriegsbeute oder als Handelsgüter nach Ägypten
geliefert wurden. Die diplomatischen Geschenke bestanden aus Rohstoffe wie
Silber, Lapislazuli und andere Schmucksteine, aber auch Kupfer, Holz, Pferde,
exotische Tiere und Metallgefäße. Die Herkunft der Waren kann nicht immer
genau lokalisiert werden, aber als Lieferanten werden u. a. die Könige von
Hatti, Babylonien, Assyrien, Alalach und Tanaja (das mykenische griechische
Festland oder Teile davon) genannt. Auch Frauen, Kinder und Viehbestände
gelangten von den eroberten Städten als Tribut nach Ägypten.
Für
die Jahre 33 und 38 wurden Handelsexpeditionen nach Punt verzeichnet. Wie aus
den Zeiten bei Hatschepsut kehrten die Schiffe mit Weihrauch und anderen
exotischen Gütern zurück. Diese Art der Außenpolitik und Diplomatie wird
auch in den thebanischen Privatgräbern aus dieser Zeit veranschaulicht. Die
Darstellungen tauchen fast ausschließlich in den Gräbern von hohen Beamten
der ägyptischen Verwaltung auf. Die am besten erhaltenen Beispiele stammen
aus den Grab des Wesirs Rechmire (TT 100) in Scheich Abd el-Qurna. Sie zeigen
Menschen von Punt, die Weihrauch, Edelsteine, Ebenholz, Elfenbein und
Tierfelle bringen; Mykener tragen kunstvolle Metallvasen, Schmuck und Minerale
und Nubier sind mit ihren typischen Produkten ausgestattet: Gold, Ebenholz,
Straußenfedern, Vieh, Tierfelle und wilde Tiere. In einer Beischrift wird
auch erwähnt, dass Frauen und Kinder aus Nubien und Syrien-Palästina als
Beute von den Feldzügen nach Ägypten kamen und als Sklaven dem Amun-Tempel
zugeteilt wurden.
|
Tributszenen und Ausländer-Prozessionen im Grab
des Rechmire (TT 100) - Wesir unter Thutmosis 3. |
| In 5 Registern werden unterschiedliche Darstellungen
gezeigt, in einer Zeit, als das ägyptische Reich sich bis zu seiner
weitesten Ausdehnung erstreckte und auf dem Höhepunkt seines
Wohlstandes war. Vertretungen von Ausländern verschiedenster Herkunft
bringen Geschenke, Tribute und Steuern. Bemerkenswert ist hier der
ethnografische Realismus, d. h. die Darstellung einzelner
Volksgruppen. Auf der rechten Seite der Darstellung sind ägyptische
Schreiber zu sehen, die gewissenhaft die Güter aufschreiben und
zählen. |
|
Bild: George Alexander
Hoskins (1802-1863) Travels in Ethiopia above the 2nd cataract,
London: Longman 1835
- gemeinfrei - |
Einen Bericht über
den Tod von Thutmosis III. und die anschließende Thronbesteigung seines
Sohnes Amenophis II. erhalten wir aus der berühmten Biografie im Grab des
Amenemheb (TT 85) im Scheich Abd el-Qurna.
|
„ Der König, er
vollendete seine Lebenszeit mit vielen schönen Jahren in Stärke,
Macht und Rechtfertigung, beginnend im Jahr 1 bis zum Jahr 54, 3.
Monat der Wachstumszeit, letzter Tag unter der Majestät des Königs
von Ober- und Unterägypten (Mencheperre)|, des
Gerechtfertigten. Er entfernte sich zum Himmel und vereinigte sich mit
Aton. Der Gottesleib gesellte sich zu dem, der íhn schuf. Ganz früh
am Morgen, als die Sonne eben aufging und der Himmel hell geworden
war, da wurde dem König von Ober- und Unterägypten, (Acheperure)|,
der Sohn des Re (Amenophis, Gott und Herrscher von Theben)|, dem Leben
gegeben wurde, der Thron seines Vaters verliehen. Er ließ sich auf
dem Thron nieder und nahm Besitz von seiner Herrschaft “
(E. Blumenthal, I. Müller, W. F. Reineke,
A. Burkhardt: Urkunde der 18. Dynastie, Übersetzungen zu den Heften
5-16, Berlin 1984, S. 313 /Urk. IV. 895f |
Es existiert von Amenophis II.
ein Thronbesteigungsdatum, das darauf hindeutet, dass er bereits vor dem Tod
Thutmosis III. als Mitregent eingesetzt wurde. Neben dem Datum IV. Peret 1 in
der Biografie des Amenemheb nennen die Semna-Stele des Usersatet und der
Papyrus Britisches Museum 10056 als Thronbesteigungsdatum den IV. Achet 1.
Somit stellt sich die Frage, ob der Regierungsantritt von Amenophis II. vor
oder nach dem Tod seines Vaters (III. Peret 30) erfolgte, wobei man ansonsten
annehmen müsste, dass man sonst von einer „königslosen“ Zeit von zwei
Drittel eines Jahres ausgehen müsste. Alan Gardiner interpretiert die vier
Monate zwischen der Thronbesteigung Amenophis II. und den Tod Thutmosis III.
als Länge der Koregenz, obwohl nicht bekannt ist, ob die beiden Ereignisse in
demselben Jahr stattfanden (1).
Die Frage nach der "ersten siegreichen Kampagne" des neuen
Königs liefert uns einen weiteren Anhaltspunkt durch die sog. "Amada-Stele"
Amenophis II., in welcher eine "erste Kampagne" im 3. Jahr von
Amenophis II. und in der sog. "Memphis-Stele" des Königs eine
"erste Kampagne" im Jahre7 von Amenophis III. aufgeführt wird.
Dr. Peter Manuelian schlägt
daher folgende Hypothese vor: Es ist davon auszugehen, dass beide
Kampagnen nicht während der Koregentschaft oder während der Alleinherrschaft
von Amenophis II. datiert werden können, weil diese nicht "beide als
erste" bezeichnet werden können. Somit dürfte Amenophis II. für ein
paar Jahre an der Seite seines Vaters als Mitregent regiert haben.
|
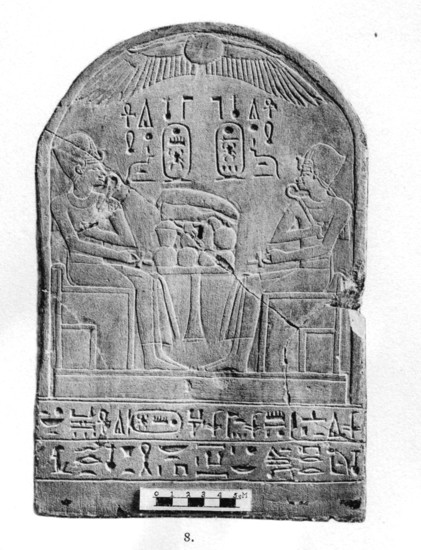
|
Stele Leiden V 11
des Henetnefret mit Darstellung von zwei Königen
Diese Privatstele - heute im Museum
Leiden - zeigt die Könige Thutmosis III. und Amenophis II. - die sich
am Speise-Opfertisch gegenübersitzen. Beide Könige haben im Bildfeld
der Stele den gleichen Statue, dies könnte ein Hinweis auf eine
tatsächliche Mitregentschaft beider Könige sein.
Der Text des Stelenstifters unter dem
Bildfeld besagt aber, dass nur Thutmosis III. zusammen mit Amun-Re in
der Opferformel als Gott angerufen wird.
Bild:
- gemeinfrei
Ancient Egyptian Artist, Boesser - P. A. A. Boeser
- De Munumenten van het Nieuwe Rijk derde afdeeling Seles, Martinus
Nijhoff, 1913, pl. 7. no 8
Rijksmuseum van Oudheden te Leidesn
|
Thutmosis III. gilt zusammen mit
Ramses II. als einer der beiden mächtigsten und berühmtesten Herrscher im
Neuen Reich - einer Zeit, die als Höhepunkt der ägyptischen Macht angesehen
wird.
In späterer Zeit wird Thutmosis
III. "postum" als Gott im privaten Totenkult verehrt. Zur Zeit von
Amenophis III. wird er als vergöttlichter König im Grab des Amenmose (TT 89)
verehrt. Thutmosis III. thront in einem Kiosk und wird vom Grabinhaber
angebetet. Auch im Grab des Nacht (TT 161) erscheint er als vergöttlichter
König auf der linken Seite des Eingangs, während Amenophis I. und der
ebenfalls vergöttlichte Prinz Ahmose Sapier auf der rechten Seite dargestellt
sind. Eine Reihe von Privatstelen aus der Vor-Amarnazeit und aus der
ramessidischen Zeit zeigen ebenfalls den vergöttlichten Thutmosis III.
*
Thutmosis
III. wurde in einem Felsengrab im Tal der Könige in Theben-West bestattet.
Die Arbeiter von Victor Loret (dem damaligen Generaldirektor der ägyptischen
Antikenverwaltung, entdeckten das Grab TT 34 am 12. Febr. 1898. Der Zugang
befand sich am oberen Ende einer engen Felsschlucht. Neben dem leeren
Sarkophag, der die Form einer Kartusche besaß, entdeckte Loret nur wenige
Fragmente von Artefakten, welche von den Grabräubern zurückgelassen wurden -
wie Überreste eines Pavians und eines Stieres, Holzstatuen des Königs sowie
Steinfayence, Glas und Keramikgefäße.
Die Mumie
des Königs wurde 1881 in der Cachette von Deir el-Bahari entdeckt,
eingehüllt in ein Leichentuch mit dem Text der Sonnenlitanei.
Thutmosis III. war der Sohn von König
Thutmosis II. mit einer Nebenfrau, die den Namen "Isis" trug. Die
Große Königliche Gemahlin seines Vaters war dessen Halbschwester Hatschepsut
und die gemeinsame Tochter "Neferure" war somit die Halbschwester
von Thutmosis III. Es gibt unter einigen Ägyptologen die Vermutung, dass
Thutmosis III. seine Halbschwester heiratete, wofür es aber keine
schlüssigen Beweise gibt. Die Große Königliche Gemahlin von Thutmosis III.
war eine Frau mit dem Namen "Satiah". Mehrere andere Ehefrauen von
Thutmosis sind durch erhaltene Aufzeichnungen bekannt. Er heiratete auch
mindestens drei ausländische Frauen (Menwi, Merti und Menhet), die zusammen
begraben wurden. Von einer Säule im Grab des Thutmosis III. wissen wir, dass
er auch mit einer weiteren Frau verheiratet war, die den Namen "Nebtu"
trug. Nach dem Tod von Satia wurde eine Dame mit dem Namen "Meryte-Hatschepsut"
seine Große Königliche Gemahlin und ist uns als Mutter des zukünftigen
Thronfolgers Amenophis II. bekannt.
| Iset
/ Isis (A) |
-
Mutter von König Thutmosis III. -
- Nebenfrau von Thutmosis II. -
Titel:
Hmt-nTr
(n Jmn)=Gottesgemahlin
des Amun
mwt-nsw=Königsmutter
Hmt-nsw=Königsfrau
Hmt-nsw wrt=Große
Königsgemahlin |
| Anmerkungen:
Außer dem Titel "Königsmutter" dürften ihr alle anderen
Titel postum von Thutmosis III. verliehen sein. |
| Quelle:
Dodson, Hilton, Families, Thames & Hudson 2004 |
Isis war eine Nebenfrau des Königs Thutmosis II. -
seine Hauptgemahlin war seine Halbschwester Hatschepsut - und sie war die
Mutter von König Thutmosis III. Die Mutter des Königs Thutmosis III. scheint
nicht aus der königlichen Familie zu stammen, sondern war wahrscheinlich eine
Jugendgespielin von Thutmosis II., die zusammen mit den Kindern von Thutmosis
I. am königlichen Hofe aufgewachsen war. Diese im "königlichen
Frauenhaus" aufgewachsenen Mädchen stammen wohl aus angesehenen Familien
des Reiches und wurden als "Zierde des Königs" bezeichnet.
Nach dem Tode ihres Gatten Thutmosis II. erhielt
Isis während der Regentschaft ihres Sohnes Thutmosis III. nachträglich den
Titel einer "Großen Königlichen Gemahlin (Quelle: Aidan Dodson, Dyan
Hilton, The Complete Royal Families of Ancient Egypt, Thames and Hudson,
London 2004) und den Titel einer "Gottesgemahlin". Diese Titel
befinden sich nur in seinem Totentempel und wurden wohl "posthum"
verliehen. Den Titel einer "Großen Königlichen Gemahlin, kann sie aber
lt. Bettina Schmitz nicht zur Zeit von Thutmosis II. getragen haben, da diese
Stellung Hatschepsut innehatte.
Im Grab des Thutmosis III. (KV 34) befindet sich
eine Darstellung von Isis, die in einem Boot zusammen mit weiteren
Familienangehörigen des Königs steht. In der skizzierten Szene auf einem
Pfeiler ist ein stilisierter Baum zu sehen, der dem König die Brust reicht
mit der Beischrift: "er saugt an (der Brust) seiner Mutter Isis".
Lt. Erik Hornung (Tal der Könige, Die Ruhestätte der Pharaonen, 3. Auflage,
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1985, S. 85) die Mutter von
Thutmosis III. wirklich Isis hieß, könnte man die Szene vordergründig als
Rückkehr des Königs zu seiner Mutter und Verjüngung deuten.
|
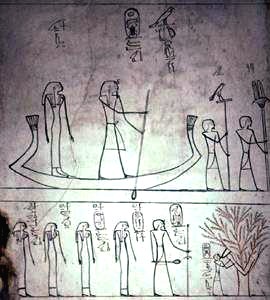
|
Thutmosis III. und seine Familie - Szene aus
KV 34
Auf dem Boot, der König und seine Mutter Isis. Im
II. Register darunter, Thutmosis III. als Kind mit seiner Mutter
(dargestellt als Baum), die ihn säugt. Dahinter, Thutmosis III. an der
Spitze einer Prozession mit seiner Familie: Die Große Königsgemahlin
Meryetre-Hatschepsut, die Große Königsgemahlin Satiah und die
Königsgemahlin Nebtu - gefolgt von der Königs-Tochter Nefertari (B).
Bild: gemeinfrei, Wikipedia 2007
|
Im Ägyptischen Museum Kairo (JE 37417 = CGR
42072) befindet sich die einzige erhaltene Statue der Isis aus schwarzem
Granit. Die Beischrift auf der Sitzstatue aus Kairo lautet: "Der
vollkommene Gott, Herr der Beiden Länder, Men-cheper-Re, geliebt von Amun,
dem Herrn der Throne der Beiden Länder, er machte sein Denkmal für seine
Mutter, die Königsmutter Isis, gerechtfertigt".
|

|
Sitzstatue der Königin Isis
- heute im Museum Kairo JE 37417 = CG
42072 / K 354
Höhe: 98,5 cm
- gefunden in der Cachette von Karnak durch Legrain 1906 -
Die Statue wurde von ihrem Sohn
Thutmosis III. gestiftet. Isis sitzt auf einem Thron. Sie trägt eine
dreiteilige, lange Zopfperücke auf dem Haupt, ein vergoldetes Diadem
und auf der Stirn zwei Uräusschlangen.. Bekleidet ist sie mit einem
engen Kleid und einem "Wesech"-Halskragen. In der Hand hält
sie das Lotus-Zepter. Auf der Vorderseite des Throns ist eine
Widmungsinschrift von Thutmosis III. an seine Mutter Isis zu lesen
(siehe oben).
Bild: Courtesy to Merja Attia,
Finnland
- alle Rechte vorbehalten - |
| Satiah (%At-JaH) |
-
Große
Königliche Gemahlin von Thutmosis III.
- Gottesgemahlin des Amun (postum) -
- evtl. Mutter des 1. Thronfolgers Amenemhat -
Titel:
Hmt-nsw wrt=Große
Königsgemahlin
Hmt-nsw=Königsfrau
Hmt-nTr
(n Jmn)=Gottesgemahlin
des Amun (postum) |
Quelle:
Dodson, Hilton, Families, Thames & Hudson 2004,
Stele Kairo CG 34013 (JE 34642) aus dem Ptah-Tempel in Karnak. |
Satiah (auch
Sat-Iah oder Sitiah) war die erste Hauptgemahlin von Thutmosis III. Ihre
Mutter war eine gewisse "Ipu" (B) - siehe Opfertafel aus dem Bereich
des Osiristempels in Abydos (Quelle: Dodson & Hilton, Royal families, S.
138), der für die Königin Sitiah von einem gewissen "Therikiti"
gestiftet wurde (heute im Museum Kairo JE 23034). Ihre Mutter Ipu hatte das
Amt einer königlichen Amme inne. Möglicherweise war Satiahs Vater Ahmose
Pen-Nechbet, dessen Karriere als Beamter unter Ahmose I. begann und bis
Thutmosis III. ihren weiteren Verlauf nahm (Quelle: dt. Wikipedia Satiah).
Über evtl. Nachkommen aus dieser Ehe zwischen Thutmosis III. und Satiah ist
nichts Genaues bekannt, doch besteht die Möglichkeit, dass Prinz Amenemhat
(B) ihr gemeinsamer Sohn war, der aber noch vor seinem Vater starb (3). Weitere
Kinder aus dieser Ehe waren evtl. eine Tochter mit Namen Nefertari und ein weiterer
Sohn namens Sa-Amun.
Auf der Stele Kairo (CG 34013/JE
34642) ist der Name der Prinzessin Neferu-Re (Tochter von Hatschepsut und
Thutmosis II.) durch den der Satiah ersetzt worden, dabei ließ man aber die
alte Titulatur "Hm.t–nTr"
stehen. Der Grund für diese Namensänderung in der Reliefdarstellung ist
unbekannt, auf jeden Fall gelangte dadurch Satiah "postum" zu ihrem
Titel Gottesgemahlin des Amun, den vor ihr bis zu deren Tod Neferu-Re (Tochter
der Hatschepsut) innehatte. Historisch gesehen, trug Königin Satiah nie den
Titel Gottesgemahlin, sondern nur "posthum" auf der usurpierten
Stele.
Nach Peter Piccione (2003) / The
Women of Thutmosis III. in the Stelae of the Egyptian Museum - online-Version)
wurde diese Stele 3 x überarbeitet, wobei die 1. während der Regierungszeit
von Thutmosis III., die 2. in der Amarna-Zeit und die letzte unter Sethos I.
(der die Amarna-Schäden restaurieren ließ). erfolgte. Die Titulatur der
Königin lautet: "Gottes Frau [Satiah], möge sie leben".
|
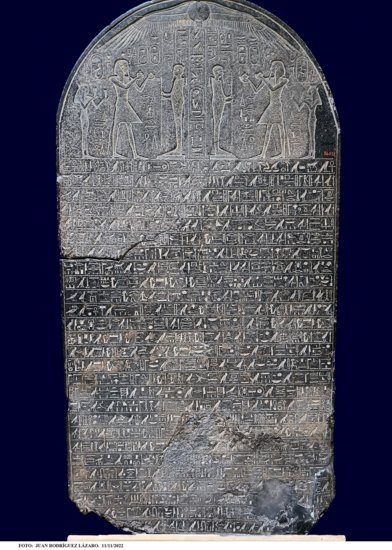
|
Stele Thutmosis III. (Kairo JE 34642/CG 34013)
aus dem Tempel des Ptah - (PM II², 198, 6) H. 1,44 x B. 0,75m
Im Museum Kairo befindet sich eine Stele aus
schwarzem Granit - die von Thutmosis III. im kleinen Tempel von Ptah
errichtet wurde und an den Wiederaufbau und die erneute Widmung des
Tempels an Ptah im Jahre 23 oder 24 des Thutmosis III. erinnert.
Die Stele zeigt in der symmetrisch aufgebauten
Lünette die geflügelte Sonnenscheibe über dem Bild- und dem
darunterliegenden Textfeld und den spiegelbildlich auf beiden Seiten
stehenden König Thutmosis III., der opfernd vor der Statue des Gottes
Ptah steht. In beiden Darstellungen wird Thutmosis III. von der
"Gottesgemahlin Satiah" begleitet, die zwei Gläser Wein
präsentiert. Die beiden Statuen des Ptah sind Rücken-an-Rücken
dargestellt. Zwischen ihnen verläuft ein Restaurationstext von Sethos
I. Unter der Lünette befindet sich ein Widmungstext in 27 Zeilen.
Sehr deutlich sind in der Lünette die Auswirkungen
der Auslöschungen in der Amarnazeit zu sehen, die später unter Sethos
II. fast passgenau ersetzt wurden. Die Inschriften sind noch original.
In der Amarnazeit wurde die Lünette fast vollständig ausgelöscht,
lediglich die geflügelte Sonnenscheibe, große Teile der beiden
weiblichen Figuren, links und rechts und die Areale hinter diesen wurden
nicht angetastet.
(Bild oben: Courtesy Juan
R. Lazaro - alle Rechte vorbehalten)
|
Der Entdecker der Stele,
Legrain, war überzeugt, dass der ursprüngliche Name der Königin hinter
Thutmosis III. nicht "Satiah" lautete, sondern dass dort mehrere
"Nefer"-Zeichen zu erkennen sind, und er daher die Lesung "Neferu-Re"
vorschlug. Da die Stele die Ereignisse aus dem Kriegszug gegen Megiddo im
Regierungsjahr 22-23 von Thutmosis III. beschreibt (Zeile 9 berichtet der
König über seine Rückkehr aus dem ersten siegreichen Feldzug gegen
Palästina im Jahre 23 seiner Regierungszeit, was bedeuten würde, dass die
Stele somit nicht vorher aufgestellt worden sein kann), besteht
lt. Legrain die Möglichkeit, dass Neferu-Re ihre Mutter überlebte, obwohl
man bislang dachte, dass das höchstbekannte Datum für Prinzessin Neferu-Re
das Jahr 11 von Thutmosis III. war (d. h. dass sie noch vor ihrem 16.
Lebensjahr gestorben war).
Die exponierte Stellung der
Großen Königsgemahlin Satiah wird durch ihre überlebensgroße Sitzstatue
aus el-Tod augenfällig. Die Statue stammt wohl aus einem kleinen Heiligtum,
das Thutmosis III. in direkter Nachbarschaft zu dem dort von ihm errichteten
Tempelbau und der ebenfalls von ihm errichteten Barkenstation anlegen
ließ.
Nach Porter & Moss, (Band V,
S. 49) wird auf dem Kopf einer bronzenen Votiv-Axt (?) (jetzt im Museum Kairo
- Nr. unbekannt), die aus Abydos stammt, der Name der Königin Satiah genannt.
Im Tempel von Month in el-Tod wurde eine Statue der Königin Satiah gefunden,
welche Tuthmosis III. nach ihrem Tod dort aufstellen ließ und geweiht hatte.
Die Statue befindet sich lt. Porter & Moss heute im Museum Kairo. Die
Königin sitzt auf einem Blockthron und ist in ein mantelartiges Gewand
gehüllt, das an den Schultern leicht absteht und vorne einen V-artigen
Ausschnitt bildet. Mit ihrer linken, in Höhe der Brust aus dem Mantel
ragenden Hand hält sie ein Wedelszepter - mit der rechten Hand ein
Hetes-Szepter. Über einer mächtigen Volutenperücke, die beide Ohren
freilässt, befindet sich die Geierhaube. Das Gesicht der Statue ist fast
völlig zerstört - ebenso die Füße samt dem vorderen Teil der Basis.
Satiah starb während der
Regierungszeit ihres Gemahls Thutmosis III. (nach dem 33. Regierungsjahr ihres
Gemahls wird sie nicht mehr erwähnt, ebenso ihr Sohn Sa-Amun), der nach ihrem Tod die Tochter der
Priesterin Hui, Meritre-Hatschepsut, heiratete und sie zur neuen Großen
Königlichen Gemahlin erhob.
| Merit-Ra
Hatschepsut (Mr.t Ra HA.t Sps.(w)t |
-
Große
Königliche Gemahlin von Thutmosis III.
- Mutter des Thronfolgers Amenophis II. -
Titel:
Hmt-nsw wrt=Große
Königsgemahlin
irj.t-pat=Erbprinzessin
wr.t-hs.wt-watjt=die
Einzige, Große des Lobes
mwt-njs.wt=Königsmutter
nbt-tA.wy=Herrin
der Beiden Länder
Hmt-nsw=Königsfrau
hmt-nTr-Jmn-m-jmn=Gottesgemahlin
des Amun
(mit der
Erweiterung: djrt-ntr=Gotteshand) |
Quelle:
Dodson, Hilton, Families, Thames & Hudson 2004,
Wikipedia: Meritre-Hatschepsut |
Merit-Ra-Hatschepsut war
die zweite Hauptgemahlin von Thutmosis III. (nach dem Tod von Königin Satiah).
Als Mutter von Merit-Ra-Hatschepsut wird die Priesterin "Hui"
genannt. Im Britischen Museum (BM 1280) befindet sich eine Statue von Huy.
Nach den Inschriften auf der Statue "behauptet" Huy, dass sie eine
Gottesgemahlin und eine Große Königin geboren hätte. Sie selbst war
nicht-königlicher Abstammung. Ihre Titeln lauten der Inschrift nach:
"Gottesverehrerin des Amun" ( dwAt–nTr),
"Große der Haremsdamen des Tempels des
Amun" (wrt–xnrwt
m pr–Jmn)
"Große der Haremsdamen im Tempel des Re"
(wrt–xnrwt
m pr–Ra)
und "Gottesverehrerin im Hause/Tempel des
Atum" (dwAt–nTr
m pr–Jmn).
Sie
hat ein kleines Mädchen (ihre Enkeltochter) auf ihrem Schoß mit der
Beischrift: "Die Königstochter Nebet-Iunet". An der Seite des
Throns befinden sich noch mehr Darstellungen von Kindern: "Der
Königssohn Mencheper-Re (A), die Königstochter Isis (in einem kleineren
Maßstab als die anderen dargestellt), die Königstochter Merit-Amun (Name in
einer Kartusche= und die Königstochter Merit-Amun (Name ohne Kartusche). Der Name des Amun ist ausgekratzt, die Königskinder
gehören also in die Vor–Amarnazeit.
|
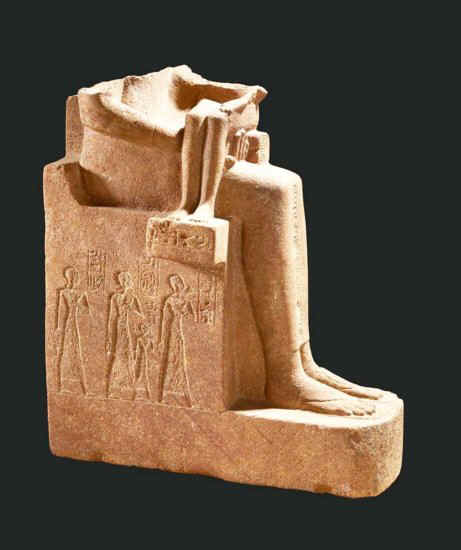
|
Sandsteinstatue
der Königlichen Amme Huy
mit Prinzessin Nebet-Iunet auf ihrem Schoß
EA1280 - Britisches Museum, H. 65 x B. 21 x T 53 cm
Untere Hälfte einer
Sandsteinstatue der Priesterin und Königlichen Amme Huy (Mutter von
Königin Merit-Re-Hatschepsut) - gekauft 1898 bei RJ Moss & Co.
Auf der Vorderseite des Kleides
befindet sich ein eingeschnittener Hieroglyphentext - ebenfalls auf der
linken Seite des Throns sowie vier Kinderdarstellungen auf der anderen
Seite. Auf der Statue wurden die
Namen von fünf Königskindern genannt (Huy
hält eines auf dem Schoß, vier sind an den Seiten des Sitzes
gezeigt). Es werden die Enkelkinder der Huy
von ihrer Tochter sein: Die
Mädchen heißen: Nbt-Jwnt
(Nebet-Iunet),
Ast (Iset),
Mrjt–Jmn
(A) (Meret-Amun), Mrjt–Jmn (B) (Meret-Amun)
in der Kartusche und ein Knabe namens Mn–xpr–Ra
(Men-cheper-Re).
Dem Name der Kinder nach käme
als deren Mutter am ehesten Meritre–Hatschepsut in Frage.
Die Hieroglypheninschrift zu
Huy auf der anderen Seite des Throns lautet: "Oberste
des Harems im Tempel von [Amun], Oberste des Harems von Re,
Gottesanbeterin von [Amun], Gottesanbeterin im Tempel von Atum - sie,
welche die Gottesgemahlin und die Hauptfrau des Königs gebar,
Huy".
Bild: (c) The Trustees of the
British Museum
BY-NC-SA
4.0 |
Meritre-Hatschepsut ist von
zahlreichen Denkmälern bekannt. Sie ist im Toten-Tempel ihres Gemahls
Tutmosis III. in Medinet Habu bezeugt und steht dort hinter dem thronenden
König. Ihr Titel auf der Beischrift lautet hier: "Große Königliche
Gemahlin". Sie ist in vollem königlichen Ornat dargestellt,
einschließlich der Geierkappe (Modius mit der Doppel-Feder) und dem
Fliegenwedel.
|
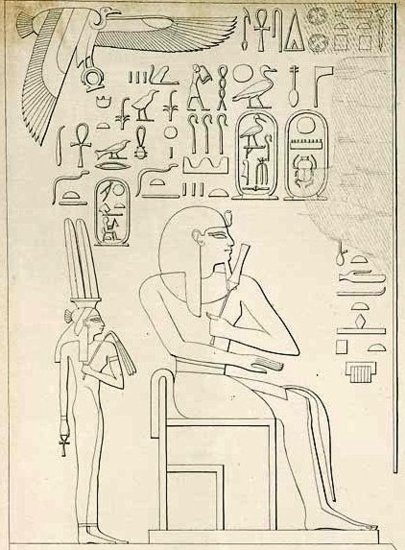
|
Meritre-Hatschepsut
- hinter dem thronenden Thutmosis III. -
Die Königin Meritre-Hatschepsut auf einem Relief hinter dem
thronenden König Thutmosis III. in Medinet Habu
Bild: Lepsius Teil Bd. 8,
Abt. 3, Blatt 62
- gemeinfrei - |
Sie ist auch in mehreren
Gräbern abgebildet, darunter das ihres Mannes Thutmosis III (KV 34). Auf
einer der Säulen ist die als Meritre identifizierte Königin als eine von
drei Königinnen hinter Thutmosis III. dargestellt. Auf Meritre folgen dort
Königin Sitiah, Königin Nebtu und Prinzessin Nefertari (Quelle: Annecke
Bart, Merytre-Hatshepsut-Webseite).
|
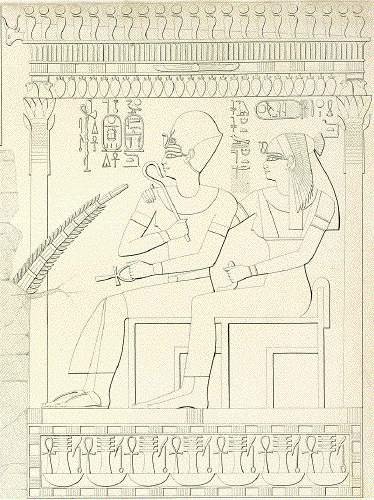
|
Meritre-Hatschepsut
ist auch im Grab des Ra (TT
72) in Theben dargestellt. Sie sitzt neben oder hinter ihrem
Sohn Amenophis II.
Bild: Lepsius Teil Bd. 5,
Abt. 3, Blatt 62
- gemeinfrei - |
In einem anderen Grab in Sheikh Abd el-Qurna scheint eine
Statue von Meritre-Hatschepsut darzustellen, die in einer kleinen Struktur auf
einem Schlitten gezeigt wird. Die anderen abgebildeten Statuen repräsentieren
alle Thutmosis III.
|
Szene von einem Grab in Abd-el-Qurna, Lepsius
Grab 13 |
| Lt. Richard Lepsius scheint
diese Szene aus einem Grab in Abd e-Qurna den Transport einer Statue
der Königin Meritre-Hatschepsut zu zeigen. Die Königin (3. Statue
von links - alle anderen sind Thutmosis III.) trägt einen Modius auf
dem Kopf und den Fliegenwedel in der Hand. |
|
Zeichnung: Lepsius Abt. III, Band 5, Bl. 63
- public domain - |
Viele der Darstellungen von
Meritre-Hatschepsut wurden von ihrer Schwiegertochter Tiaa
wiederverwendet.
Der Ort der Bestattung von
Meritre-Hatschepsut ist unter den Ägyptologen nicht eindeutig belegt.
Ursprünglich sollte Meritre-Hatschepsut wohl in KV 42 beigesetzt werden.
Dieses wurde jedoch für ihr Begräbnis nicht fertiggestellt. Das Grab wurde
evtl. später für die Bestattung des berühmten Bürgermeisters von Theben,
Sennefer, seiner Frau, der königlichen Amme Senetnai sowie für Baket-Re
(welche den Titel "Königsschmuck" trug) benutzt.
Nach Daniel Polz (der Beginn des neuen Reiches, de Gruyter-Verlag Berlin/New
York 2007, S. 217) besteht auch die Möglichkeit, dass man die Räumlichkeiten
lediglich dazu nutzte, hier Begräbnisinstrumente zu lagern. Das 1899 von
Victor Loret und 1900 von Boutros Andraos, Howard Carter u. a. ausgegrabene
Grab wurde bereits in der Antike geplündert. Im Jahre 1921 fand Carter im
Grab Ritualobjekte mit ihrem Namen, die Aussagen über die Bestattung
ermöglichten. Durch Überschwemmungen wurde das Grab schwer beschädigt
(Quelle: KV 42 - Wikipedia).
Vermutlich wurde
Meritre-Hatschepsut in KV 35 (dem Grab ihres Sohnes Amenophis II.) beigesetzt.
Die Mumien aus der Nebenkammer Jb wurden 1902 ins Museum Kairo gebracht. Es
ist möglich, dass die "unbekannte Frau D" in der Nebenkammer Jb die
Königin Meritre-Hatschepsut oder die Königin Tausret.
| Nebtu (Nbtw) |
-
Nebenfrau von Thutmosis III. -
Titel:
Hmt-nsw=Königsfrau
|
Quelle:
Dodson, Hilton, Families, Thames & Hudson 2004,
Wikipedia: Meritre-Hatschepsut |
Nebtu war eine
weitere Gemahlin von Thutmosis III. Sie wurde auf einer Säule in seinem Grab
KV 34 abgebildet, wo der König eine Prozession seiner Familienmitglieder
anführt - seine beiden Großen Königlichen Gemahlinnen Satiah und
Meritre-Hatschepsut, seine Frau Nebtu und seine Tochter Nefertari. Die
Inschrift hinter den Darstellungen von Satiah und Nefertari lautet "maa-cheru"
(was zeigt, dass beide schon verstorben waren, als das Grab errichtet wurde).
Im Gegensatz zu den Namen der beiden anderen Ehefrauen ist Nebtus Name nicht
in einer Kartusche geschrieben (Quelle: Dodson & Hilton, Royal families,
S. 133). Nebtu hatte einen Anwesen, das von ihrem Verwalter Nebamun
bewirtschaftet wurde (dieser besaß ein Grab in Scheich-Abd el-Qurna - TT 24).
| Menwi,
Merti und Menhet |
-
Nebenfrauen von Thutmosis III. -
Titel:
Hmt-nsw=Königsfrau/Königsgemahlin |
| Quelle:
Dodson, Hilton, Families, Thames & Hudson 2004, |
Menwi, Merti und Menhet
(auch: Manhata, Manuwai und Maruta) waren drei (wahrscheinlich minderjährige)
Ehefrauen von Thutmosis III., die evtl. aus Syrien kamen (da die Namen alle in
kanaanäischer Namensform passen - obwohl ihr Ursprung unbekannt ist). Sie
kamen evtl. nach Ägypten im Rahmen eines "diplomatischen Pakets"
zwischen Ägypten und Syrien (als Tribut nach einer erfolgreichen Kampagne?)
und gelangten dann in den Harim von Thutmosis III. (obwohl alle drei den Titel
einer Königsfrau trugen). Eine genaue Datierung ihrer Bestattung ist nicht
möglich - wenn auch manches Ägyptologen der Meinung sind, dass sie bereits
in den Jugendjahren von Thutmosis III. bestattet wurden. Andere
Wissenschaftler, wie Angelika Tulhoff (A. Tulhoff: Thutmosis III. München
1984, S. 221f) vermuten, dass die drei Syrerinnen bereits unter Thutmosis II.
an den ägyptischen Hof gelangten und - entsprechend den allgemeinen
Gepflogenheiten vom Nachfolger Thutmosis III. übernommen wurden (siehe:
Gabriele Höber-Kamel: Thutmosis III. Leben und Werk eines bedeutenden Königs
- in Kemet, Bd. 10, Nr. 3, Berlin 2001, S. 9).
Die drei (evtl. syrischen)
Ehefrauen sind bekannt aus ihrem aufwendig ausgestatteten Felsengrab im Wadi
Gabbanat el-Qurud in der Nähe von Luxor. Jede der drei Frauen trägt den
Titel: "Königsgemahlin" - waren aber wohl alle unbedeutende
Nebenfrauen von Thutmosis III. Es ist auch nicht bekannt, ob diese Frauen
miteinander verwandt waren, da es über ihre Eltern keine Belege gibt. Herbert
Winlock schlug vor, dass die Frauen die Töchter syrischer Herrscher waren und
es wurde vermutet, dass eine dieser Frauen die "Tochter eines
Großen" war, die in den Annalen von Thutmosis III. erwähnt und von ihm
aus Retjenu mitgebracht wurde während seiner Kampagne im Jahre 40.
Ausländische Frauen des Königs
scheinen anders behandelt worden zu sein als Königsfrauen, die aus Ägypten
stammten. Auf jeden Fall werden Menwi, Merti und Menhet nicht im Grab ihres
Gemahls erwähnte, obwohl alle den Titel einer "Königsgemahlin"
trugen. Allerdings scheine alle drei lange vor der Fertigstellung und
Dekoration des Königsgrabes verstorben zu sein. Mindestens eine der Frauen
hatte eine religiöse Position, wie das Gazellenkopfdiadem und das Sistrum
belegen, die im Grab der drei Frauen gefunden wurden (siehe James E. Hoch
2003, Die Namen der ausländischen Frauen in ihrer historischen Zeit / und das
Grab der drei fremden Frauen von Thutmosis III. / Liliquist,Christine 1998.
Eine Übersicht über architektonische Typs, Inhalt und ausländische
Verbindungen).
Obwohl alle drei Frauen aus dem
Ausland stammten, wurden sie in ägyptischer Tradition bestattet. Ihre Mumien
waren mit steinernen Herzamuletten ausgestattet und mit dem Kapitel 30B des
Totenbuches beschriftet. Um ihre Brust und ihren Oberkörper trugen sie alle
drei einen breiten Halskragen mit falkenköpfigen Abschlüssen. Jeder Finger
und jeder Zeh waren mit einer Goldhülse ausgestattet, wie sie auch im Grab
von Tutanchamun gefunden wurden. Alle drei Mumien trugen an ihren Füssen
Sandalen aus Geldblech mit breiten Riemen und Mustern aus Rosetten und Rauten,
welche in die Sohlen eingeritzt waren und sie sollten vermutlich Ledersandalen
imitieren.
Im Grab wurden auch kosmetische
Gegenstände, wie zwei Spiegel mit Griffen in Form eines zusammengesetzten
Hathor-Kopfes und einer Papyrusdolde gefunden. Beide Spiegel haben Griffe aus
Goldfolie über dem (heute zerfallenen) Holz und Spiegel aus Silber. Der
größere Spiegel hat eingelegte Augen, während in den kleineren Details
eingearbeitet waren und er war mit dem Namen von Thutmosis III. beschriftet.
Eine der Frauen besaß anstelle eines Spiegels ein goldenes Sistrum mit einem
Griff mit Hathor-Köpfen und "Querstäben, die klirrten".
Einige der Gegenstände aus
dem Grab waren mit dem Namen Hatschepsut
sowohl als Königsgemahlin als auch als König beschriftet. Auch der Name
Thutmosis III. findet
sich.
|
Goldene Sandalen, Fuß- und Fingerhülsen
- heute im Metropolitan Museum New York -
|
Spiegel mit Handgriff in Form eines Hathor-Emblem
- Metropol. Museum Inv.-Nr. 26.8.97, (1919/1920
- Fletches Fund H. 29,3 x B. (der Scheibe) 14,2 x T. 3cm |
Bild:
At
the Metropol. Mus. of Art, New York, 2017
Bildautor: Mike Peel, Wikipedia 2017
Photograph
by Mike
Peel (www.mikepeel.net).Lizenz:
CC-BY-SA
4.0
Image brightened by M. Pirzer
(CC-BY-SA
4.0 ) |
Bild: Wikipedia, CC0 1.0 (Verzicht auf das Copyright) |
Breiter Halskragen mit Falkenkopfenden
und Halsschmuck
Metropolitan-Museum, New York - Acc.: 26.8.102
Goldblech - H. 19,5cn x B. 32cm x T. 0,12-0,14 mm |
Teil einer Perückenabdeckung als
Kopfbedeckung
- heute im Metropolitanmuseum, New York Nr.: 58.153.2 -
Abmess.: L. vorne 35 cm, Umfang 40,2 cm |
|
Dieser Halskragen mit Falkenkopfenden schmückte die
Brust einer der Mumien der 3 Frauen. |
Diese Perückenabdeckung aus Gold, Karneol, Jaspis, Türkis, farbiger Glasfluss aus
der Grabausstattung der drei Frauen von Thutmosis III. gelangte 1926 ins
Metropolitan Museum. Jede der Rosetten ist zwölfstrahlig. Die hier
gezeigte Rekonstruktion des Metropolitan Museums (aus Originalteilen)
setzt sich aus ungefähr 850 eingelegten Teilen zusammen. Sie sind so
aufgezogen, dass sie eine flexible goldene Kapuze bilden.
Ursprünglich waren die Rosetten mit künstlichen blauen und grünen
Steinen eingelegt, die durch die Feuchtigkeit zu einem weißen Paste
zerfallen sind. Das ursprüngliche Gewicht des Kopfputzes mit Einlagen muss
um die 2kg betragen haben.
Eine
solche Zusammenstellung wurde erstmals 1937 von Herberte E. Winlock
vorgeschlagen und später modifiziert. Nach heutigem Kenntnisstand (lt.
Online-Katalog des Metropolitan-Museums) sind die Verbindungen der
Rosetten mit der Goldscheibe 26.8.117bb und die Verwendung von
Rosettensträngen als Perückenabdeckung aber unsicher. |
| Bild: Wikipedia, Metropolitan Museum CC0
1.0 - public domain |
Bild: Wikipedia - CC0 1.0 - public
domain |
Menhet, Menwi und Merti wurden
im Wadi Gabbanat el-Qurud begraben, das in der frühen 18. Dynastie als
Begräbnisstätte für die königlichen Frrauen und Kinder diente. Ihr Grab
befindet sich in der Nähe des Klippengrabes, das für Hatschepsut bestimmt
war. Ihre Todesursache ist unbekannt - das Wasser, welches im Laufe der
Jahrtausende in das Grab eingedrungen war, hat ihre Särge und Mumien
vollständig zerstört. Herbert Winlock schlug vor, dass die drei Frauen wegen
der unzugänglichen Lage des Grabes evtl. gemeinsam bei einer einzigen
Beerdigung bestattet wurden - was evtl. darauf hindeutet, dass sie alle drei
in einem kurzen Zeitabstand starben (evtl. bei einer Epidemie?). In jüngerer
Zeit sind andere Forscher aber der Meinung, dass die Bestattungen einzeln
vorgenommen worden sein könnten - ihre Grabgegenstände aber alle zur
gleichen Zeit hergestellt wurden.
Das Grab im Wadi Gabbanat el–Qurud
(mit der offiziellen Bezeichnung "Wadi D-Tomb 1"wurde am 7. Aug.
1916 von den Dorfbewohnern der Qurnawi gefunden, als nach starken Regenfällen
dieses enge Tal von Einheimischen nach Grabschächten abgesucht wurde. Ein
Teil des entdeckten Grabschatzes verschwand im Antikenhandel. Manche Gegenstände
wurden während der Beraubung beschädigt; was nicht aus Metall oder Stein war
wie Mumien und alle organischen Stoffe, war durch Feuchtigkeit im Grab zerstört
worden, so auch die Särge (das Grab befand sich unglücklicherweise in einer
Wasserrinne). Was noch Aufschluss über die bestatteten Frauen, ihre
Grabausstattung und die Zusammengehörigkeit der Schmuckstücke hätte geben
können, vernichteten die Plünderer. In aller Heimlichkeit und Eile räumten
sie die Grabkammer aus, um den Schatz so schnell wie möglich an einen
Händler in Luxor zu verkaufen. Zwar tat der Inspektor der Altertümer, Tewfik
Boutros - nachdem ihm Gerüchte über die Plünderung eines neu entdeckten
Grabes zu Ohren kamen - sein Bestes, um die Diebe zu identifizieren und von
den Behörden die Erlaubnis zur Ausgrabung zu erhalten, fand jedoch bei einer
Durchsuchung ihrer Häuser keine Beweise und musste die Anklage fallen lassen.
Am 2. Sept. wurde dann die
Erlaubnis zur Ausgrabung unter der Leitung von Mohammed Chaban erteilt. Kleine
Funde aus Metall, Stein und Schmuck wurden in das Register des Ägyptischen
Museums in Kairo eingetragen. Howard Carter untersuchte von 1916-1917 -
während seiner Arbeit in der näheren Umgebung - den Tal-Abschluss und das
Grab.
Im Okt. 1988 führte das
Metropolitan Museum New York eine erneute Ausgrabung des Grabes und seiner
Umgebung durch, wobei sich die Ausgrabungen auf das Grab, seine Plattform und
den Talkopf darunter konzentrierten. Unter dem Grab - am Kopf des Wadis wurden
große Mengen an Keramik (ungefähr 120 Gefäße) gefunden. Diese Keramik
befand sich wahrscheinlich ursprünglich in der Grabkammer. Beweise für
"moderne" Aktivitäten wurden sowohl auf der Plattform als auch im
Grab selbst gefunden, mit Müll und Graffito aus dem Jahr 1957. Ein kleines,
grob geschnittenes Grubengrab wurde am Kopf des Wadis entdeckt - es enthielt
fragmentarische Stücke von Steingefäßen und Perlen.
Die Särge, von denen Howard
Carter sagte, dass es sich um Reihen von drei ineinander verschachtelten
Särgen handelte, lagen nebeneinander - mit ihren Köpfen an der Südwand. Sie
waren "völlig verrottet durch die Feuchtigkeit". Nur die Gold- und
Steingegenstände hatten überlebt, da das Holz und die Körper der Mumien
aufgrund von Feuchtigkeit "von Wasser, das durch die Klippen oben
sickerte" zerfallen war.
Objekte aus dem Grab tauchten in
den folgenden Jahren auf dem lokalen Antiquitätenmarkt auf. 1917 erschienen
drei Sätze von Baldachingläsern und sieben Steingefäße auf dem
Antikenmarkt, und 1918 erschienen fünf silberne Behälter und Tassen, die
alle aus dem Grab stammten. Howard Carter kaufte etwa zwölf der Stein- und
Silbergefäße, die dann an Ambrose Lansing verkauft wurden. Carter kaufte
auch die drei Sätze von Kanopenkrüge und acht Steingefäße, meist aus
Alabaster, im Auftrag von Lord Carnavon. Herbert Winlock vom Metropolitan
Museum gab an, dass in den Jahren nach der Entdeckung des Grabes fast überall
in der Stadt Luxor Steingefäße aus diesem Grab gekauft werden konnten. Viele
dieser antiken Überreste aus dem Grab befinden sich heute im Metropolitan
Museum in New York und wurde zwischen 1918 und 1922 erworben. Weitere Stücke
wurden zwischen 1957 und 1988 auf dem internationalen Kunstmarkt erworben.
Einige der Stücke, die angeblich aus dem Grab stammen sollten, erwiesen sich
als moderne Fälschungen.
Durch die Fundumstände
wissen wir über die tatsächlichen Inhalt des Grabes nichts, obwohl zeitgenössische
Ägyptologen, die damals in Ägypten weilten (1916), übereinstimmend von drei
unbeschädigten Grabstätten und einer Vielzahl von Grabbeigaben, darunter
viele Alabasterkrüge, berichteten. Bei den offiziellen Ausgrabungen der
Grabstätte im September desselben Jahres fand man nur mehr jene Objekte, die
die Grabräuber als wertlos zurückgelassen hatten. Kostbarkeiten aus diesem
Grab tauchten dann jahrelang auf den Antiquitätenmärkten auf, darunter aber
auch einige Fälschungen. Dem Metropolitan Museum gelang es gegen eine
stattliche Entlohnung über Howard Carter und Lord Carnaven, in den Besitz von
zahlreichen wertvollen Objekten aus diesem Grab zu gelangen.
(Quelle für den Text: engl.
Wikipedia, Menhet, Menwi und Merti CC-BY.SA
3.0)
| Amenophis/Amenhotep
(B) |
-
Sohn von Thutmosis
III. -
- späterer König Amenophis II. -
Titel:
sA-nsw smsw (n Ht.f)=ältester
Königssohn von
seinem Leib;
|
Quelle:
Dodson, Hilton, Families, Thames & Hudson 2004,
Wikipedia: Amenophis II. |
Ursprünglich war
Amenophis (Sohn von Thutmosis III. und Meritre-Hatschepsut nicht der
vorgesehene Thronfolger seines Vaters, doch sein älterer Halbbruder Amenemhat
(B) starb wohl früh, so dass Thutmosis III. in seinem 51. oder 52.
Regierungsjahr am 1. Achet IV, Amenophis II. zu seinem Mitregenten
ernannte (Wikipedia, Amenophis II.). Nach dem Tod seines Vaters und der
erfolgten Beisetzung am 30. Peret III. (4. März) 1425 v. Chr. bestieg
Amenophis II. einen Tag später am 1. Peret IV. den Thron von Ägypten. Seine
Regierungszeit wird von Manetho mit 25 Jahren und 10 Monaten angegeben. Sein
höchstes belegtes Regierungsjahr ist das Jahr 26, welches sich auf einer
Scherbe eines Weinkruges aus seinem Totentempel befindet.
Zu Amenophis II. siehe - hier.
Nach Aufschriften auf Skarabäen
(Urk. IV. 1366) wurde Prinz Amenophis in Memphis geboren, wo er wahrscheinlich
seine Ausbildung erhielt. Er wurde schon in jungen Jahren mit
Verwaltungsaufgaben betraut - u. a. überwachte er die Holzlieferungen an die
nahe bei Memphis gelegenen königlichen Werften von Per-nufer. Anscheinend
übte er aber damals auch schon das Amt des "Satem" (eines
Hohepriesters in Memphis) aus. Nach Eberhard Graefe (in ÄA 37) war Amenophis
II. bei seiner Thronbesteigung 18 Jahre alt.
| Amenemhat
(B) |
| -
Sohn von Thutmosis
III. -
Titel:
sA-nsw smsw (n Ht.f)=äktester
Königssohn von
seinem Leib;
jmj-ra jHw=Aufseher
der Rinder / des Viehs
|
| genannt
auf der südlichen Seite der Festival-Halle seines Vaters im
Karnak-Tempel im Jahr 24. |
Quelle:
Dodson, Hilton, Families, Thames & Hudson 2004,
Engl. Wikipedia: Amenemhat (son of Thutmose III.) |
Amenemhat (B) war der
älteste Sohn und 1. Thronfolger von Thutmosis III. (Quelle: Dodson, Hilton,
the Complete Egyptian Families, London, S. 137). Bei der Benennung seiner
Mutter besteht Unklarheit. Möglicherweise war Königin Satiah seine Mutter,
da sie die erste Große königliche Gemahlin von Thutmosis III. war. Zwar gibt
es auch einige Wissenschaftler (wie Dorman), welche vermuten, dass
Neferure (die Tochter von Hatschepsut und Thutmosis II. / Vater von Thutmosis
III.) einige Jahre mit Thutmosis III. verheiratet war, während er der
Mitregent von Hatschepsut war und sie evtl. die Mutter von Prince Amenemhet
(B) sein könnte, ist dieses unwahrscheinlich, da Neferure niemals als
königliche Gemahlin von Thutmosis III. belegt ist.
Der Name des Prinzen Amenemhab (B) wurde auf einer Inschrift im Karnak-Tempel aus dem Jahr 24 von Thutmosis
III. erwähnt (kurz nach dem Tode von Hatschepsut und seiner anschließenden
Thronbesteigung und Alleinherrschaft. In diesem Jahr wurde er zum
"Aufseher des Viehs/oder der Rinder des Amun" ernannt - was ein recht
ungewöhnlicher Titel für einen ältesten Königssohn war.
Der Prinz Amenemhat (B) starb
noch vor seinem Vater (der nach dem Tod von Hatschepsut noch mehr als 30 Jahre
regierte) - wahrscheinlich ungefähr zwischen den Regierungsjahren 24 bis 35
seines Vaters und gelangte daher nie auf den ägyptischen Thron. Nächster
Thronfolger war Amenemhats Halbbruder Amenophis II.
| Mencheper-re
(A) |
-
Sohn von Thutmosis III. und Meritre-Hatschepsut -
Titel:
sA-nsw=Königssohn |
| Quelle:
Dodson, Hilton, Families, Thames & Hudson 2004, |
Der Prinz Mencheper-re
war einer der Söhne von Thutmosis III. Er trägt den Thronnamen seines
Vaters, der "Ewig sind die Manifestationen des Re". Seine
Geschwister sind der spätere König Amenophis II., der jung verstorbene Prinz
Siamun (B), die Prinzessinnen Nebetiunet, Meritamen, eine zweite Prinzessin
mit Namen Meritamen und Iset.
Mencheper-re wird auf der Statue
seiner Großmutter (mütterlicherseits) Hui abgebildet (heute im Brit.
Museum), von der nur noch das Unterteil erhalten ist. In den Museen
Straßburg und Kairo befinden sich Fragmente von Kanopengefäßen, die aus
seiner Bestattung im Tal der Königinnen stammen (Quelle: Dodson & Hilton,
Families, S. 138)
| Siamun
(B) |
-
Sohn von Thutmosis III. -
Titel:
sA-nsw=Königssohn |
| Quelle:
Dodson, Hilton, Families, Thames & Hudson 2004, S. 140 |
Prinz Siamun (A) war ein
weiterer Sohn von König Thutmosis III. Seine einzige Nennung, die erhalten
ist, befindet sich auf einer Statue des Kanzlers Sennefer (heute im
Ägyptischen Museum Kairo), die in die Zeit von Thutmosis III. datiert werden
kann. Da er nicht - wie sein Bruder Mencheper-re - auf der Sitzstatue der Hui
aufgeführt ist, war er wahrscheinlich kein Kind von Meritre-Hatschepsut
(falls diese die Tochter von Hui war), sondern der Sohn einer der anderen
Frauen von Thutmosis III. (siehe Dodson, Families, S. 133).
| Meritamun
(C) und Meritamun (D) |
-
Töchter von Thutmosis III. -
Titel:
sA.t-nsw=Königstochter |
| Quelle:
Dodson, Hilton, Families, Thames & Hudson 2004, S. 140 |
Die Prinzessinnen
Meritamun (C + D) waren zwei Töchter von Thutmosis III, die von den
Ägyptologen zur besseren Unterscheidung mit den Buchstaben C und D bezeichnet
werden. Beide waren Töchter der Großen Königsgemahlin Meritre-Hatschepsut -
dargestellt und genannt zusammen mit ihren Geschwistern, dem späteren König
Amenophis II., dem früh verstorbenen Prinzen Mencheper-re und den
Prinzessinnen Nebet-iunet und Iset (siehe Dodson, Hilton, Families, S. 133)
auf einer Sitzstatuen ihrer Großmutter Hui (heute im Brit. Museum London).
Die Prinzessin Meritamun (C) erbte den Titel einer Gottesgemahlin des Amun von
ihrer Mutter Meritre-Hatschepsut. Die Titel von Meritamun (C) waren
Königstochter und Königsschwester. Sie ist auch in der Hathor-Kapelle ihres
Vaters in Deir el-Bahari dargestellt. Thutmosis III. seine Große
Königsgemahlin war zu dieser Zeit Meritre-Hatschepsut, die ebenfalls in einer
anderen Szene in der Hathor-Kapelle abgebildet ist.
Der gemeinsame Titel:
(sA.t–njsw
sn.t-njsw
/ Königstovhter, Königsschwester) und die identische
Darstellung der beiden Frauenfiguren in der Hathorkapelle machen es
wahrscheinlich, dass es sich hier um Schwestern handelt.
Der Titel (sn.t–
njsw) der beiden
Prinzessinnen verweist auf ihren Bruder König Amenophis
II., was die Ausschmückung der Hathorkapelle wohl in die Zeit der gemeinsamen
Herrschaft von Thutmosis III. mit
seinem Sohn Amenophis II. setzt,
worauf ja schon die Aufstellung der bekannten Statue (Hathorkuh–König
Amenophis II.) hindeutet. Eine der
beiden Schwestern mit dem Namen "Meritamun" ist auf dem Schoß der
Erzieherstatue (Blockstatue) des Erziehers der Königskinder und Vorsteher der
Arbeit, Benermerut, die in Karnak gefunden wurde, dargestellt. Es ist
allerdings unklar, um welche der beiden Schwestern es sich hier handelt.
|
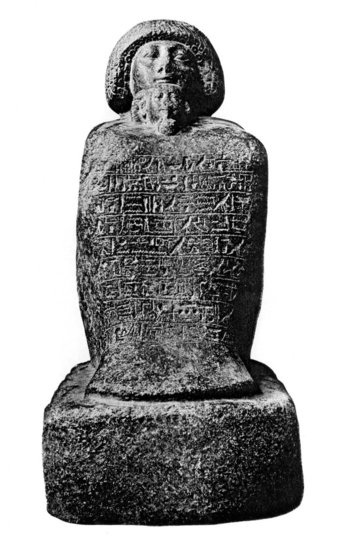
|
Sog.
"Erzieherstatue" des Benermerut
- heute im Ägyptischen Museum Kairo CG 42171 -
Die Blockstatue aus Granit des
Erzieher der Königskinder und Vorstehers der Arbeit, Benermerut -
gefunden im Tempel des Amun in Karnak - zeigt Benermerut mit dem ihm
anvertrauten Königskind Merit-Amun - wobei aber nicht klar ist, um
welche der beiden Prinzessinnen gleichen Namens es sich hier handelt.
Die Erzieher der Königskinder
hatten in der 18. Dynastie einen großen Einfluss. Unter Thutmosis III.
war einer dieser "Prinzenerzieher" ein Beamter mit Namen
Bener-merut/Benermerut. Ähnlich wie die bekannte Erzieherstatue von
Senenmut zeigt der Würfelhocker des Benermerut den Beamten mit
Merit-Amun, der Tochter von Thutmosis III.
Der Kopf der Prinzessin schaut
auf dieser Erzieherstatue aus dem Schoß ihres Erziehers. Der Inschrift
nach war Benermerut neben seiner Aufgabe als Erzieher auch als Bauleiter
und in der königlichen Verwaltung tätig (siehe: Julia Budka: Hohe
Verwaltungsbeamte unter Thutmosis III. in: Kemet, Bd. 10, Nr. 3, Berlin
2001, S. 28)
Bild: Georges Legrain
(1865-1917) von 1909
- public domain - |
| Iset /
Isis (B) |
-
Tochter von Thutmosis III. -
Titel:
sA.t-nsw=Königstochter |
| Quelle:
Dodson, Hilton, Families, Thames & Hudson 2004, S. 140 |
Die Prinzessin Isis/Iset
(B) war eine der Töchter von Thutmosis III. mit seiner Großen
Königsgemahlin Meritre-Hatschepsut. Sie ist zusammen mit ihren Schwestern und
dem Prinzen Mencheperre auf der Statue ihrer Großmutter Hui (heute im Brit.
Museum London) in einer verkleinerten Darstellung zu sehen. Wahrscheinlich war
sie die jüngste der Geschwister.
| Nebetiunet/Nebet-iunet
(B) |
-
Tochter von Thutmosis III. -
Titel:
sA.t-nsw=Königstochter |
| Quelle:
Dodson, Hilton, Families, Thames & Hudson 2004, S. 140 |
Die Prinzessin Nebetiunet, deren
Name "Herrin von Dendera" - ein Titel der Göttin Hathor - lautet,
war eine der Töchter von Thutmosis III. mit seiner Großen Königsgemahlin
Meritre-Hatschepsut. Sie ist zusammen mit ihren Schwestern und dem Prinzen
Mencheperre auf der Statue ihrer Großmutter Hui (heute im Brit. Museum
London) dargestellt.
| Baket-amun
/ Beketamun |
-
Tochter von Thutmosis III. -
Titel:
sA.t-nsw=Königstochter |
| Quelle:
Dodson, Hilton, Families, Thames & Hudson 2004, S. 140 |
Prinzessin Beketamun,
deren Name "Magd oder Dienerin des Amun" bedeutet, war eine Tochter
von Thutmosis III. Ihr Name erscheint zusammen mit der Kartusche ihres Vaters
auf dem Fragment eines Votiv-Objektes aus Fayence, das in Deir el-Bahari
gefunden wurde (heute in Boston). Ihr Name wird auch auf einem hölzernen Stab
ihres Dieners Amenmose und wahrscheinlich auf einem Skarabäus (heute im Brit.
Museum London) erwähnt. Es ist möglich, dass sie ebenfalls in der
Hathor-Kapelle ihres Vaters in Deir el-Bahari erscheint, wo die Figur einer
weiteren Prinzessin hinter der Prinzessin Merit-Amun (C) zu sehen ist, der
Name aber verloren ist (Quelle: Dodson & Hilton, Families, 2004, Thames
& Hudson, S. 138)
| Nefertari
/ Nefertiti (B) |
-
Tochter von Thutmosis III. -
Titel:
sA.t-nsw=Königstochter |
| Quelle:
Dodson, Hilton, Families, Thames & Hudson 2004, S. 140 |
Die Prinzessin
Nefertari/Nefertiti (B) ist nur mit einer einzigen erhaltenen Nennung belegt:
sie erscheint im Königsgrab ihres Vaters Thutmosis III. hinter den beiden
Großen Königsgemahlinnen Meritre-Hatschepsut und Satiah, der Königsfrau
Nebtu an 4. Stelle der Frauen (Bild siehe ganz oben auf der Seite). Die
Identität ihrer Mutter ist unbekannt - es ist aber anzunehmen, dass sie
entweder eine Tochter von der Großen Königsgemahlin Satiah oder von der
Nebenfrau Nebetu/Nebtu war. Es gibt auch keinerlei Belege, wo oder wann sie
bestattet wurde.
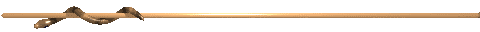
Quellen und Literatur:
- dt. Wikipedia: Thutmosis III.
- Dr. Karl Leser, www.maat-ka-ra.de
- Dodson, Complete Royal Families, Dodson und
Hilton, Thames and Hudson 2004
- Rolf Gundlach, Wolfgang Helck, Jan Assmann,
Steffen Wenig u. a.: Ägyptens Aufstieg zur Weltmacht, Rolf Gundlach,
Phillip v. Zabern-Verlag, Mainz, und Roemer- und Pelizaeus-Museum
Hildesheim 1987)
|

home
|

Sitemap
|

Grab Thutmosis III.
|

Bauten Karnak
|

Biograph. Hatschepsut
|

Beamte Thutmosis III.
|
![]()