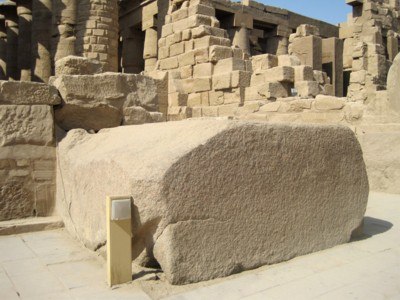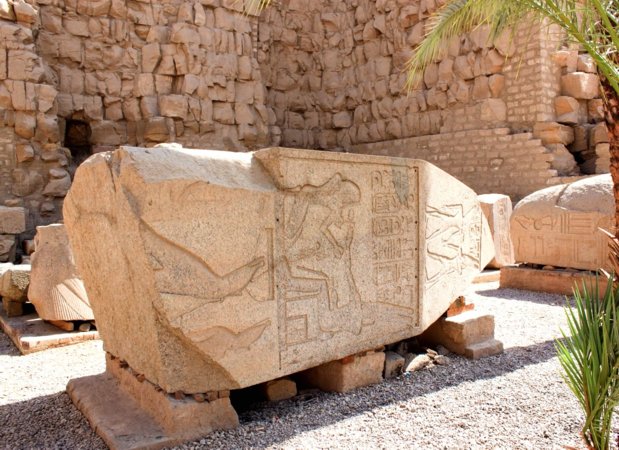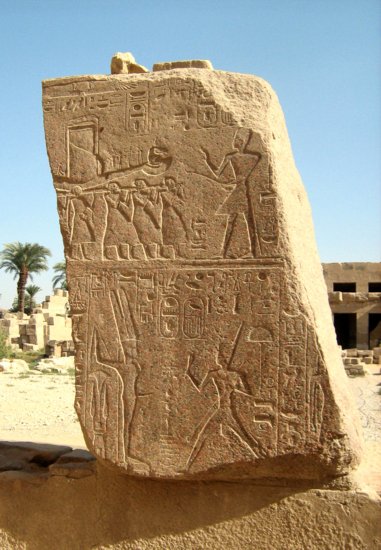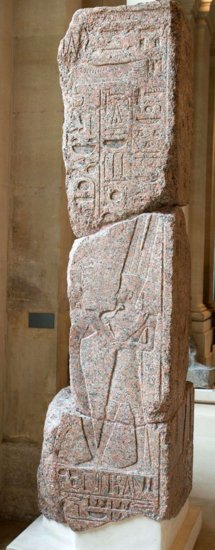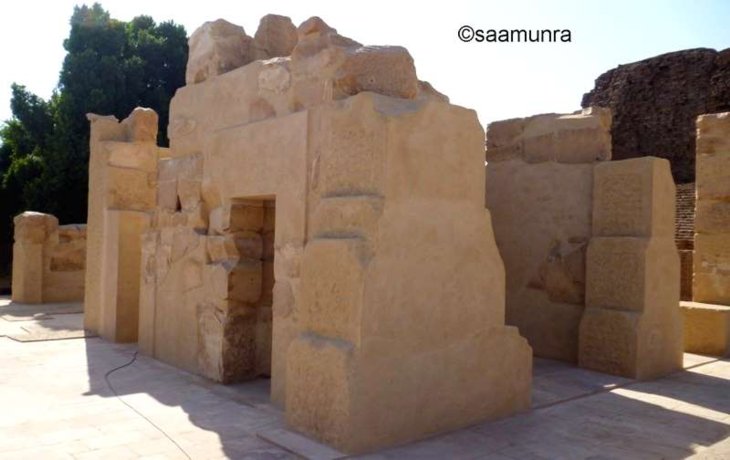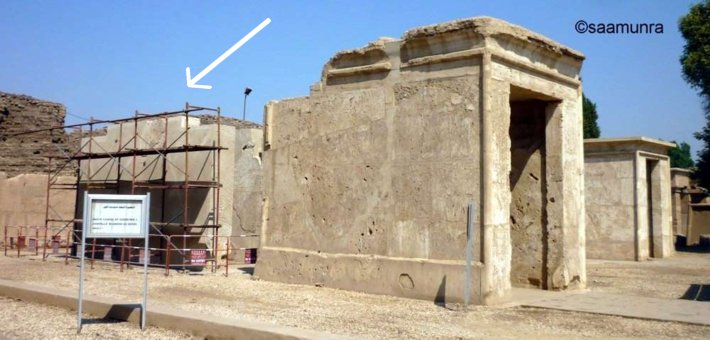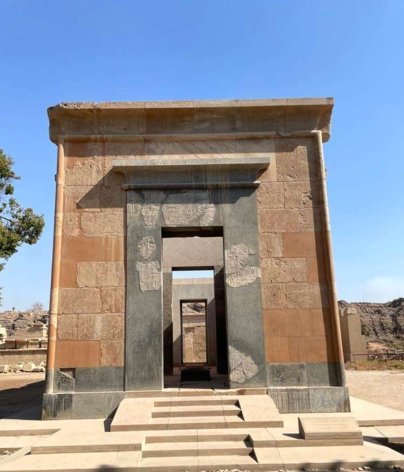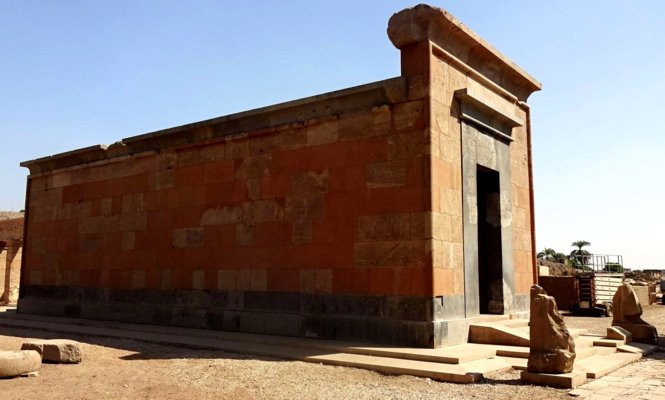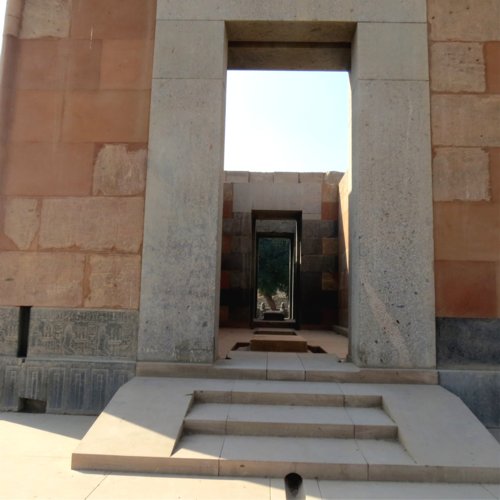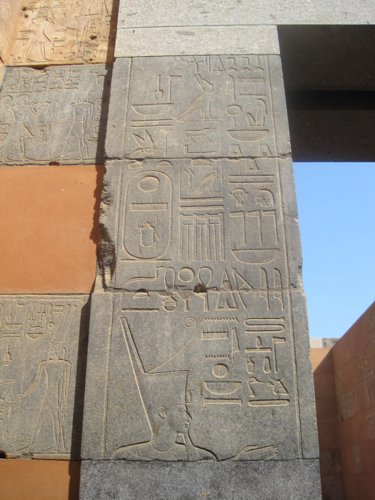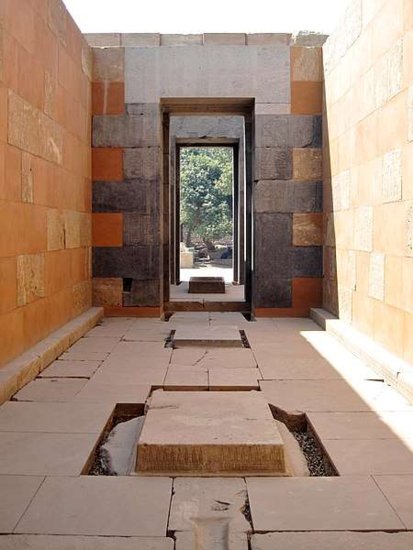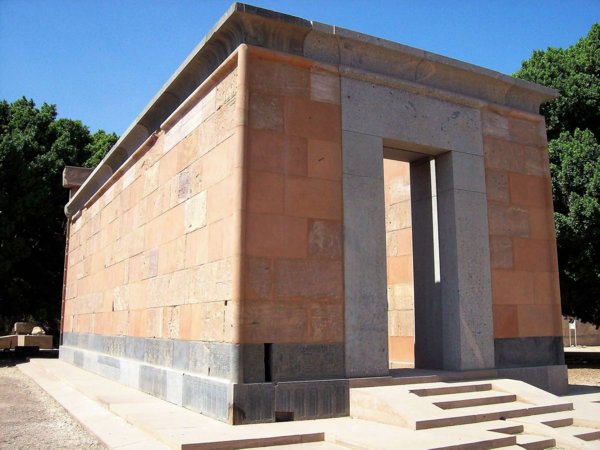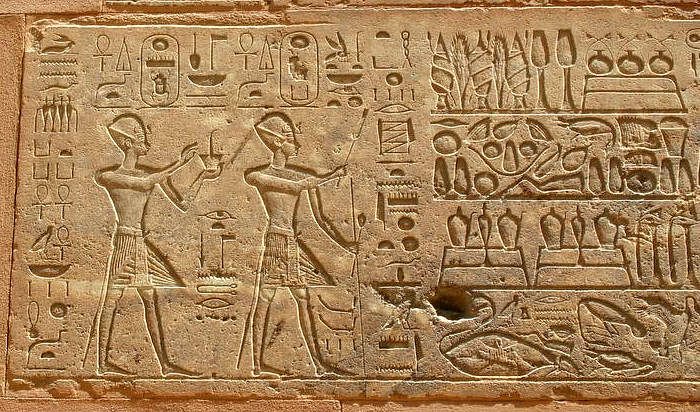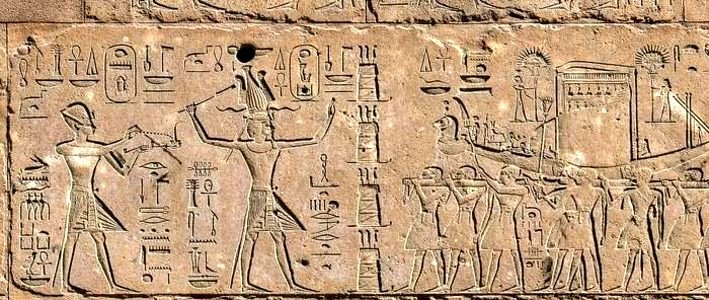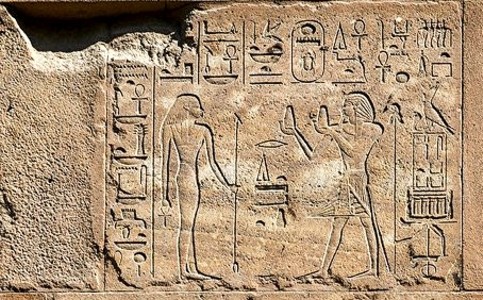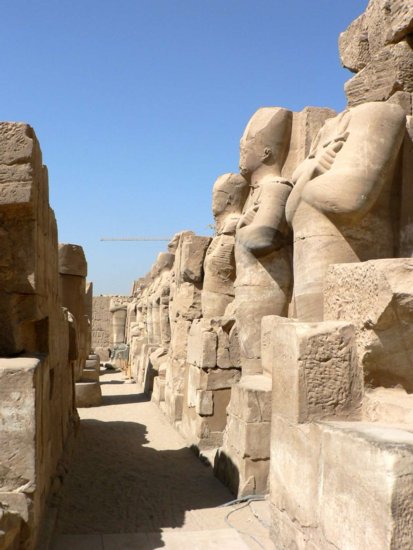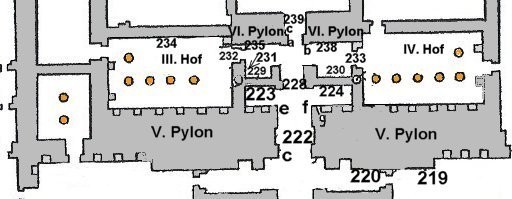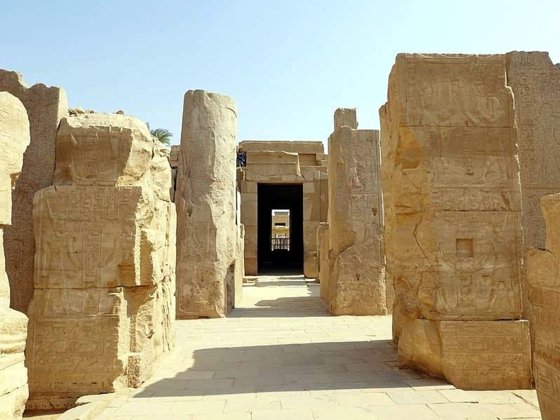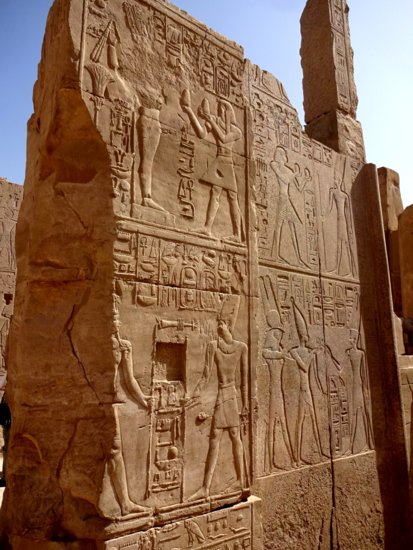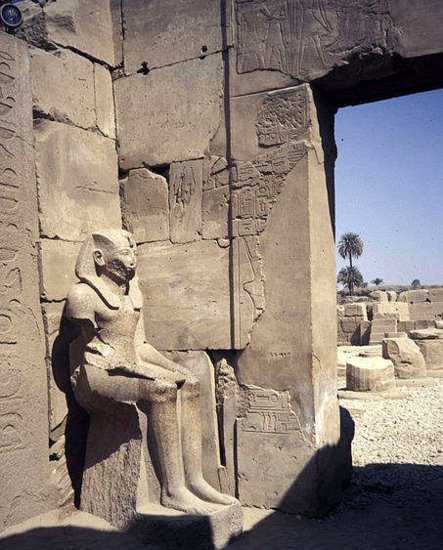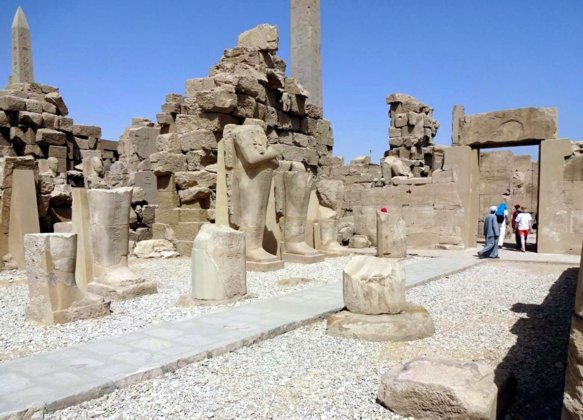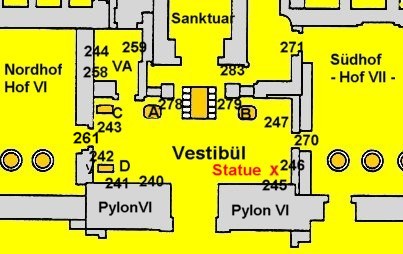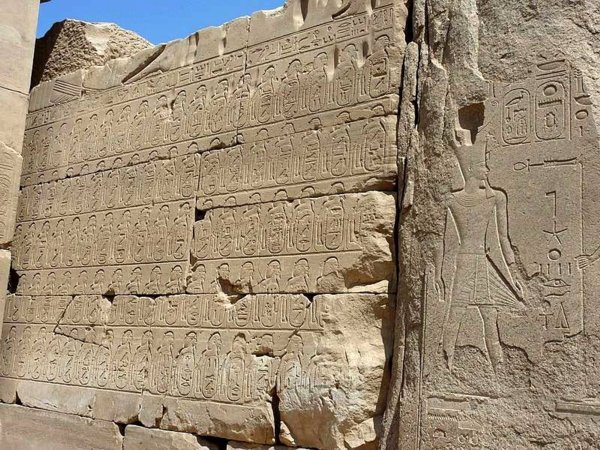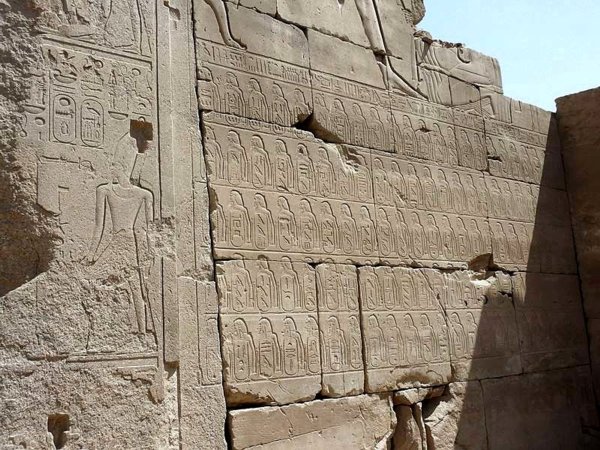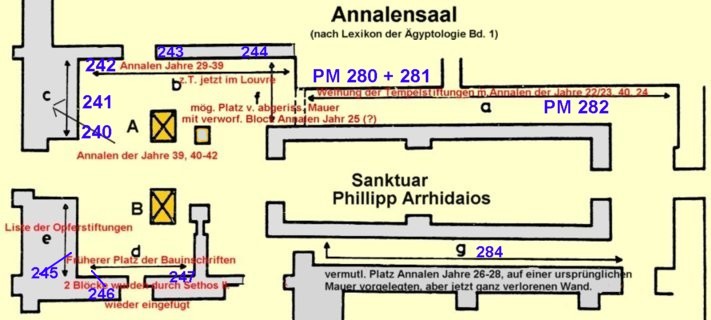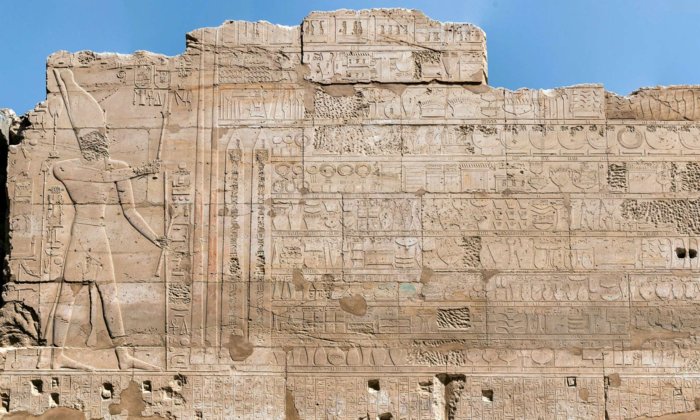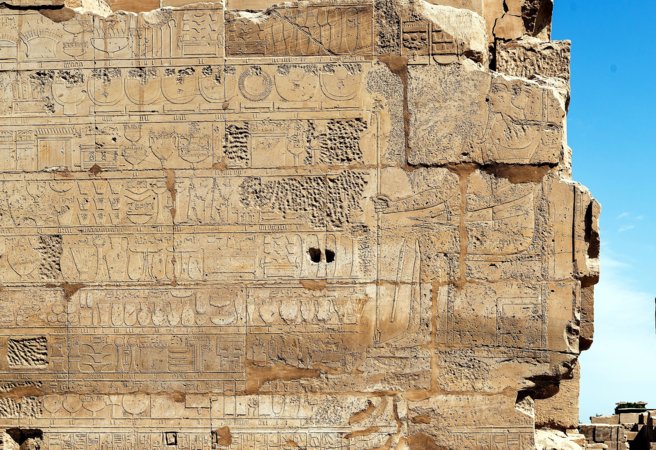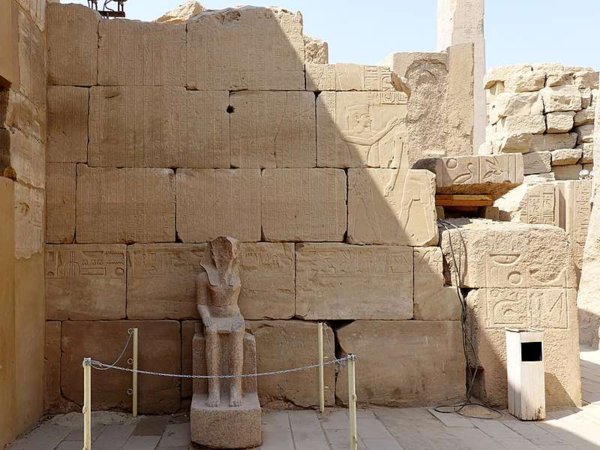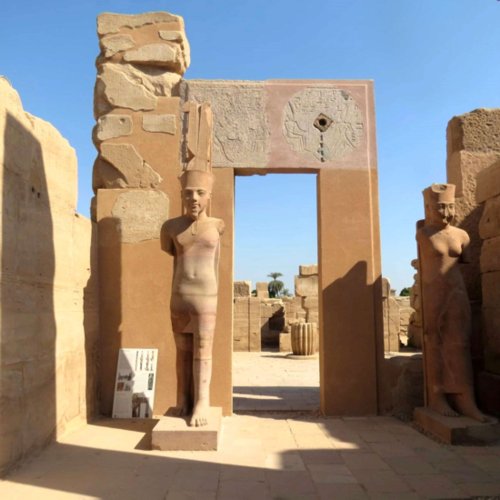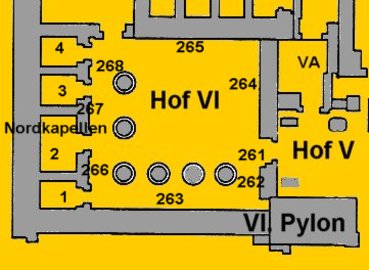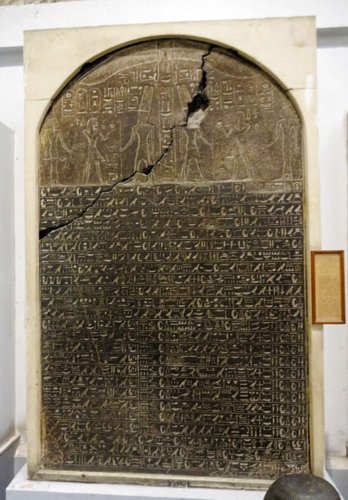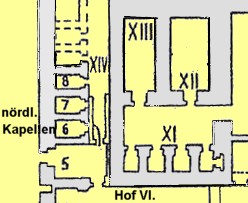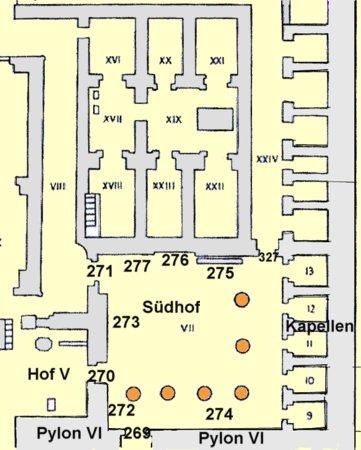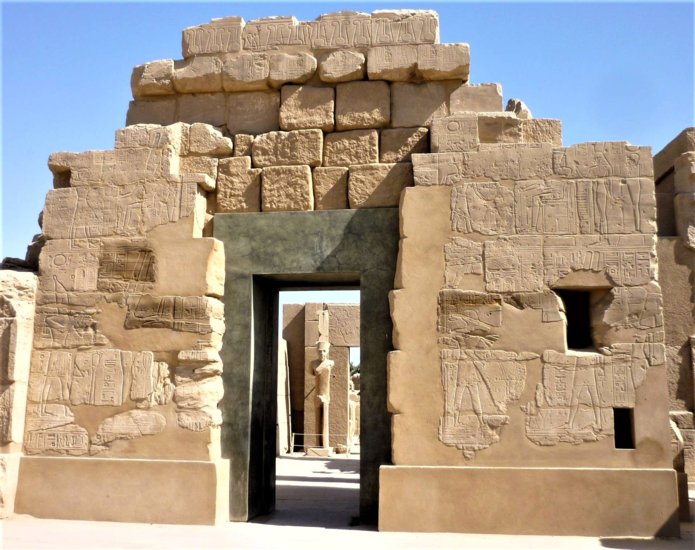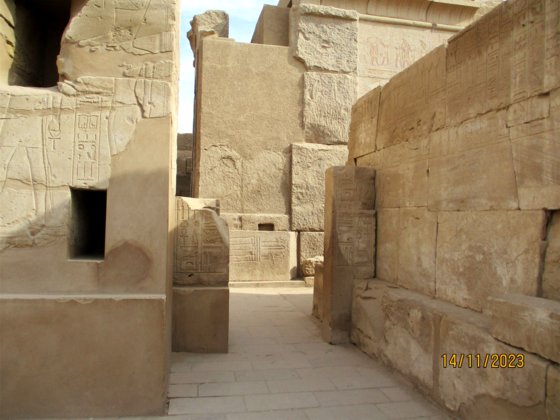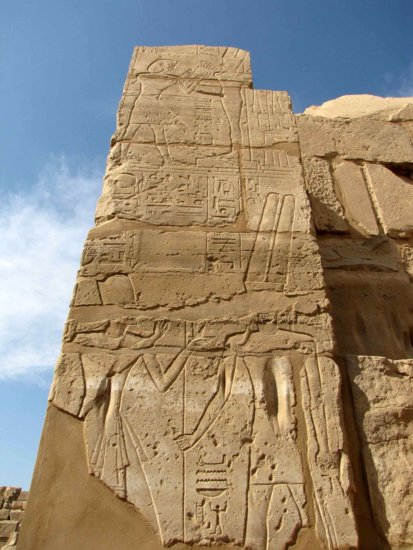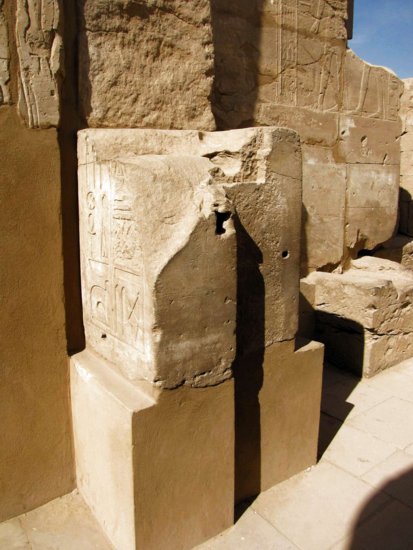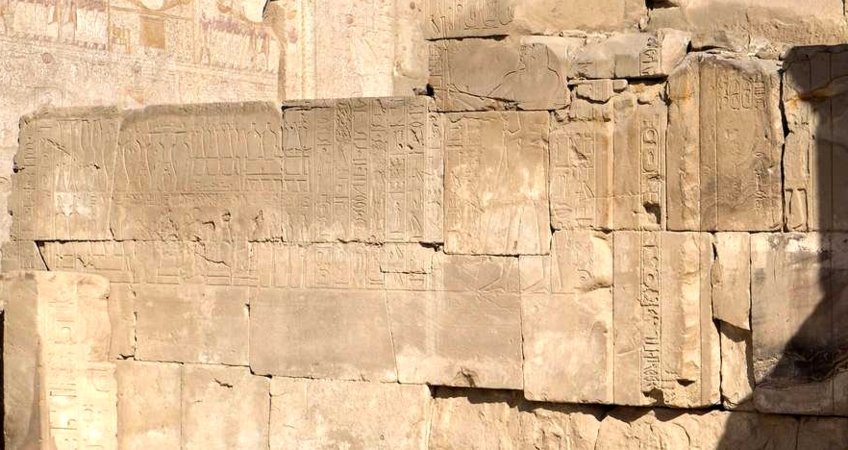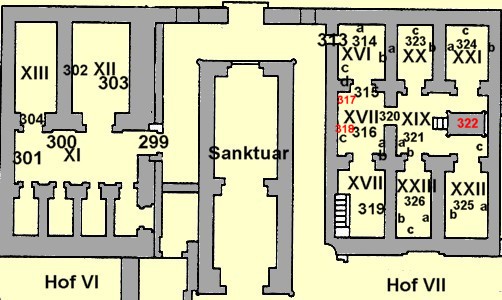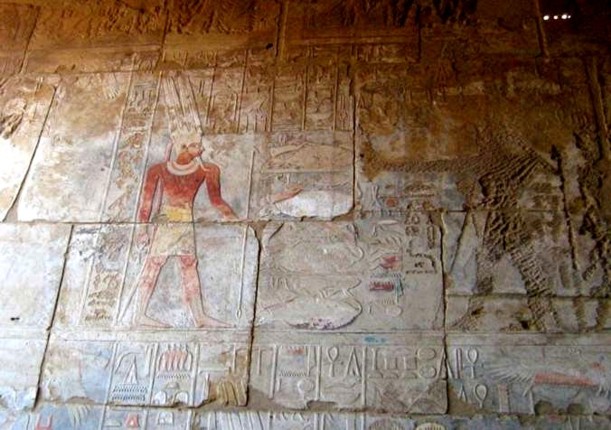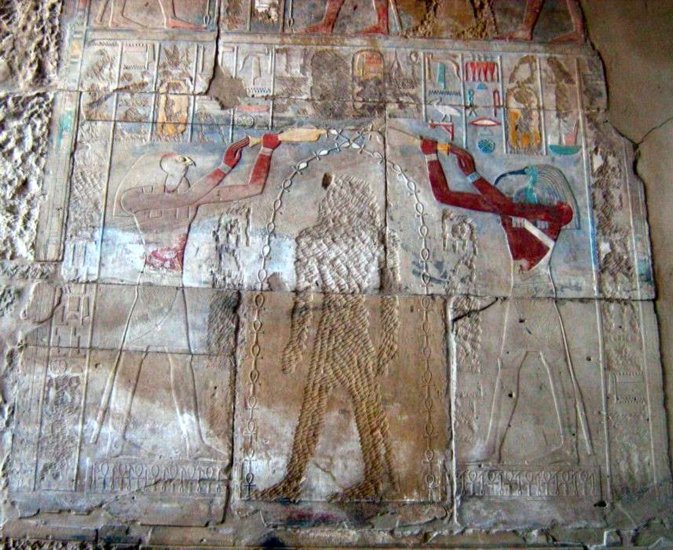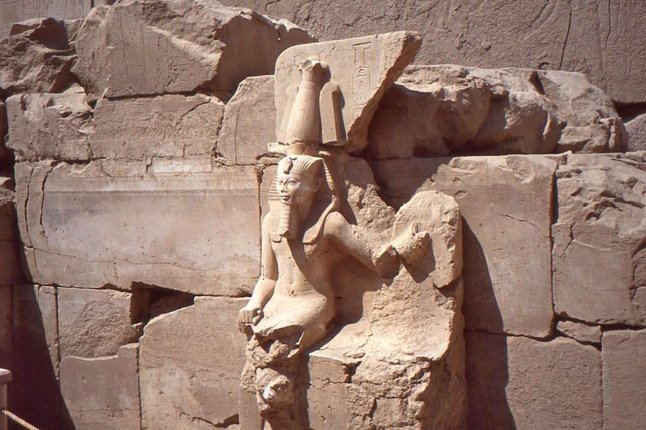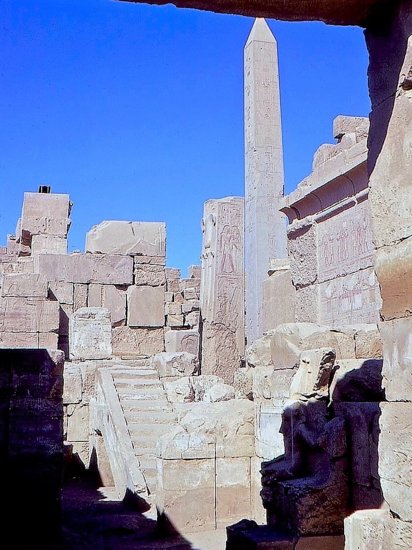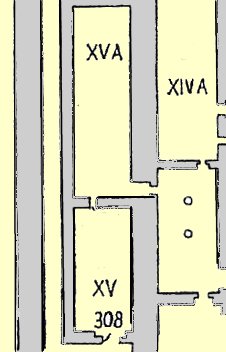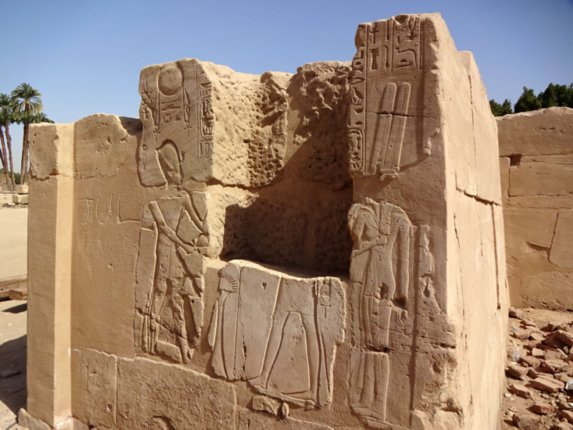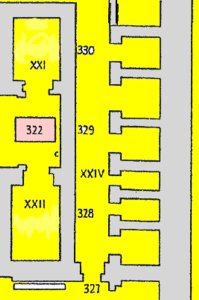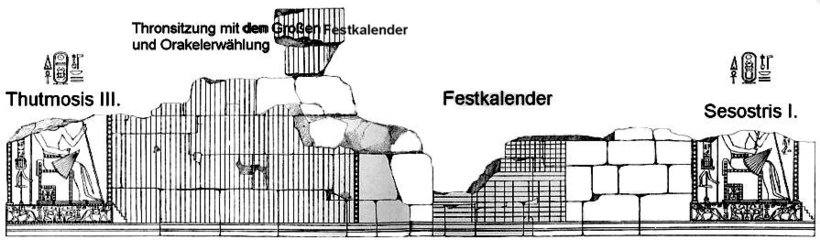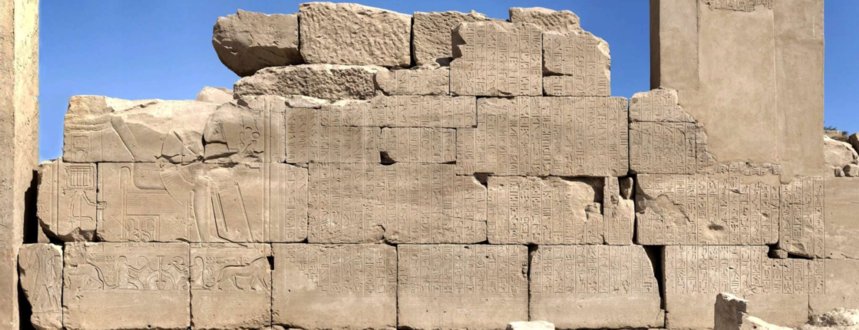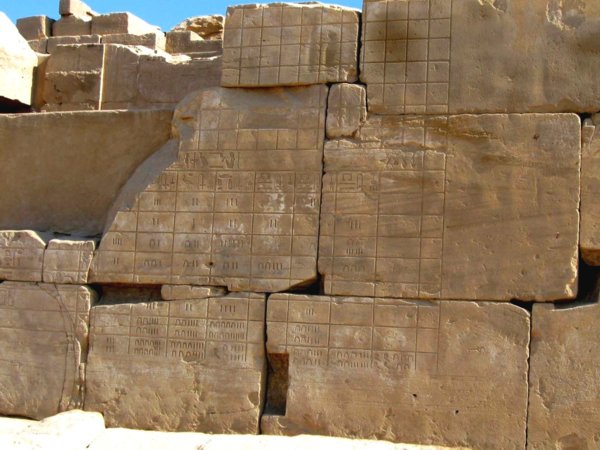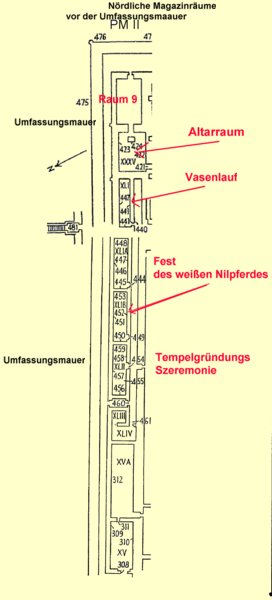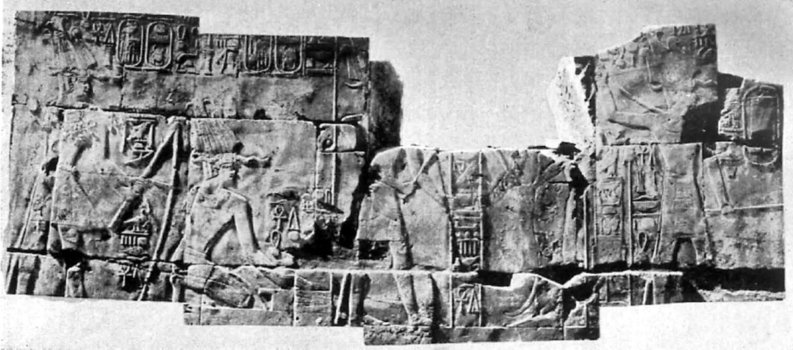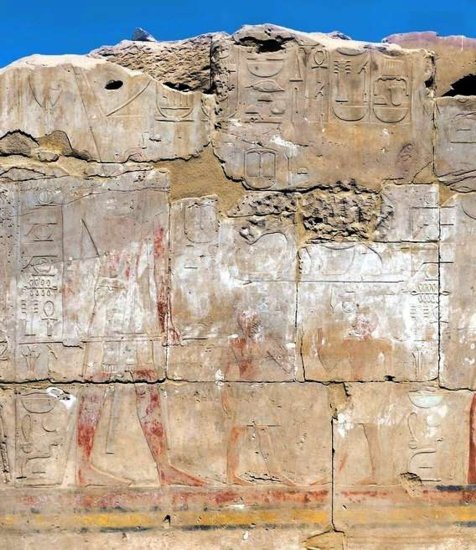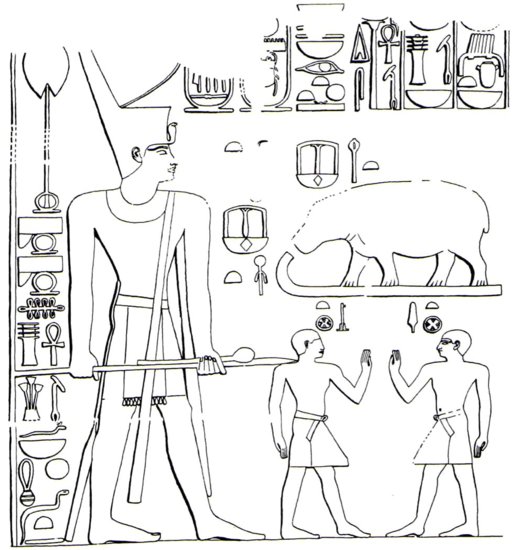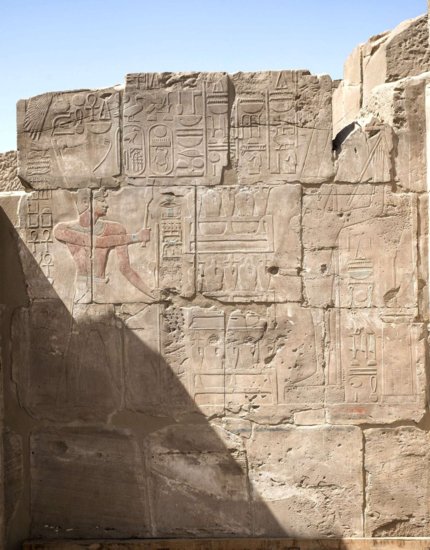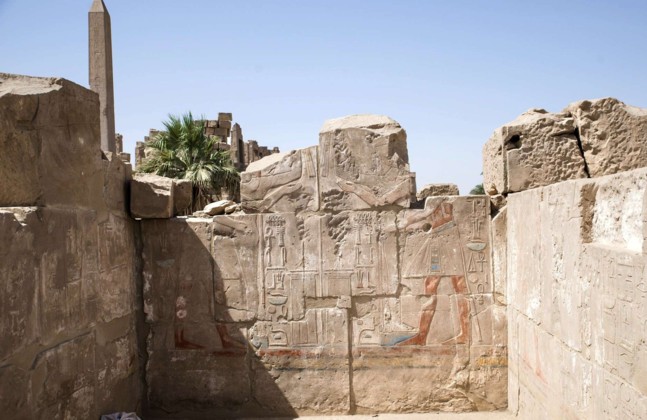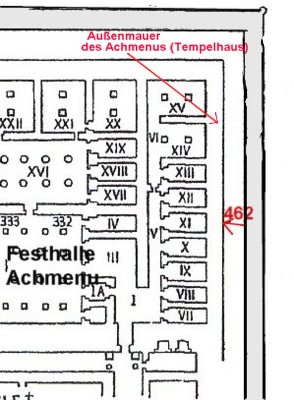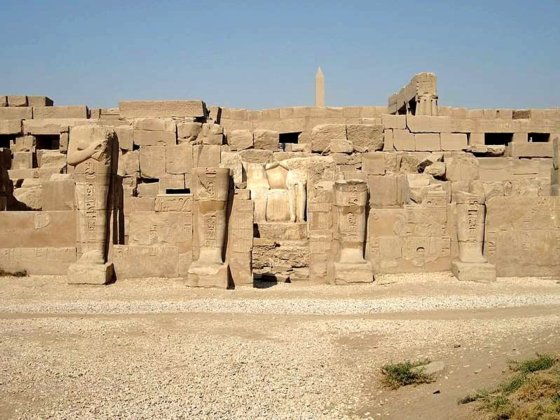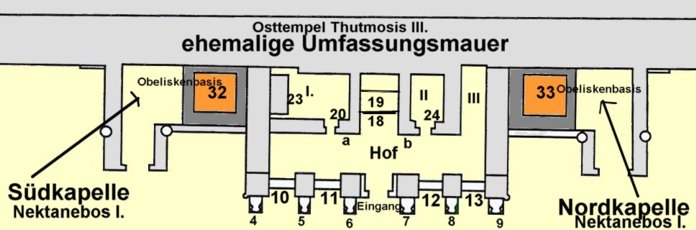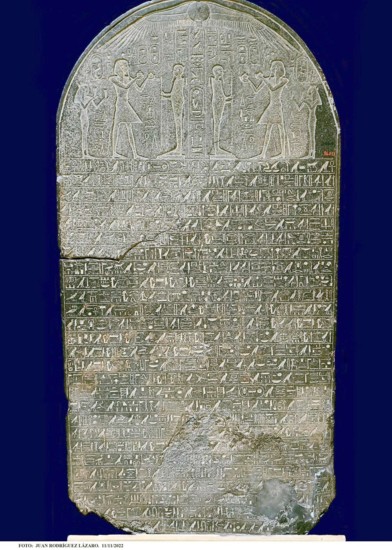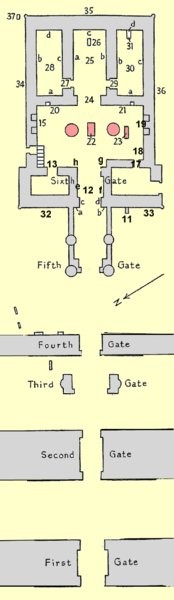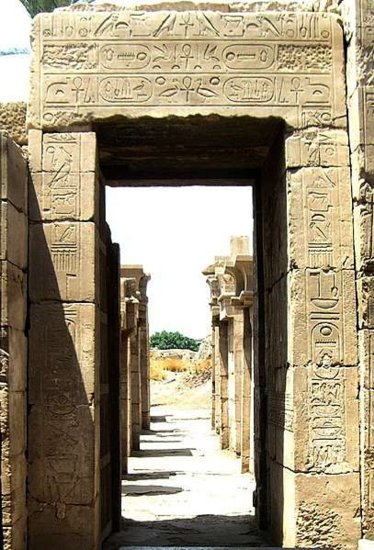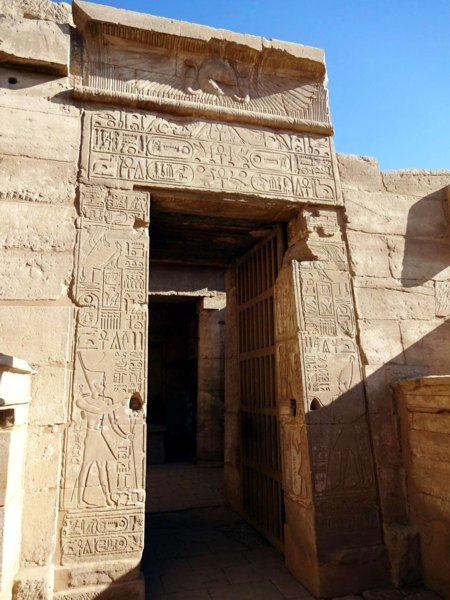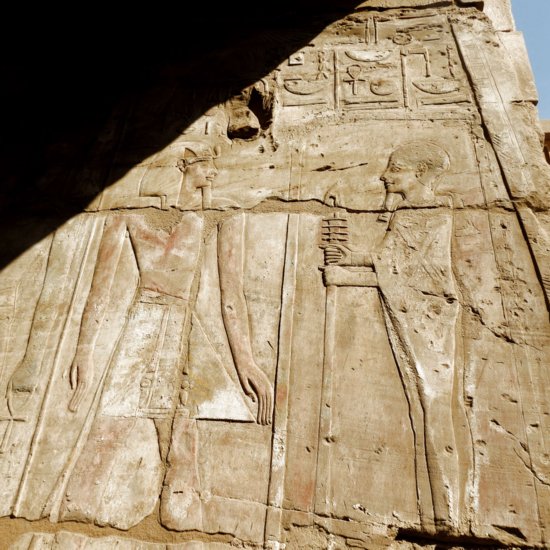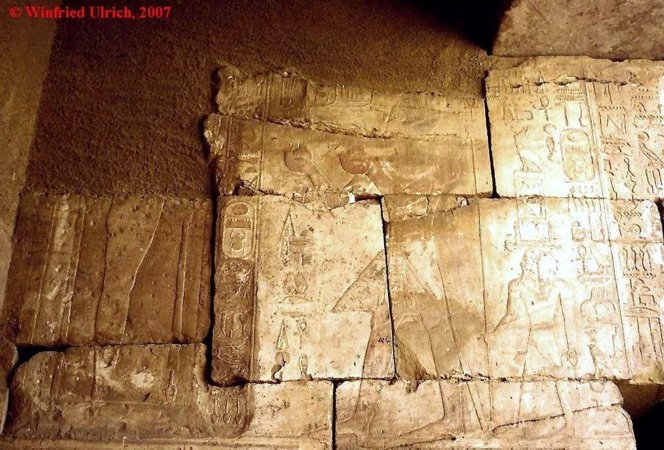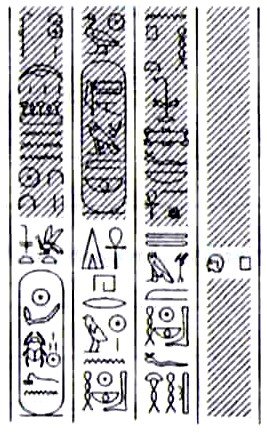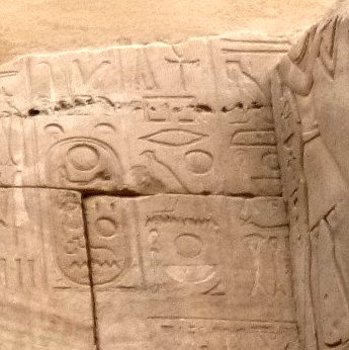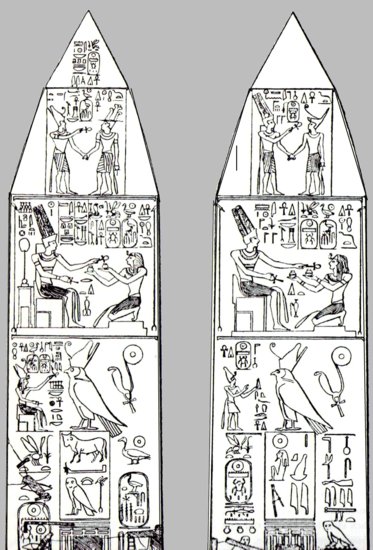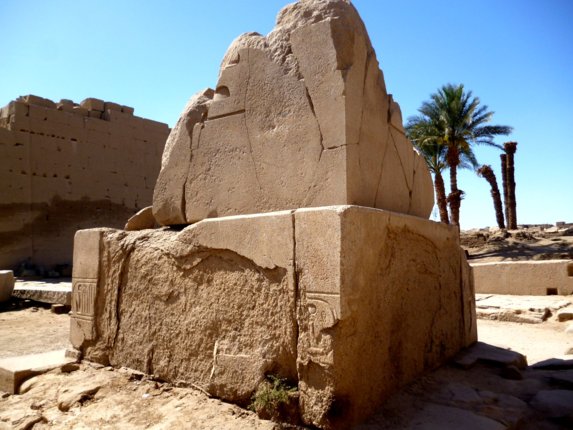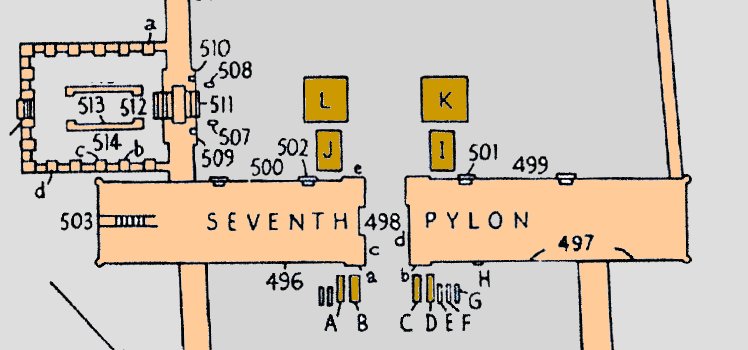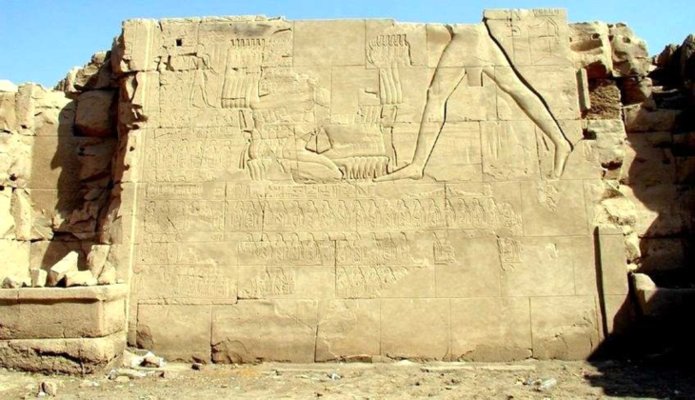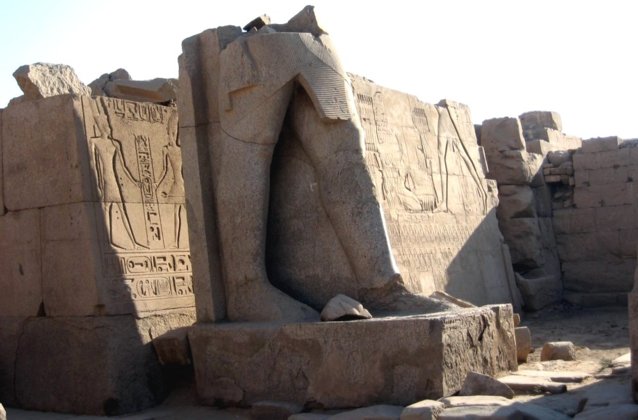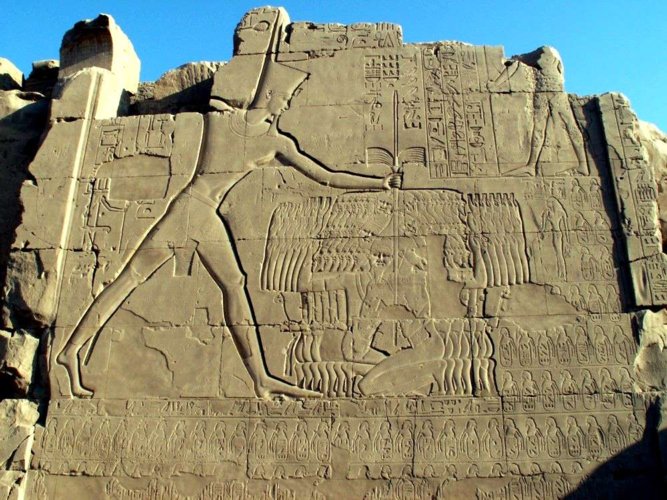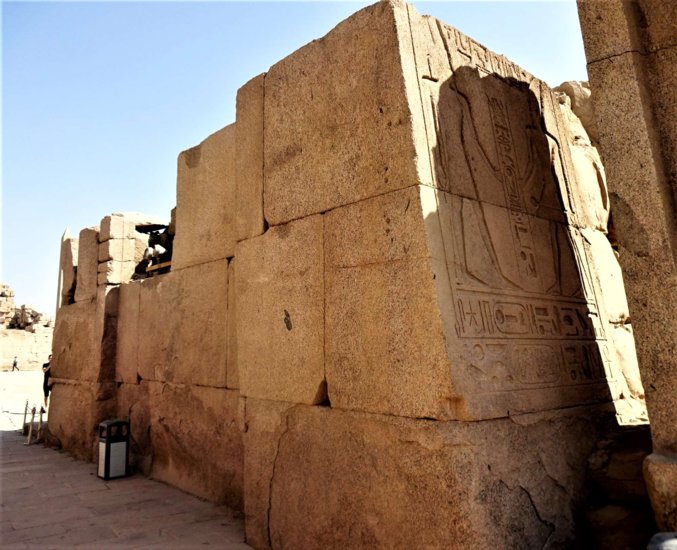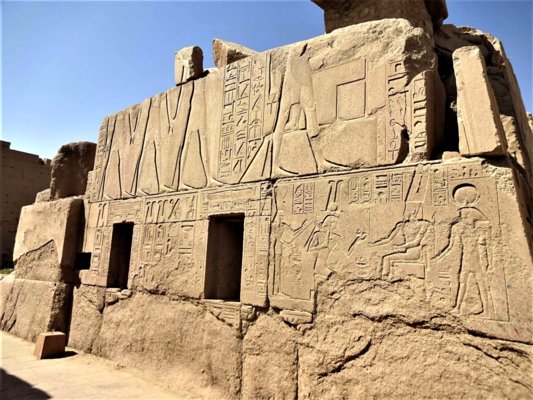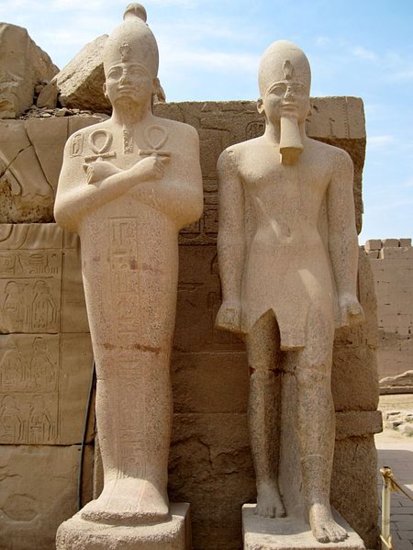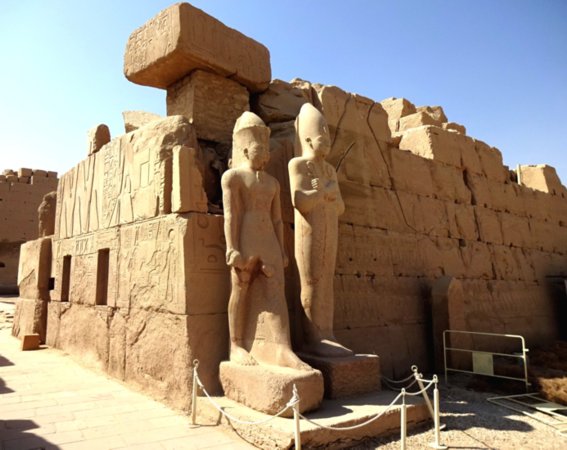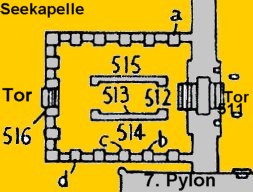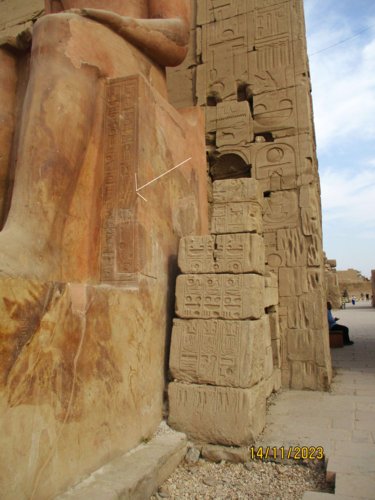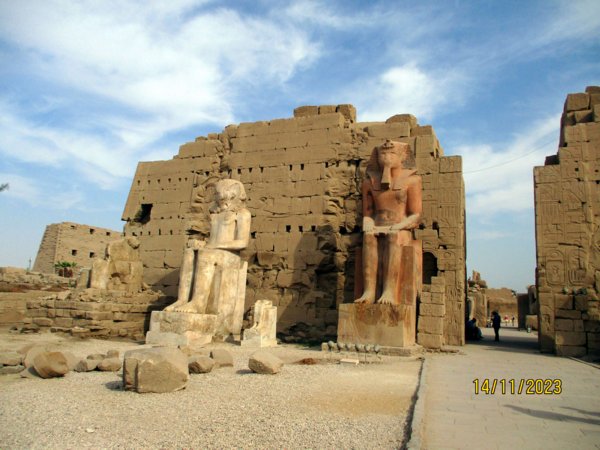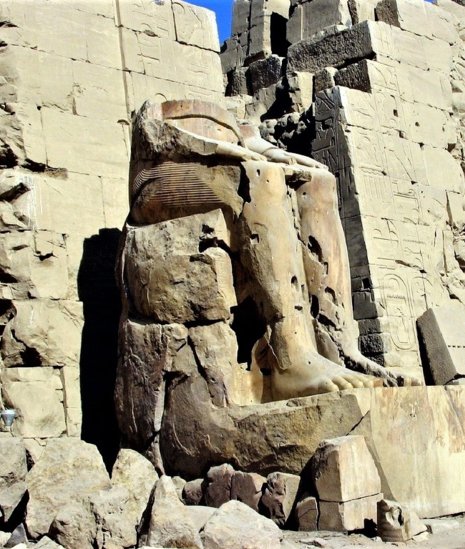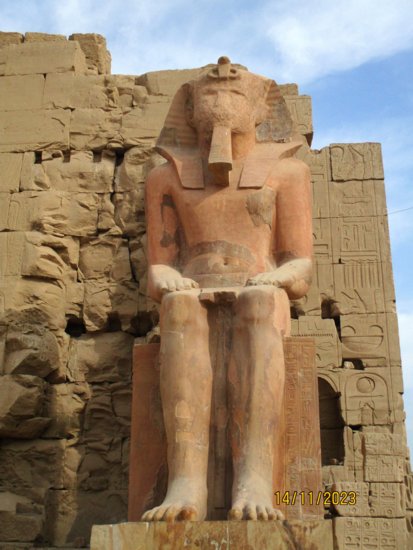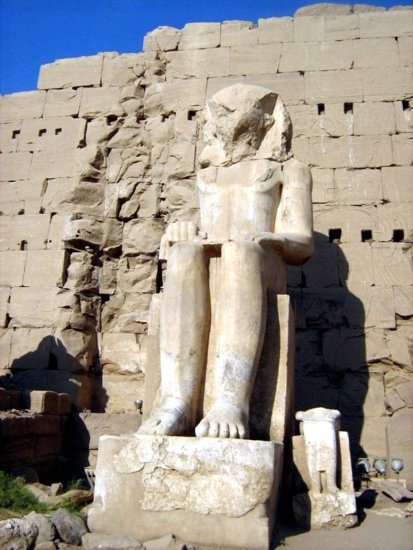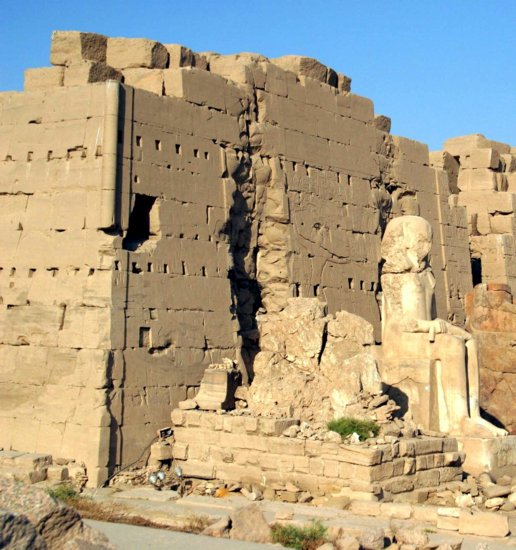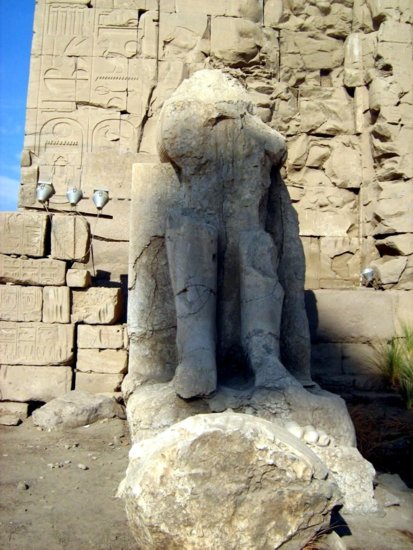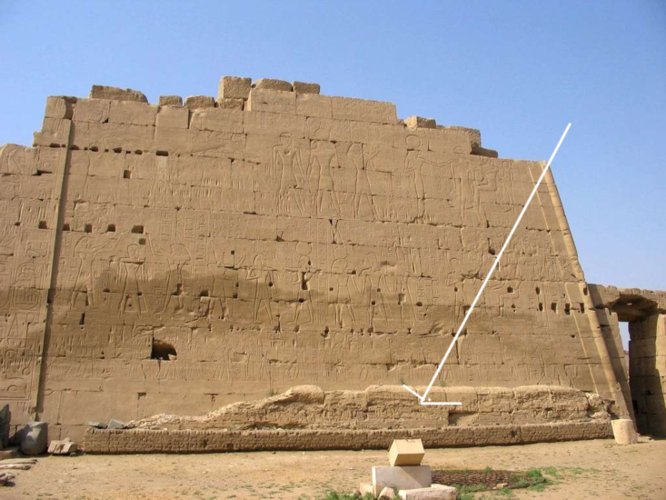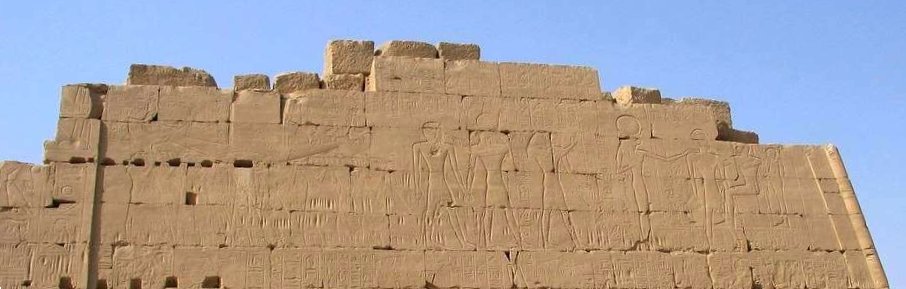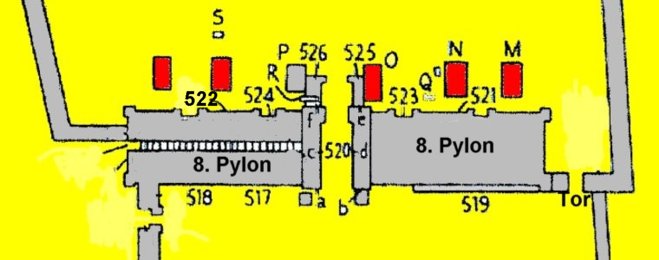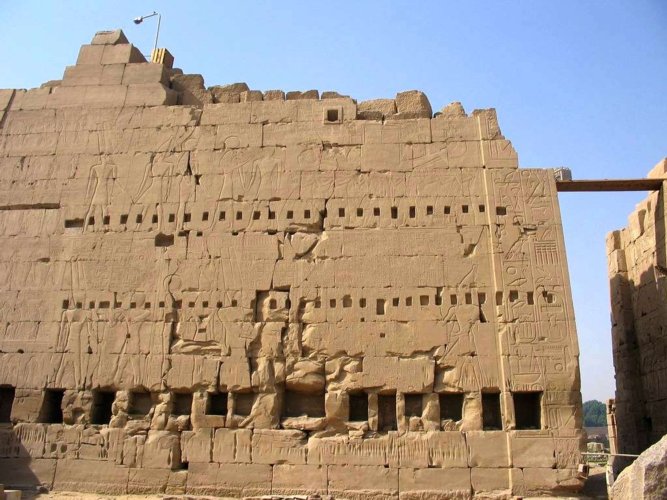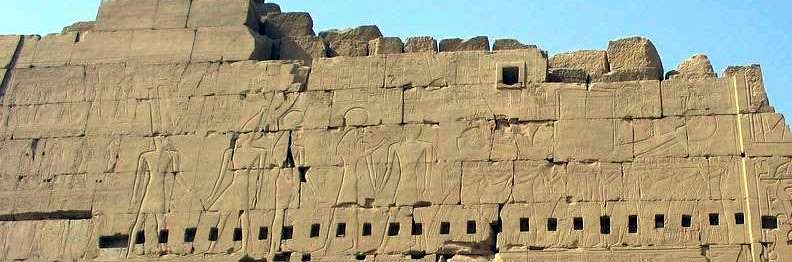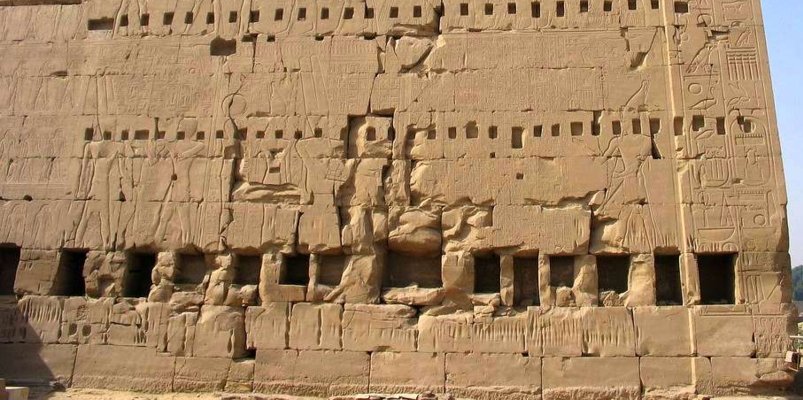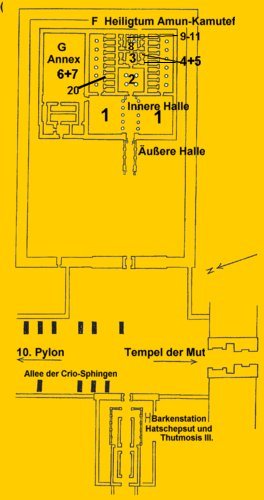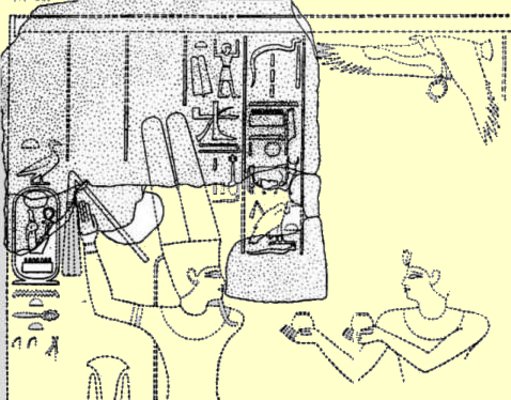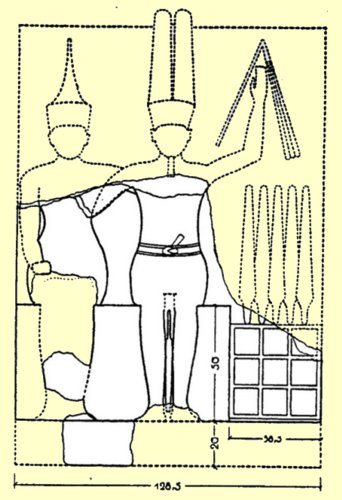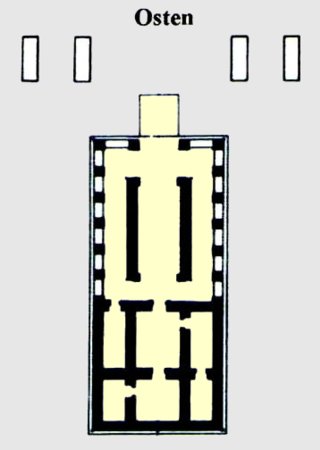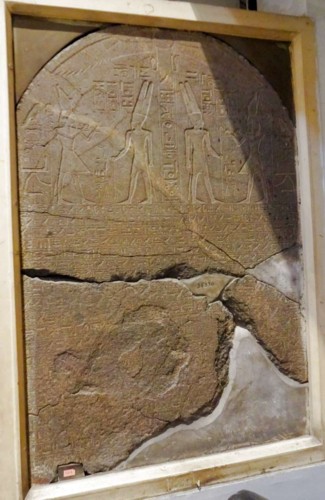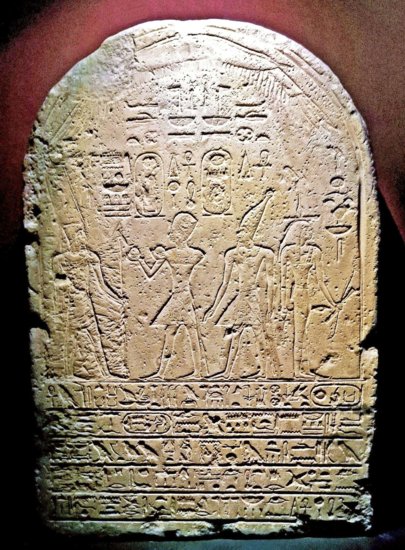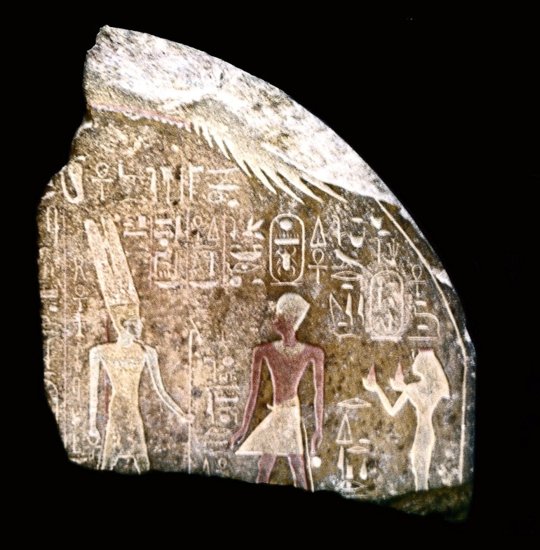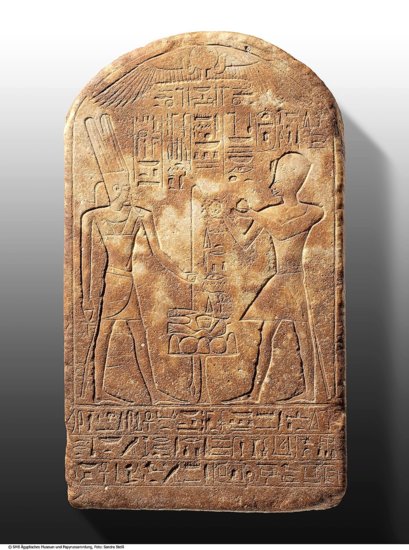Biografie Thutmosis III. |

Bauten im ganzen Land |

Achmenu im Karnaktempel |
Quellen und Literatur-Angaben am Ende dieser Seite
-nummerierte Verweise im Text
PM = Porter Moss, Topographical Bibliography of Ancient Hieroglyphic Text,
Reliefs and paintings 1927-1952
Bilder oben: beide Peter Alscher (2009)
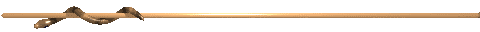
Die Könige der 18. Dynastie des
Neuen Reiches fühlten sich besonders verbunden mit dem Reichsgott Amun-Re.
Dementsprechend wurde der Tempelbezirk des Amun unter Thutmosis III.
maßgeblich erweitert und restauriert.
Im Verlauf der Doppelherrschaft Hatschepsut – Thutmosis III. fanden im Tempelbezirk des Gottes
Amun–Re zu Karnak bedeutende Veränderungen statt. Jedoch erst nach Antritt
seiner Alleinherrschaft begann Thutmosis
III. mit einem gewaltigen Bauprogramm innerhalb des Tempelbezirks von
Karnak. Nach seiner Rückkehr von
seinem ersten siegreichen Feldzug in seinem 23 Jahr wurden Großprojekte in
Angriff genommen.
Zur Zeit seines ersten
Regierungsjubiläums im Jahr 30 waren die meisten Bauprojekte im wesentlichem
abgeschlossen. Eine zweite Bauperiode fällt in die vierziger Jahre seiner
Herrschaft.
| Hof zwischen 3. und 4. Pylon |
Unter Thutmosis III. wurden in
dem Hof zwischen dem III. und IV. Pylon des von Thutmosis II. errichteten
Festhof - zwischen den dort bereits stehenden Obeliskenpaar seines Großvaters
Thutmosis I. un der u sehen. Von den Obelisken selbst ist heute nur noch die
Basis des Rechten erhalten, sowie ihre beiden Pyramidions und Bruchstücke
eines Schaftes. Die Basen dieses Obeliskenpaares befanden sich mit ihren
Westseiten direkt an den Pylontürmen des von Amenophis III. neu errichteten
III. Pylon.
Tritt man durch das Tor des III.
Pylons, befindet man sich in einem schmalen, rechteckigen offenen Hof, der
seinerseits durch den IV. Pylon von Thutmosis I. (dem Großvater von Thutmosis
III.) abgeschlossen wird. In diesem Hof standen später zur Zeit von Amenophis
III. vier massive Obelisken - je zwei von Thutmosis I. und von Thutmosis III.
|
Lage der 4 Obelisken im kleinen offenen Hof
hinter dem III. Pylon |
| Durch den unter Amenophis III. errichteten III.
Pylon erreicht man einen kleinen schmalen rechteckigen Hof, in dem 4
Obelisken standen, die heute allerdings bis auf den rechten Obelisken
(D) von Thutmosis I. (Großvater von Thutmosis III.) alle zerstört
sind. Nur noch die Bruchstücke der Granitsockel von (A) und (B)
(Thutmosis III.) sind heute in situ an der Rückseite des III. Pylons
zu sehen.
Von dem heute zerstörten Obelisken (C) des Thutmosis I. vor dem
IV. Pylon (links auf dem Plan) findet man heute nur noch den Sockel
und in dessen Nähe einige Bruchstücke. |
|
Zeichnung nach Porter & Moss - bearb. von
Nefershapiland
- alle Rechte vorbehalten - |
|
Granitsockel des (südlichen) zerstörten
Obelisken
von Thutmosis III. |
Granitsockel des (nördlichen) zerstörten
Obelisken
von Thutmosis III. |
|
beide Bilder: mit frdl. Dank Elvira Kronlob
- alle Rechte vorbehalten - |
|
Das Pyramidion von Obelisk
A zeigt den König kniend, Wein vor Amun–Re opfernd,
und wie er von diesem Leben erhält. Das Bruchstück lag 2010 vor dem
II. Pylon. Wo die die Fragmente heute (März 2023) befindent ist uns
nicht bekannt. |
|
Bild: Mr.
Snooks, Wikipedia 2010
Lizenz: CC
BY-SA 2.0 |
| Neubau des zentralen Barkensanktuars |
Der Bezirk zwischen
dem heutigen IV. Pylon und dem Achmenu von Thutmosis III. wurde im antiken
Ägypten der Pharaonenzeit als "Ipet-Sut" (Ort der Erwählung)
bezeichnet. Thutmosis III. ließ den Portikus (Säulengang), den sein
Großvater Thutmosis I. um das Zentralheiligtum des Mittleren Reiches angelegt
hatte, entfernen und dafür viele kleine, eng aneinander liegende Kapellen
ersetzen, in denen Statuen verstorbener Herrscher verehrt wurden (1).
Unter der Regierung
von Thutmosis III. wurde das erst wenige Jahre zuvor Hatschepsut erbaute
Barkensanktuar um den V. Pylon herum durch ein neues Gebäude aus schwarzem
Granit ersetzt, das durch einen weiteren kleinen Torbau unterteilt und einem
kleinen Vorbau erweitert wurde. Die beiden kleinen "golden glänzenden
Obelisken" von Thutmosis III. (siehe Thomas Kühn, Zu Ehren Amuns - die
Bauprojekte Thutmosis III. in Karnak / Kemet, Bd. 10, Nr. 3, Berlin 2001, S.
33f) dürften in dem kleinen Hof vor diesem Anbau gestanden haben, die dann
bei der Eroberung Thebens durch die Assyrer im 7.Jahrhundert v. Chr. erbeutet
wurden. Thutmosis III. errichtete dann an der westlichen Außenwand des
südlichen Teils des Zentralgebäudes eine Scheintür, von deren einstiger
Ausstattung mit Gold und kostbarem Lapislazuli eine Widmungsinschrift
berichtet. Von besonderem Interesse bezüglich seiner Inschriften ist der sog.
"Annalensaal", der sich an den Wänden des Hofes vor dem
Barkensanktuar und an der nördlichen Umfassungsmauer erstreckt. Die hier im
40. Regierungsjahr eingravierten Texte geben einen anschaulichen Bericht über
die militärischen Aktionen Thutmosis III. (1).
Evtl. Fragmente des
Barkensanktuars
von Thutmosis III um den V. Pylon herum
Evtl. Fragmente des heute nicht mehr
vorhandenen Barkenschreins von Thutmosis III. (an dessen Position sich heute
die Barkenkapelle von Philipp Arrhidaeus befindet) wurden lt. Barguet, P.
(Temple d'Amon-Re a Karnak, Cairo 1962) und Porter & Moss an drei
verschiedenen Stellen (wobei die meisten Blöcke aber "verbaut" im
3. Pylon gefunden wurden. Hier werden von uns 4 verschiedene Blöcke
vorgestellt:
-
Fragment aus
Rosengranit: aufgestellt hinter dem Barkensanktuar von Ph. Arrhidaeus auf
der nördlichen Seite der Mauer zum Mittleren-Reich Hof
(PM² II 98 [285] ) (?)Der Block zeigt in den seinen Resten 2 Register
übereinander:
oben: Thutmosis mit der oberägyptischen Krone, der vor der
Barke des Amun, die von Priestern getragen wird, weihräuchert.
unten: Thutmosis beim Kultlauf vor dem ithypalischen Amun-Kamutef,
König der Götter, Herr des Himmels. Die Laufszene zeigt ein paar
Besonderheiten, denn
a) sie zeigt Thutmosis III. sowohl beim Vasenlauf als auch mit einem Ruder
in der Hand beim Ruderlauf - hier werden also zwei rituelle Kultläufe in
einer Szene dargestellt. Die Beischrift dieser
Darstellung (JTjt Hpt xnp qbHw n jt =
"Ergreifen des Hepet-Gerätes und das Darbringen der
kühlen Wasserspende für den Vater.
b) lt. Decker & Herb, Bildatlas, 1994, S. 52 fehlen der Szene die
typischen Laufmale - vermutlich wurden diese aus Platzgründen nicht
dargestellt.
Lt.
Decker könnte es sich bei diesem Stück um einen Teil des zerstörten
Allerheiligsten/Sanktuar des Barkenschreins von Thutmosis III. handeln.
|
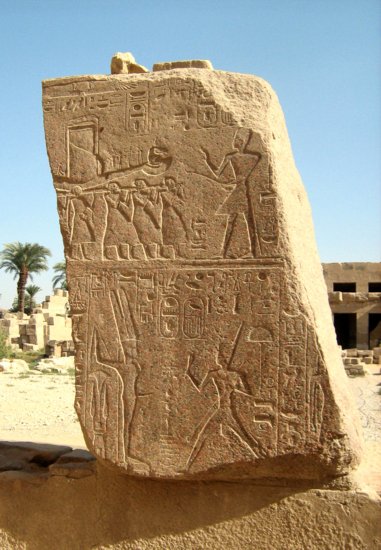
|
Block aus Rosengranit mit
Kultlauf
(PM² II 98 [285] )
Das Bild zeigt einen Block aus Rosengranit, der aus
dem 2. Pylon stammt und sich heute auf die nur mehr eine Steinlage hohe
Rückwand des nördlichen Teils des Palastes der Maat gesetzt wurde. Der
Block gehört zu dem heute zerstörten Barkensanktuar von Thutmosis III.
und zeigt in zwei Register (nur noch teilweise erhalten):
-
oben: Thutmosis III., der vor einer Barke -
getragen von den Priestern auf ihren Schultern - weihräuchert.
-
unten: Thutmosis III. beim Kultlauf vor dem ithypalischen
Amun-Re mit einer Vase und einem Ruder.
Bild: mit frdl. Dank Elvira Kronlob
- alle Rechte vorbehalten - |
*
2. Auch
bei diesem Fragment aus Rosengranit (heute im Louvre/Paris) bei dem es sich um
einen Torpfosten (oder Pfeiler oder eine andere Bauspolie?) handelt, besteht
die Möglichkeit, dass es sich möglicherweise um ein Stück aus dem heute
zerstörten Barkensanktuar König Thutmosis III. im zentralen Amun-Re-Tempel
handelt.
Zu
erkennen ist, dass mit Sicherheit zwei Seiten des Objekts dekoriert waren. Auf
der im Bild gezeigten Seite befindet sich oben eine Schriftzeile - darunter
wohl ein schwebender Geier oder Falke. Darauf folgen mindestens drei
Textkolumnen (wenn nicht mehr), die auch einen Thronnamen beinhalten, bei dem
es sich wahrscheinlich um den von Thutmosis III. oder evtl. (aber wohl eher
unwahrscheinlich) um den von Thutmosis IV. handelt.
|
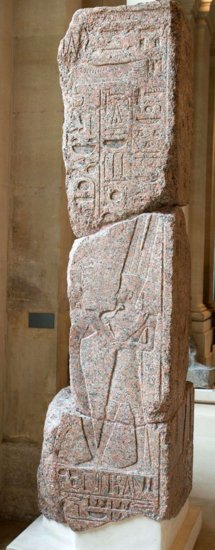
|
Torpfosten oder Pfeiler
vom Barkenschrein Thutmosis III.
- heute im Louvre, Paris -
Dargestellt ist der
König (links) vor Amun-Re (rechts). Der Gott hat seinen rechten Arm um
die Schulter des Königs gelegt, mit der anderen hält er den Ellenbogen
des Königs. Dieser trägt die Krone von Unterägypten. Unter der
Darstellung folgten noch mindestens drei weitere Textzeilen.
Bild: Courtesy to
Kairoinfo4U
- alle Rechte vorbehalten - |
*
3. Dieses aus
Granit bestehende Bauteil war einst ein Teil des Barkensanktuars von König
Thutmosis III. Gefunden wurde es verbaut im 2. Pylon und steht heute rechts
von dem unten im Bild gezeigten Block PM 275 - hinter dem Barkenschrein des
Phillip Arrhidaeus auf der Mauer zum Mittleren Reich Hof.
|

|
Fragment aus Granit
- PM² II 95 (286) -
Die Darstellung zeigt den Rest
einer Opferszene von Thutmosis III. (zerstört) vor Amun-Re. Der Gott hält
den König an seiner Hand, die andere Hand ist zum Gruß erhoben. Unterhalb
der Darstellung befindet sich eine Opferliste.
Bild: mit frdl. Dank Elvira
Kronlob
- alle Rechte vorbehalten -
beschnitten von Nefershapiland
|
4. An der Rückwand des südlichen Hofes
VII im Karnak-Tempel (Ostwand) befindet sich ein großer, vorgebauter
Block mit Resten von zwei Szenen, der ebenfalls ein Fragment des heute
zerstörten Barkensanktuars von Thutmosis III. ist.
|

|
Fragment vom Barkenschrein
Thutmosis III.
- heute im südlichen Teil der inneren Ostwand
des thutmosidischen Südhofes (PM² II 95 [275] ) -
Zu sehen sind Reste von 2 Szenen:
rechts eine Opferszene von Thutmosis III. vor dem ithyphallischen
Amun-Kamutef - links davon, Reste eines Vasenlaufes. Das Fragment wird
oben durch einen Fries abgeschlossen.
Bild: mit frdl. Dank
Saamunra
- alle Rechte vorbehalten - |
Barkenkapelle "das Göttliche
Monument"
- die sog. "Familienkapelle" - im Open
Air Museum |
Zahlreiche Bruchstücke, die aus der Zeit von
Thutmosis II., Hatschepsut und Thutmosis III. stammen, wurden bei den
zahlreichen Ausgrabungen ans Tageslicht geholt. Gabolde hat 2005 viele dieser
Fundstücke untersucht und daraus die Existenz von 4 aus Kalkstein errichteten
Bauwerken im Karnaktempel abgeleitet. Dieses waren lt. Gabolde das "Ntrj-mnw"
(das Göttliche Monument), eine weitere
kleine "Nischenkapelle", welche dem Kult mehrerer Mitglieder der
königlichen Familie gewidmet war, eine "Barken-Kapelle (?)" und
eine nur bruchstückhaft erhaltenen Kultkapelle. Alle diese Bauten
entstanden in dem Zeitraum der Wandlung von Hatschepsut zur Regentin für
Thutmosis III. - einer Zeit, die bislang nur sehr wenig durch Monumente und
Belege dokumentiert ist.
Das
"Göttliche Monument ist lt. Larché (2007) in drei Texten belegt:
-
auf
einer Statue des Hapuseneb, das in die Zeit von Thutmosis II. datiert wird
- heute Louvre A 134;
-
auf
der "Roten Kapelle" (Westtor) - aus der Zeit der Koregentschaft
von Hatschepsut und Thutmosis III;
-
und
in den Texten von Thutmosis III. "Texte de la Jeunesse" - wo das
Bauwerk als "Sanktuar [namens] Göttliches Monument aus schönem
weißen Sandstein beschrieben wird (2).
Bislang
wurden 204 Kalksteinblöcke (Larché 2007) von dieser Kapelle wiedergefunden.
Seit 2008 ist in der südwestlichen Ecke am Eingang des Open-Air-Museums von
Karnak durch das CFEETK ein Wiederaufbau der Kapelle versucht worden, der vier
Jahre andauerte und im Febr. 2013 der Öffentlichkeit übergeben wurde.
Die etwa
12 m breite und 5,39 m hohe Kapelle diente wohl als Barkenkapelle und war
ausschließlich dem Gott Amun-Re geweiht. Die Kapelle stammt
aus der frühen Regentschaft der Königin Hatschepsut für ihren Stiefsohn
Thutmosis III. und besteht aus einem offenen Hof und zwei inneren Räumen. Auf
der linken Seite befindet sich ein Durchgang mit zwei Kammern. Daneben
befinden sich auf der Vorderseite die Türen zu den beiden Räumen. Von der
Rückseite aus gelangte man zu einer Querhalle, die wohl zu drei nebeneinander
liegenden Räumen führte. Die Darstellungen zeigen Thutmosis II.,
Hatschepsut, Thutmosis III. und die älteste Tochter der Hatschepsut und ihres
Ehemannes König Thutmosis II., Neferu-Re. Hatschepsut und Thutmosis II. sind
auch zusammen zu sehen, manchmal in Begleitung ihrer Tochter, die selbst
niemals alleine dargestellt ist. Die gemeinsame Darstellung von Hatschepsut
und Thutmosis III. ist eher selten. Dabei stehen sie jedoch jeweils allein vor
dem Gott Amun-Re.
Der
ursprüngliche Standort des Gebäudes ist bislang unbekannt - jedoch könnte
es anhand der Fundlage der Blöcke in der Südachse des Tempelkomplexes
gestanden haben.
Auf
zahlreichen Reliefdarstellungen auf den Tempelwänden sind deutliche Spuren
nachträglicher Änderungen an Namen und Titulaturen der Personen zu erkennen,
wobei die Figuren selber weitestgehend unangetastet blieben. An mehreren
Stellen wurde der Name von Thutmosis III. durch den von Thutmosis II. (Quelle:
Gabolde 2005) oder Hatschepsut ersetzt. Auf einem einzigen Block (verbaut
gefunden im Ach-menu) wurde der Name Hatschepsut in Maat-ka-Re
geändert.
Die
Abfolge der Änderungen lässt vermuten, dass der Bau dieses Gebäude in den
ersten Jahren nach dem Tod von Thutmosis II. erfolgte, wobei aber das
Motiv für die Änderungen nur zu vermuten ist (wahrscheinlich politische
Gründe hatte).
|
Die noch im Aufbau befindliche Barkenkapelle
Thutmosis II. -
Hatschepsut und Thutmosis III.
im Jahre 2011 |
|
Bild: mit frdl. Dank Saamunra (2011)
- alle Rechte vorbehalten - |
|
Die Barkenkapelle "Netjery-menu" (sog.
Familienkapelle) im Jahre 2012
- Blick von Nordost - |
|
Bild: mit frdl. Dank Saamunra (2012)
- alle Rechte vorbehalten - |
|

|
Barkenkapelle "Netjery-menu"
Blick von Nordost
Bislang
wurden 204 Kalksteinblöcke (Larché 2007) von dieser Kapelle wiedergefunden.
Seit 2008 ist in der südwestlichen Ecke am Eingang des Open-Air-Museums von
Karnak durch das CFEETK ein Wiederaufbau der Kapelle versucht worden, der vier
Jahre andauerte und im Febr. 2013 der Öffentlichkeit übergeben wurde.
Bild: Elvira Kronlob 2019
- alle Rechte vorbehalten - |
|
Die Barkenkapelle "Netjery-menu" -
geweiht für Amun-Re
von der Frontseite aus gesehen - B. 12 m x H. 5,39 m
- Blick von Südost - |
|
Bild: mit frdl. Dank Saamunra (2012)
- alle Rechte vorbehalten - |
Alabasterkapelle von Thutmosis III.
- heute im Open-Air-Museum von Karnak - |
Thutmosis III. ließ
im Festhof seines Vaters Thutmosis II. (im Hof vor dem IV. Pylon) eine
Alabasterkapelle mit Nord-Süd-Ausrichtung erbauen. Später ließ König
Thutmosis IV. in der Flucht davor - wo heute der Südflügel des III. Pylons
(der von Amenophis III. erbaut wurde) steht - eine weitere Alabasterkapelle
errichten, die als Barkenschrein diente und unter Echnaton in der Amarna-Zeit
wieder abgebrochen wurde.. Die Kapelle von Thutmosis IV. wurde rekonstruiert
und im Open-Air-Museum in Karnak zwischen 1995 und 1997 wieder errichtet.
Die Bruchstücke der von
Thutmosis III. erbauten Kapelle, die ebenfalls einst im Festhof von Thutmosis
II. gestanden hatte, fand man ebenfalls als Füllmaterial verbaut im III. Pylon
des Amun-Tempels. Man konnte einen großen Teil der Fragmente der
Stationskapelle von Thutmosis III. zuordnen und sie wurde zwischen 2008 und
2016 rekonstruiert und im Open-Air-Museum in ihrer ursprünglichen
Konstellation hinter der Kapelle von Thutmosis IV. wieder aufgebaut.
|
Stationskapellen von Thutmosis IV. (vorne im
Bild) und Thutmosis III. (siehe Pfeil)
- damals noch im Aufbau -
- rekonstruiert und neu aufgebaut im Open-Air-Museum von 2008-2016 -
|
|
Bild: mit freundl. Dank Saamunra (2010)
- alle Rechte vorbehalten - |
|
Alabaster-Barkenstation von Thutmosis III.-
Ansicht von hinten
- noch im Aufbau begriffen von 2008-2016 -
davor die Kapelle von Thutmosis IV. |
|
Bild mit freundl. Dank Saamunra (2012)
- alle Rechte vorbehalten - |
|
Relieffragmente der Alabasterkapelle von
Thutmosis III.
- heute im Open-Air-Museum -
Zwei Fragmente
der Barkenkapelle. Der König
opfert vor Amun und Min–Amun / die Figur von Min–Amun wurde unter
Echnaton ausgelöscht. Im
Hintergrund auf dem rechten Bild ist die Alabasterkapelle von Amenophis
I. zu sehen
|
|
beide Bilder: mit frdl. Dank Elvira Kronlob 2008 |
Die sog. "Rote
Kapelle" (auch franz. "Chapelle Rouge") war ein Barkenschrein
für den Gott Amun-Re im Tempel von Karnak. Heute befindet sich das Gebäude
im Open Air Museum (OAM) des Karnaktempels. Man erreicht das Gelände, indem
man den Großen Festhof (hinter dem I. Pylon) mit der Taharqa-Säule zwischen
dem I. und II. Pylon nach links gehend verlässt und den Weg in Richtung der
Toiletten folgt. Im OAM befinden sich mehrere Kapellen: die Alabaster-Kapelle
von Thutmosis III., die Barkenkapelle "Netjery-menu" -
geweiht für Amun-Re, die sog. "Weiße Kapelle von Sesostris I.,
den Alabaster-Schrein von Thutmosis I. und den Kiosk von Thutmosis IV und auch
die Rote Kapelle.
|
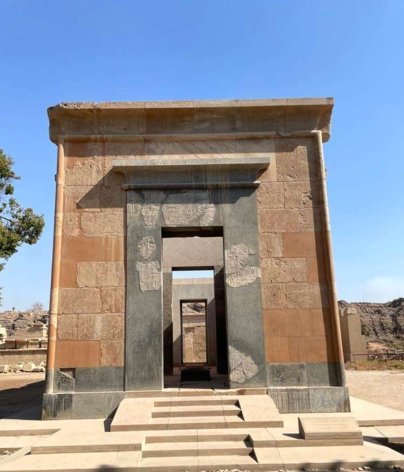
|
Die Rote Kapelle im OAM von
Karnak
- Eingang (Westseite) - ca. 7,70 hoch
-
Hierbei handelt es sich um ein
Barkensanktuar, das ursprünglich von Hatschepsut einige Jahre vor ihrem
Tod aus Quarzit- und Dioritblöcken erbaut und teilweise dekoriert
wurde. Die Dekoration wurde nach ihrem Tod von Thutmosis III.
fortgesetzt und verändert - vermutlich, weil er sie für sich selbst
nutzen wollte. In späteren Jahren lie0 Thutmosis III. sie aber
abreißen, wobei er einige Blöcke in dem von ihm am gleichen Platz für
seine eigene Kapelle wieder verwendete. Die restlichen Blöcke wurden
für eine weitere Verwendung gelagert.
Bei der Roten Kapelle handelt es sich
um ein Barkensanktuar zu Ehren des Gottes Amun-Re bzw. zu dessen
ithyphallischen Erscheinungsform Amun-Re-Min.
In moderner Zeit fand man einen
Großteil der Blöcke wiederverwendet im III. Pylon von Amenophis III.
als Füllmaterial - was sie perfekt konservierte. Einige weitere Blöcke
fand man in den Fundamenten des Ptah-Tempels (im Osten von Karnak) und
in der Nähe des IX. Pylons.
Bild: Courtesy to Carola Schneider
- alle Rechte vorbehalten - |
Der Bau aus Quarzit- und
Dioritblöcken wurde unter Königin Hatschepsut einige Jahre vor ihrem Tod
begonnen und nach ihrem Tod von Thutmosis III. in dessen Namen vollendet.
Später ließ er diese Kapelle wieder abreißen und ersetzte sie durch einen
neuen, eigenen Bau. In der Vergangenheit ist der originale Standort dieses
Heiligtums immer wieder kontrovers diskutiert worden, denn keiner der
gefundenen Steinblöcke wurde in situ gefunden.
Heute hat sich in aber unter den
Ägyptologen die Überzeugung durchgesetzt, dass sie einst an einer zentraler
Stelle im Tempel, vermutlich dort, wo sich heute das Barkensanktuar des
Philipp III. Arrhidaios befindet. Französische und ägyptische Archäologen
rekonstruierten 1997 das Heiligtum anhand zahlreicher Originalblöcke im Freilichtmuseum
in Karnak. Die Blöcke aus Quarzit verleihen dem Gebäude die rötliche Farbe.
Der dunkle Diorit wird demgegenüber wie ein schwarzer Rahmen. Es wurden von
der unter Thutmosis III. abgerissenen Roten Kapelle rund 322 Blöcke zwischen
1898 und 1990 wieder entdeckt. So entdeckte Georges Legrain erste Blöcke der
"Kapelle" bei seinen Restaurierungsarbeiten im 3. Pylon des
Amun-Re-Tempels von Karnak. Diese Quarzitblöcke waren damals offensichtlich
als "Füllmaterial" für den Pylon wiederverwendet worden. Aufgrund
ihrer rötlichen Färbung erhielt der bau von den französischen Archäologen
die Bezeichnung "Chapelle Rouge" (Rote Kapelle) - als Gegenstück
zur "Chapelle Blanche" (Weiße Kapelle) des Sesostris I., die aus
hellem Kalkstein errichtet war. Pierre Lacau und Henri Chevrier
veröffentlichte 1977 einen ersten Rekonstruktionsvorschlag (7).
Die gefundenen Blöcke wurden
von der "Centre franco-égyptian d'etude des temples de Karnak (=CFEETK)"
unter der Leitung von Nicolas Grimal und Francois Larché (The Reconstruction
of the So-called "Red Chapel of Hatshepsut & Thutmosis III in the
Open Air Museum at Karak, kmt, Vol. 10, Nr. 4, 1999-2000) umfassend
untersucht, wobei die Erfassung der architektonischen Details jedes einzelnen
Blocks schließlich zu dem Wiederaufbau - unter Verwendung der Originalblöcke
und mit Ergänzungen mit Quadern aus Stein und Beton führte (wodurch
zusammengehörige Szenen erstmals wieder miteinander verbunden wurden), der 20
Jahre später durch ein französisch-ägyptisches Team der Centre
Francó-Egyptien unter Mitwirkung von den Steinmetzen des CNRS Franck Burgos
und dem Architekten Francois Larché durchgeführt und 2001 abgeschlossen war
und 2006 ausführlich publiziert wurde (7).
|
Die Rote Kapelle - (Nordseite) mit den Fragmenten
von zwei Standartenträgerstatuen
(Sethos II.) vor dem Eingang |
| Seit kurzem stehen vor dem Eingang der Roten Kapelle
die schwer beschädigten Fragmente von zwei Stabträgerstatuen König
Sethos II. aus Sandstein, von denen sich nur die untere Hälfte (bis
zur Hüfthöhe) erhalten haben. Bis dahin standen diese Fragmente im
1. Hof des Karnaktempels vor dem nördlichen Turm des II. Pylons. |
|
Bild mit frdl. Dank Saamunra |
Die Rote Kapelle war
ursprünglich 17,54m lang, 6,17m breit und 5,64m hoch. Bei der Rekonstruktion
der Kapelle zeigte sich, dass fast alle Reliefszenen jeweils nur über einen
Steinblock lang waren - äußerst selten auch horizontal über zwei Blöcke.
Die Steinblöcke, die in "Ziegelbauweise" verlegt waren, waren
einheitlich groß und ähnelten den Talatat von Echnaton, so dass der Bau
relativ einfach war - demzufolge auch der Abbau unter Thutmosis III. Der Rote
Quarzit kam aus den "Roten Bergen" von Djebel Akhmar - nahe bei
Heliopolis).
Die Kapelle hat drei Durchgänge
mit der gleichen Größe und lagen alle auf einer Ebene. Alle Durchgänge
wurden durch zweiflügelige Tore verschlossen, die sich nach innen öffneten
(Quelle Arnold, Lexikon der Ägyptologie, 2000) (7).
|
Eingang Westseite der Roten Kapelle - Türsturz |
| Die Torpfosten und der Türsturz waren
aus Grano-Diorit gearbeitet und die wenigen erhaltenen Inschriften
zeigen nur die Namen (Thron- u. Geburtsname) von Thutmosis III sowie
die üblichen Epitheta. |
Bild: Courtesy Elvira
Kronlob 2019
- alle Rechte vorbehalten -. |
Da bei dem Tod von Hatschepsut
die Rote Kapelle noch nicht vollendet war, führte Thutmosis III. nach der
Übernahme seiner Alleinherrschaft den Bau zunächst in seinem Namen zuende.
Er ließ jedoch an der Nordfassade das 8 (und oberste) Register undekoriert
und die Hohlkehle ohne Palmetten. Irgendwann um sein 40-42. Regierungsjahr
ließ Thutmosis jedoch - aus bislang ungeklärten Motiven - die Rote Kapelle
wieder abreißen. Vielleicht weil er vorhatte, im Zentrum des Karnak-Tempels
größere Umstellungen vorzunehmen. Die Abtragung der Roten Kapelle wurde mit
äußerster Sorgfalt ausgeführt, das zeigt der hervorragende Zustand der
gefundenen Blöcke (7).
Thutmosis ersetzte dann die Rote
Kapelle durch eine eigene Kapelle aus Granit, welche erst Philipp III.
Arrhidaios Jahrhunderte später erneut umbauen ließ und die noch heute steht.
Nach der Entfernung der Torpfosten aus Diorit, welche bereits die Namen von
Thutmosis III. trugen, wurden diese für seinen Neubau im Zentrum des
Amun-Re-Tempels wiederverwendet. Das Osttor wurde in der Nordwand des
Korridors des Annalensaals und das westliche Tor des Vestibüls im südlichen
Tor des VI. Pylons ein- und umgebaut (siehe Franck Burgos, Francois Larché:
La chapelle Rouge, Paris 2008, S. 11). Die Namen und Darstellungen der
Hatschepschut wurden ausgemeißelt, wohl erst nach dem Abbau der Kapelle.
Viele der Blöcke wurden später auch von Amenophis III. als Fundament für
seinen III. Pylon in Karnak (7).
|
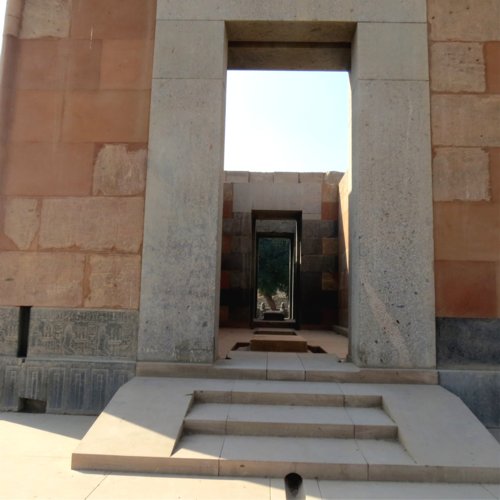
|
Treppe mit 6 Stufen -
Eingangsportal
Blick durch die Durchgänge ins Innere
- mit dem Podestsockel im Sanktuar (vorne) -g
Auf der Nordseite des Eingangsportals
führt eine Treppe ins Innere des Gebäudes, das sich in zwei gepflasterte
Innenräume gliedert - das Vestibül und das Sanktuar.
Eine schmale Abflussrinne, die zur
Aufnahme des Wassers, das zur rituellen Reinigung im Sanktuar genutzt
wurde, führte um die östliche Basis eines Podestsockels im Inneren und
durch die östliche Tür nach draußen.
Bild: Elvira Kronlob 2019
- alle Rechte vorbehalten - |
|
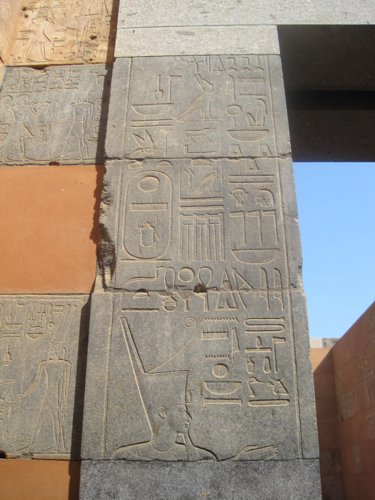
|
Innenwand des östlichen Tors des
Vestibüls
Es wurden einige Blöcke aus mehreren
Registern - des rückwärtigen Tores des Vestibüls gefunden und in die
Torumrandung wieder eingebaut.
Links neben dem Türpfosten
befinden sich ebenfalls Blöcke aus Diorit: ganz oben: Block aus rotem
Quarz - Thutmosis (Men-cheper-Re) mit Perücke und Uraeus, opfert
Weihrauch vor Amun-Re. Darunter Block aus rotem Quarzit - Hatschepsut -
hier mit runder Perücke, Uraeus, opfert 2 "sat"-Brote vor dem
ithypallischen Amun-Re, König der Götter.
Unten: Thutmosis III (Men-cheper-Re) hier mit Perücke, Reif und Uräus
opfert 2 Gefäße mit Milch an Amun-Re.
Die Blöcke auf der Südseite des
Tores (Rückseite des Vestibüls), auf dem linken Türpfostens, zeigen -
ebenso wie auf dem rechten Türpfosten - unterhalb der Kronengöttin
Nekhbet "die alles Leben gibt", in zwei Spalten den
Horusnamen und den Thronnamen von Thutmosis III. (links). Darunter die
obere Hälfte einer Darstellung des Königs (Thutmosis III.) mit der
unterägyptischen Krone (auf dem rechten Torpfosten mit der
oberägyptischen Krone) und einer Weiheformel.
Darunter befindet sich auf dem rechten Torpfosten der Name des Tores:
".....das Ma[chen] für ein Tor [namens] "Maat-ka-Ra -
(geändert auf Men-cheper-Ra) mit dauerhafter Gunst bei Amun (lt.
Grallert 2001 - Bauen-Stiften-Weihen) - hier
links fehlt der entsprechende Block. |
|
Bild: Courtesy to Elvira Kronlob
- alle Rechte vorbehalten - |
Eine Treppe mit sechs Stufen
führt zum Eingangsportal auf der Nordseite des Gebäudes. Dieses gliedert
sich in zwei gepflasterte Innenräume: das Vestibül und das dahinter
liegenden Sanktuar, das ursprünglich durch eine Tür abgetrennt war und auf
der Ostseite einen weiteren Zugang hatte. Auf der Innenwände befinden sich 8
Bild- und Textregister. Im Vestibül (Opfertischsaal) fanden die täglichen
Opfergaben und Opferrituale statt. Die Opfergaben wurden offenbar mit Wasser
besprengt, da rechts und links des Hauptportals im Boden seitliche Abflussrinnen
wegführten. In der der Mitte befand sich eine 1,30m x 0,80m
große und 0,50m tiefe Dioritwanne, die ein Dekor aus Lattichpflanzen trägt.
Evtl. hatte sie als Lattichpflanzbecken gedient (?).
Im Sanktuar ruhte die Barke des
Amun-Re auf einem als Kapelle gestalteten Sockel, von dem heute nur noch ein
0,20m hoher Quarzitblock erhalten ist, der ebenfalls mit einem Lattichfries
geschmückt ist. Er bildete einst das Podest für den heute verlorenen
Barkensockel und ist von Abflussrinnen umgeben (7).
|

|
Dioritbecken aus dem Vestibül
Dieser ausgehöhlte Block wurde 1995 -
auf der Ostseite von Karnak - in einem Loch vor dem Tor des Tempels
"Osiris von Koptos" gefunden und die Ägyptologen ordneten ihn
- aufgrund verschiedener Merkmale - der Roten Kapelle zu (siehe Larché
1999-2000). Larché vermutet, dass dieser Block bereits in der Antike
bei seiner Zweitverwendung ausgehöhlt wurde - ursprünglich aber
vielleicht ebenso wie die beiden anderen Socke im östlichen Teil der
Roten Kapelle entweder als Opfertisch oder Podest für die Barke diente.
Auf der Westseite des Diorit-Blocks
steht der Thron- und Geburtsname von Königin Hatschepsut. Die beiden
Schmalseiten sind mit einem Lattichfries verzieht.
Bild: Courtesy to Elvira Kronlob
- alle Rechte vorbehalten - |
|
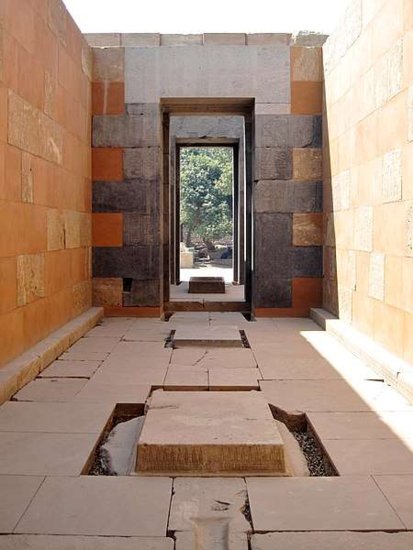
|
Blick ins Sanktuar der Kapelle
mit Podest für den Sockel der Amun-Re-Barke
Um die beiden Podestsockel im Sanktuar
der Roten Kapelle verläuft jeweils eine Rinne, die zur Aufnahme des
Wassers für die rituelle Reinigung während der Kulthandlungen diente.
Von der Rinne um die östliche Basis führte ein Ablauf-Kanal (vorne im
Bild) durch die östliche Tür nach draußen (siehe obiges Foto).
|
|
Bild: Karnak
Rote Kapelle 15
Author: Olaf Tausch, Wikipedia, 4.3.2011
Lizenz: CC
BY 3.0
|
|
Rückseite (Ostseite) der Roten Kapelle |
| Beim Wiederaufbau der Kapelle im Open Air Museum
wurde sie - im Vergleich zum ursprünglichen Standort um ca. 90°
gedreht - aufgebaut. Das bedeutet, dass der Haupteingang, der original
nach Westen zum Nil hin ausgerichtet war, heute südwärts zum Luxor
Tempel zeigt.
Die Fassade auf der Ostseite ist 5,77m hoch und damit etwas
höher als die Kapelle selber. |
|
Bild: Courtesy to Heidi Kontkanen, Finnland
- alle Rechte vorbehalten - |
An den Außenwänden der Kapelle wurden die
Darstellungen in unterteilte Themengebiete (Register) angebracht. Die meisten
Bilder zeigen Hatschepsut alleine oder zusammen mit Thutmosis III bei
verschiedenen rituellen Handlungen.
-
Register: Gaue mit
Tempelnennungen - Ritualpalast der Hatschepsut, Tempel der Mut,
Totentempel von Thutmosis 1 und Totentempel von Thutmosis III.
-
Register: Göttliches Orakel
- Prozessionen
-
- 5 Register: Opetfest und
Talfest - Prozessionen mit Fahrten nach Luxor, Deir el Bahari und zurück
6.
Register: Opfergaben mit Vorbereitungen der Krönung - Opfer an die Neunheit
von Heliopolis
7. Register: Krönungsakt - Übergabe der Krone
8. Register: Zeremonien mit Thutmosis III.
(Quelle: Dieter Arnold: Lexikon
der ägyptischen Baukunst 2000 und die Tempel Ägyptens, 1992)
|
Details auf einem Block der Roten Kapelle im
Karnaktempel
Großes Festopfer vor dem Sanktuar des Amun-Re in Djeser-Djeseru
in Deir el Bahari
- Thutmosis III. (hinten) und Hatschepsut beim Weihen der Opfergaben -
Über den Köpfen von Thutmosis III. und Hatschepsut befinden sich
ihre Kartuschen. |
| Zur Zeit von Hatschepsut war das letzte Ziel der
Prozession ihr Millionenjahrhaus in Deir el Bahari. Nach der
Errichtung seines eigenen Totentempels in Deir el Bahari dürfte
dieser als letzte Station beim Talfest gedient haben (7). |
|
Bild: Markh, englische Wikipedia, 2005, public
domain |
|
Block auf der Nordwand der Roten Kapelle
- Das schöne Fest vom Wüstental - Rückkehr von Deir el Bahari nach
Karnak -
- Vor der Barke Hatschepsut, die 4 Kästen weiht - hinter ihr
Thutmosis III, der weihräuchert - |
| Diese Darstellung zeigt rechts die Barke
des Amun-Re in der "Großen Festhalle" des Karnak-Tempels,
die von den Priestern auf ihren Schultern getragen wird (die Inschrift
befindet sich rechts oberhalb der Barke).
Die Barke ist an ihrem Bug und Heck mit
einem Widderkopf dekoriert und jeder der Köpfe trägt einen Uräus,
der in einem Gehörn eine Sonnenscheibe trägt. Auf der Barke befindet
sich ein Naos, in dem sich unter einem Baldachin eine Götterstatue
befindet. Der Naos ist teilweise mit einem Schleier verhüllt, der von
Geierflügeln gehalten wird.
Auf einem Schlitten montiert sind links davon 4 Kästen zu
sehen, die mit Straußenfedern dekoriert sind (die Federn der
"Maat") - von denen aber nur 3 zu sehen sind. Auf der linken
Seite steht die Königin Hatschepsut, die die Kästen für den Gott
Amun-Re weiht. Hinter ihr befindet sich ihr Stiefsohn und Mitregent
Thutmosis III, der für Amun-Re ein Räucheropfer darbringt (die
Beischrift dazu befindet sich unter seinen Händen.
In einer verkleinerten Darstellung sieht man auf dem vorderen
Teil der Barke die Besatzung - hinter dem Kopf des Widders stehen eine
Göttin, die ein Hathor-Gehörn mit Sonnenscheibe trägt, daneben oder
dahinter die Göttin Maat mit der Feder auf dem Kopf. Hinter
beiden Göttinnen folgt ein Königssymbol auf einer Standarte - ein
Sphinx mit Menschenkopf, Doppelfederkrone und dem Götterbart.
Es sind aber noch weitere Figuren auf der Barke zu erkennen, die
sich dem Götterschrein zuwenden:
- eine Königsgestalt, die wohl ein "nemes-Kopftuch" trägt
und zwei "nun"-Gefäße vor einem Naos opfert (vermutlich
Wein).
- vor dem Naos kniet eine weitere Figur, die wohl die Baldachin-Stangen
festhält -
(Quelle: 2). |
Bild Courtesy to 4U
- alle Rechte vorbehalten - |
|
Opferszene an Nordwand der Roten Kapelle
- Thutmosis III. opfert vor der Göttin Nut - |
| Der Block aus rotem Quarzit zeigt
Thutmosis III., "den Herrn der Beiden Länder,
Men-cheper-Ra" beim Opfern von zwei "Sot-Broten" (lt.
Beischrift "unter den Händen") an die Göttin Nut, die
"Herrin des Himmels (links). Hinter dem König ist sein Ka
dargestellt, der hier irrtümlicherweise den Horus-Namen von
Hatschepsut trägt (2). |
Bild Courtesy to 4U
- alle Rechte vorbehalten - |
| Umbau der sog.
"Wadjet-Halle" |
Thutmosis III. ließ
den Hypostylsaal (sog. Wadjet-Halle) seines Großvaters Thutmosis I. völlig
umbauen. Dieser zweiteilige Säulensaal wurde unter Thutmosis I. errichtet und
von seiner Tochter Hatschepsut umgestaltet. Von ihr stammen auch u. a. die
zwei Obelisken aus Rosengranit, von denen einer noch in situ erhalten
ist.
Thutmosis III. ersetzte die
zentrale Reihe von Holzsäulen und das Holzdach aus der Zeit von König
Thutmosis I. in der Halle durch eine Doppelreihe wuchtiger Papyrussäulen aus
Sandstein, um den Saal mit einem Steindach überdecken zu können. Die Osiris-Pfeiler
von Thutmosis I. wurden mit einer "Zungenmauer" umgeben, um den
Eindruck von Statuen-Nischen zu erwecken. In diesen Nischen ließ Thutmosis
III. die von seinem Großvater an den Innenseiten der Wände der
Umfassungsmauer des Tempels der 12. Dynastie aufgestellten Osirisstatuen
aufstellen, wo sie noch heute zu sehen sind. Gleichzeitig erhielten die freien
Flächen der Wände zwischen den Nischen eine Dekoration, die aus
Reliefschmuck und der königlichen Titulatur besteht.
Im Zuge dieser Baumaßnahmen
wurden auch die beiden Obelisken (mit einer Höhe von 30,70m), welche Königin Hatschepsut hier hatte aufstellen lassen, bis zu einer
Höhe von 20,13m durch eine Ummantelung eingemauert, so dass sie nicht mehr
sichtbar waren, aber von außen noch immer das Tempelhaus überragten. Sie
dienten zugleich als Torbau zu den dadurch entstandenen neuen Kammern. Beide Türen
im Norden und im Süden tragen Bauinschriften von Thutmosis III. Zwei weitere
Obelisken ließ Thutmosis III. anlässlich seines Sed-Festes unmittelbar vor
den Obelisken seines Großvaters Thutmosis I. am Eingang des Zentralheiligtums
(IV. Pylon) aufstellen (siehe weiter oben Hof zwischen III. und IV. Pylon)
aufstellen. Amenophis III. ließ diese dann für den Bau seines III. Pylons
entfernen (siehe Thomas Kühn: Zu Ehren Amuns - die Bauprojekte Thutmosis III.
in Karnak / Kemet, Bd. 10, Nr. 3, Berlin 2001, S. 34).
|
Oside Statuen zwischen den Mauern mit
Darstellungen in der Wadjet-Halle
|
| In den Nischen ließ Thutmosis III. die osiden
Statuen, die von Thutmosis I. an den Innenseiten der Wänden der
Umfassungsmauer des Tempels der 12. Dynastie aufgestellt wurden,
versetzen.. Auf dem Wandstück zwischen zwei Nischen ist eine
Darstellung zu erkennen, in welcher der König von Amun (?) umarmt
wird (?).
|
|
Bild: mit frdl. Dank Saamunra (2012)
- alle Rechte vorbehalten -
|
Bislang
ist die Wissenschaft davon ausgegangen, dass Königin Hatschepsut zwei
Obeliskenpaare hat aufstellen lassen. Wenn man Larché (Cahiers de Karnak
XIII, 2010) folgt, haben die Untersuchungen der Fragmente der Obeliskenpaare
von Thutmosis I. und II. vor dem IV. Pylon ergeben, dass die vier Basen beider
Obeliskenpaare auf einem gemeinsamen Fundament nördlich und südlich der
Tempelachse errichtet wurden. Die westlich davon errichteten Obelisken von
Thutmosis III. standen dagegen auf einem eigenen Fundament. Bei den
Untersuchungen der Steinlagen wurde dann klar, dass die beiden Fundamentpaare
für die Obelisken von Thutmosis I. und II. gemeinsam errichtet worden sein
müssen. Larché geht davon aus, dass Thutmosis I. zwar seine Steinmetze
beauftragt hatte, die beiden Obelisken in Assuan zu schlagen, aber nicht mehr
dazu gekommen war, diese im Karnak-Tempel aufstellen zu lassen. Dieses geschah
dann unter seiner Tochter Hatschepsut, welche die Obelisken ihres Vaters
aufstellen ließ und auf der Westseite zwei weitere Obelisken, die mit dem
Namen ihres Gemahls Thutmosis II. und ihren eigenen Thronnamen dekoriert
wurden (2).
Thutmosis
III. ließ dann später während seiner Alleinherrschaft auf beiden Obelisken
von Thutmosis II./Hatschepsut den Thronnamen seiner Vorgängerin durch den
Namen seines Vaters ersetzen. Amenhotep III. ließ später das Obeliskenpaar
von Thutmosis II./Hatschepsut und das westlich davon errichtete Paar von
Thutmosis III. abbauen, um Platz für den heutigen III. Pylon zu erhalten.
Beide Obeliskenpaare wurden dann "irgendwo im Tempel des Amun-Re
gelagert" - wobei diese wohl in der Amarna-Zeit nicht zugänglich waren,
denn ihre Amun-Darstellungen sind unbeschädigt - im Gegensatz zu den
Obelisken von Thutmosis I. und Hatschepsut.
An der Ostseite des
Amun-Re-Tempels ließ Hatschepsut ihr erstes eigenes Obeliskenpaar
aufstellen. Am originalen Aufstellungsort befinden sich heute nur noch Teile
der zerstörten und unbeschriebenen Basen und der Fundamente. Im Ägyptischen
Museum in Kairo (altes Museum am Tahir-Platz) befindet sich die erhaltene
Spitze (das Pyramidion), wo diese im Garten des Museums aufgestellt ist - in
Karnak unweit des ursprünglichen Standortes der Obelisken befindet sich das
Pyramidion des zweiten, südlichen Obelisken. Die Figur der Hatschepsut wurde
ausgemeißelt und ebenso wie auf der Spitze des ersten Obelisken durch
Opfertische ersetzt. Auch die Darstellung des Amun wurde unter der Regierung
von Thutmosis III. geändert: anstatt der Krone, welche er Hatschepsut reicht,
hält er jetzt lt. Habachi (Habachi, 2000) ein Szepter und ein Anch-Zeichen.
Während der Amarna-Zeit wurde die Darstellung des Amun zerstört und in
ramessidischer Zeit wieder hergestellt und durch eine Restaurationsinschrift
auf seinem Blockrest belegt.
|

|
Pyramidion eines der beiden 1.
Obeliskenpaares
- heute im Garten des Ägyptischen Museums (Tahir-Platz) -
Die Figur der Hatschepsut wurde ausgelöscht -
wahrscheinlich noch unter Thutmosis III - und ebenso wie auf seinem
Gegenstück - und durch Opfertische ersetzt. Die Figur des Gottes wurde
umgearbeitet - anstatt der Krone, die er orginal an Hatschepsut
überreicht, hält er jetzt ein Szepter und ein Anch-Zeichen.
Während der Amarna-Zeit wurde die Darstellung des
Amun zerstört und in ramessidischer Zeit wieder hergestellt und durch
eine Restaurierungsinschrift auf dem Sockel des Obelisken belegt. |
Bild:
Egyptian
Museum - Pyramidion in front
Autor: Daniel Mayer, Wikipedia 2008
Lizenz: CC
BY-SA 4.0 |
Hatschepsut ließ die
Säulenhalle von Thutmosis I. zwischen dem 4. und 5. Pylon umbauen und rechts
und links des Durchganges in ihrem 16. Regierungsjahr ihr zweites
Obeliskenpaar aus Rosengranit aufstellen. Heute steht nur noch einer der
beiden Obelisken, der zweite ist umgestürzt und zerbrochen - sein oberer Teil
lag auf Betonblöcke in der Nähe am Heiligen See. In neuerer Zeit wurden die
Fragmente vor Ort wieder aufgerichtet. Der
aus dem rosafarbenen, aus Assuan geholte Obelisk aus Granit ist nach der
Restaurierung nun 11 m hoch und 90 Tonnen schwer. Er zeigt Hatschepsut in
verschiedenen Darstellungen vor dem Gott Amun-Re.
Der noch "aufrecht
stehende" Obelisk des zweiten Paares der Hatschepsut (H. 28,48m - Gewicht
323 t) wurde später bei der Umgestaltung der Wadjet-Halle (Überdachung)
unter Thutmosis III. eingemauert - aber sonst nicht weiter beschädigt. In der
Amarna-Zeit drang man bis zur Obeliskenspitze vor und entfernte die
Elektrumverkleidung und zerstörte die Reliefs. Gut zu erkennen ist durch die
etwas dunklere Färbung des unteren Teiles, bis zu welcher Höhe der
Obelisk durch Thutmosis III. eingemauert war.
 |
Der
noch aufrecht stehende Obelisk von Hatschepsut
- unter Thutmosis III. bei der Umgestaltung der Wadjet-Halle
(Überdachung) eingemauert -
Gut zu erkennen ist aufgrund der etwas dunkleren
Farbe auf dem Bild bis zu welcher Höhe der Obelisk bei der Umgestaltung
der Wadjet-Halle eingemauert war. |
|
Bild: Luxor,
Luxor City
Autor: EliziR, Wikipedia 2014
Lizenz: CC
BY-SA 3.0
|
Gefundene Statuen in
der Wadjet-Halle:
-
zerbrochene
Sitzstatue Thutmosis I. aus Alabaster
-
Fragmente einer
Sitzstatue Thutmosis III. aus grüner Breccia
-
Statue Thutmosis
III. aus Granit als Nilgott - mit Opfertafel, darauf Gänse, Gaben und
Wachteln am Unterteil - (Kairo JE 42056)
-
Kolossale
Kniestatue aus Granite von Thutmosis III. mit Opferaltar
-
Beschädigte Statue
von Thutmosis IV. aus Granit - Kairo JE 43611
-
Fragmente einer
Kolossalstatue von Amun-Re und Mut, repräsentierend König Haremhab und
seine Gemahlin Mutnodjmet, gefunden 1895 nördlich des Obelisken E - heute
im Museum Kairo 6.11.26.8.
-
Doppelstatue von
Amun-Re und Mut (kleine Kopie der oben beschriebenen) gefunden in der
Nähe des Obelisken F (heute in Kairo JE 39213)
V. Pylon - erbaut von Thutmosis I.
- dekoriert von Thutmosis III. u. a. - |
Der V. Pylon
wurde unter Thutmosis I. erbaut und trug den Namen: "Amun, Groß an
Ansehen" (Amun, Great - leider blieb nicht viel davon erhalten. Er ist
heute eine beinahe formlose Anhäufung von auseinandergefallenem Baugestein.
Das teilweise erhalten gebliebene Mitteltor stürzte bei der großen
Überschwemmung von 1865 ein. Eine Statue von Amenophis III. befindet sich vor
dem linken Pylonturm.
Der Pylon wurde unter
Thutmosis III. und Amenophis III. verändert. Er diente unter Thutmosis III.
als Eingang zu einer weiteren, heute stark zerstörten Querhalle.
Thutmosis III. ließ im Zentrum zu beiden Seiten eines Granittores Trennmauern
einziehen, wodurch der V. Pylon mit dem VI. Pylon verbunden wurde. Dadurch
wurden zu beiden Seiten der Tempelachse je zwei kleine Säle geschaffen.
Ein erst unter
Hatschepsut erschaffenes Barken-Sanktuar - das von ihr um den V. Pylon herum
erbaut wurde (siehe weiter oben: Neubau des zentralen Barkensanktuars) - wurde
abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Ein kleines Vestibül wurde vor dem
Sanktuar errichtet. Zwei Pfeiler aus Granit, auf denen jeweils die
Wappenpflanzen von Ägypten (im Norden die Papyrusstaude von Unterägypten und
im Süden die Lotusblume für Oberägypten) zu sehen sind, trugen das Dach
dieses Vorbaus.
|
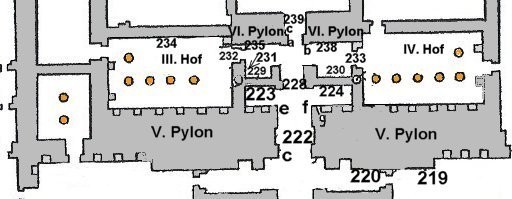
|
Plan der Bauten und Nennungen Thutmosis III.
- rund um den V. Pylon und den Höfen III. und IV.
Plan nach Porter & Moss, Plan X
- bearbeitet von Nefershapiland - |
PM 219 südlicher Pylonturm,
Reste Darstellungen Thutmosis III. in Begleitung eines Löwens beim
Erschlagen der Feinde u. Namensringe von Besiegten
PM 220 Reste des Min-Festes Thutmosis III. mit Fächerträgern,
Priestern mit Statue des Min und König begleitet von seinem Ka
PM 222c linker vorderer Türpfosten innen: an der Basis Torname von
Thutmosis III.; e-f linker u. rechter hinterer Torpfosten von
Thutmosis III: König in Begleitung seines Kas beim Weihen von
Opfergaben, zwei Zeilen mit heb-sed-Text
Südlicher Pfeilerhof:
PM 233 - Zugangstor in den Hof VI und Türsturz Nordseite mit
Doppelszene: Sethos II kniend, erhält Leben von Amun-Re;
Thutmosis III. beim Weihen, an der Basis der Torname
VI. Pylon aus Sandstein
PM 234 - Seitenwand nördlich des VI. Pylons
- Thutmosis III. in Begleitung seines Kas, weiht Opfergaben mit einer
langen Opferliste vor [Amun-Re]
PM 235 - Nordflügel des VI. Pylons
[Thutmosis III.] beim Erschlagen der Feinde, darunter 5 Reihen von
Namensringen von besiegten Feinden.
PM 238 - Südflügel des VI. Pylons/unter Teil von Szenen:
- Thutmosis III. beim Erschlagen der Feinde - darunter 5 Reihen von
Namensringen von besiegten südlichen Feinden.
Tor des VI. Pylons - PM 239
PM 239a-b Block des granitenen Türsturzes vor dem Nordflügel des
Pylons liegend: Thutmosis III. in Anbetung vor Amun-Re in der 9.
Stunde des Tages
PM 239 - beide Türpfosten mit je 3 Registern, teilweise zerstört:
a. links: Register III. Thutmosis III: mit Formel vor Amun-Re
- an der Basis Weihetext -
PM 239b - rechts: Register I. - zerstört, II. Thutmosis III. mit
Atef-Krone auf dem Haupt mit Spitzschurz vor Amun-Kamutef.
|
Bauten und Höfe zwischen V. und VI. Pylon (angelegt durch
Thutmosis III.)
PM 223 linke Wand (bei PM als Türpfosten bezeichnet) aus Granit
mit zwei Registern: 1. Thutmosis III. opfert vor Amun-Re
2. Thutmosis III. geleitet von Atum zu Amun-Re mit Renovierungstext
von Sethos I.
PM 224 - rechte Wand: wie bei PM 223 nur dass der König von Month
geleitet wird.
PM 228a+b Türdurchgang: äußere Türpfosten: Thutmosis III. opfert
Brot vor Amun-Kamutef; Thutmosis III. erhält Leben, Dauer u.
Herrschaft von Amun-Re
PM 229-230: Westwände der beiden Räume: 2 Textkolumnen mit
Weihetexten Thutmosis III. und Spruch des Amun-Re
PM 231: im nördlichen Raum eine Sitzstatue von Amenophis II.
- siehe Pfeil auf dem obigen Plan -
Nördlicher Pfeilerhof
PM 232 Türdurchgang zum nördlichen Pfeilerhof und innerer
Türsturz - rechte Hälfte zerstört - mit Doppelszene: links
Thutmosis III. wird von Amun-Re umarmt und erhält Leben von Amun-Re
rechts: Thutmosis III. wird von Month umarmt und erhält Leben von
Amun-Re, Türpfosten: Thutmosis III. beim Weihen, darunter der
Torname.
|
|
Im Vordergrund: Tordurchgang (äußere Torpfosten) ins kleine
Vestibül
vor dem VI. Pylon - dahinter Tordurchgang VI. Pylon.
(PM² II 86 [228a+b] ) (PM 239a-b)
- dahinter die Barkenkapelle des Phillipp Arrhidaios - |
Auf dem nördlichen Torpfosten
(links: PM 228a) steht der König (Thutmosis III.) mit der
unterägyptischen Krone im I. Register vor einer Statue des
Amun-Kamutef und opfert Brot. Im II. Register (unten) erhält er Leben
von Amun-Re.
Auf der Basis steht ein Weihetext mit dem Namen des Tores
(überarbeitet in ptolemäischer Zeit).
Auf dem südlichen Torpfosten (rechts) PM
228b) sind die Darstellungen gleich - nur trägt hier der König die
oberägyptische Krone. |
Bild: Barkenkapelle
des Phillipp III. Arrhidaios
Autor: Olaf Tausch, Wikipedia 2019
Lizenz: CC
BY 3.0 |
Die Sandstein-Türpfosten des
"Vorzimmers" tragen zwar die Namen von Thutmosis III. - wurden aber
erst in der ptolemäischen Periode hergestellt. Diese bilden einen Absatz in
der Wand aus Rosengranit. Der König trägt im Norden die rote und im Süden
die weiße Krone Ägyptens.
Thutmosis III. schreibt in
seiner Beischrift, dass er einen "erhabenen" Pylon (Pylon VI.)
errichten ließ, der zwischen dem Pylon (V. Pylon) und dem Tempel der
Hatschepsut errichtet wurde. Er teilte den Raum zwischen dem heutigen V. Pylon
und dem VI. Pylon neu auf und ließ anstelle der Kolonnaden seines Großvaters
Thutmosis I. (die er abreißen ließ) eine Mauer aus Granitblöcken errichten
und bildete damit ein nach Norden und Süden geschlossenes Vestibül, das den
Zugang zum VI. Pylons ermöglichte.
|
Linker und rechter Torpfosten und Wand des
Tordurchgangs zur Vorhalle des VI. Pylons |
Linke Wandseite neben dem Durchgang:
(PM II² 86 [228a+b] ) Äußerer Türposten mit zwei Registern:
-siehe Bild oben -
links davon an der Wand: (bei PM als Türpfosten beschrieben)
(PM II² 86 [223] ) mit fast identischen Szenen wie auf der rechten
Wandseite (siehe Bild rechts): I. Thutmosis opfert an Amun-Re
II. Register: der König wird von Atum zu Amun-Re geleitet
- vor dem
König ein Renovierungstext von Sethos I. |
Rechte Wandseite neben dem Durchgang:
(PM II² 86 [224] in zwei Register
(identisch mit PM 223 - außer mit dem Gott Month anstelle von Amun-Re
- auch hier befindet sich ein Renovierungstext von Sethos I.
-
|
|
Beide Bilder: mit frdl. Dank Saamunra
- alle Rechte vorbehalten - |
|
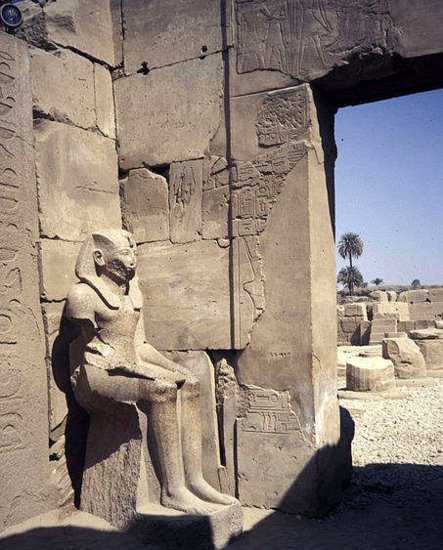
|
Durchgang zum III. Hof
Sitzstatue von Amenophis III. vor dem
Durchgang (PM² 87 [231]
in den Hof III.
Auf der linken Seite (in der
nordwestlichen Ecke vor dem VI. Pylon) des nordwestlichen
"Vorraumes" ist eine Sitzstatue von König Amenophis II. (des
Sohnes von Thutmosis III.) zu sehen.
Auf der Wand dahinter und auf dem
Türpfosten des Durchgangs, befinden sich Inschriften, u. a. eine
Widmungsinschrift Thutmosis III. für seinen Vater "Aa-Cheper-ka-Re"
(Thutmosis I.). Thutmosis III. bezeichnet hier seinen Ahnen (Großvater)
Thutmosis I. (der hier vor ihm eine Kolonnade bauen ließ) als seinen
"Vater", um ihn zu ehren.
Die rechte Wandseite und der westliche
Torpfosten rechts der Statue sind heute stark zerstört. Reste einer
Darstellung Thutmosis III. mit der roten Krone Unterägyptens auf dem
Kopf und dem Tornamen auf der Basis unten, sind erhalten.
Bild: Karnak
precint of Amun-Re
Autor: H. Grobe 1987 - wikipedia
Lizenz: CC
BY 3.0 |
Der südliche (rechte)
"Vorraum" (PM² II. 86 [230] ist fast identisch mit dem
nordwestlichem Vorraum vor dem VI. Pylon. Auch hier befindet sich an den
Wänden ein Weihetext von Thutmosis III. für seinen "Vater"
Thutmosis I. Hier befindet sich aber keine Statue in seinem Inneren.
Nördlicher und
südlicher Pfeilerhof: (Hof III. und IV.)
Auf dem Türsturz des Durchgangs zum
nördlichen Pfeilerhofes befindet sich eine Doppelszene (rechte Hälfte
der Doppelszene ist lt. PM II² 87 [232] zerstört - links: Thutmosis III. wird von Amun-Re
(Month is der rechten Hälfte) umarmt und erhält Leben von Amun. Auf dem
Türpfosten ist Thutmosis III. in einer Weiheszene zu sehen - auf der Basis
befindet sich der Torname.
|
Blick in den III. Hof (Nördlicher Pfeilerhof) |
| Blick von Norden in den nördlichen Pfeilerhof III
von Thutmosis III. An der linken Wandseite des Hofes (bei PM:
Westfassade - Nordhälfte des VI. Pylon / PM² II. 88 [234-235] )
befinden sich Darstellungen der Schlacht von Megiddo: der König mit
seinem Ka, weiht Opfergaben und eine lange Opferliste. Dahinter (PM
235) der König beim Erschlagen der Feinde und 5 Reihen mit den
nördlichen Namensringen der besiegten Städte. Auf der rechten Seite
des Bildes die restlichen Mauern des V. Pylon und davor der untere
Teil der osiden Statuen.
Die nördliche Rückwand des Pfeilerhofes ist heute nicht mehr
vorhanden. Nur noch drei Lagen Steine des rückwärtigen Durchgangs in
den anliegenden Raum sind zu sehen. |
|
Bild: Luxor,
Luxor City
Autor: EliziR, Wikipedia 2014
Lizenz: CC
BY-SA 4.0 |
Südlicher
Pfeilerhof: (Hof IV.)
Der äußere Türsturz (Nordseite) zum südlichen Pfeilerhof (links) zeigt
eine Doppelszene, in deren Mitte sich einst die Kartuschen von Thutmosis III.
(auf dem Zeichen für Gold) stehend befanden - bekrönt von der Sonnenscheibe
mit Doppelfedern und zwei Uräen. Links und rechts kniet der König in einer
antithetischen Szene - jeweils zwei Kugelgefäße opfernd - vor dem thronenden
Amun-Re, der ihm die Zeichen für Leben, Herrschaft und Dauer an die Nase
hält. Der Königsname in sämtlichen Kartuschen auf dem Türsturz wurde
später von Sethos II. für sich abgeändert.
Am rechten Türpfosten
ist König Thutmosis III. (hier wurden die Namen nicht verändert) mit der
Roten Krone und links mit der Weißen Krone dargestellt. Er hält jeweils in
der einen Hand einen Stab und die "weiße hedj-Keule" - die andere
Hand streckt er in Richtung Tor aus. An der Basis befindet sich der Name des
Tores.
|
Das Tor in den südlichen Pfeilerhof Thutmosis
III. (PM²II 87 [232] )
Blick von Norden auf den äußeren Türsturz
- Thutmosis III. (später usurpiert von Sethos II.) kniet vor dem
thronenden Amun-Re -
Auf dem Torpfosten, Thutmosis III. beim Weihen
des Tores und der Torname an der Basis. |
|
Bild: Courtesy to Elvira Kronlob 2023
- alle Rechte vorbehalten. |
Die südliche
Begrenzungsmauer
des Hofes IV. ist heute nicht mehr erhalten. Nur noch die
östliche Seitenwand mit den Fundamenten und zwei Reihen von Steinblöcken des
aufgehenden Mauerwerks sind erhalten. Große Teile davon der Dekoration
und zwei Textzeilen an der Basis stammen von Sethos II. und die untere
Textzeile von Ramses III. Im Hof befinden sich fragmentierte Osirisstatuen
(von einigen ist nur noch der Sockel erhalten), die einst an der Süd- und
Westseite des Hofes standen. Dazwischen befinden sich noch die Reste von 3
Säulen, die an den gleichen Seiten den Hof umstanden. Die Inschriftenkolumnen
(evtl. einst von Thutmosis III. ?) wurden durch Sethos II. usurpiert.
Nach
PM befand sich südlich des Zugangs von Hof IV - angebaut an der Außenmauer
des Tempels - eine Pfeilerhalle, die auf einer Sandsteinplattform stehend,
erbaut wurde. Sie ist also dem Hof IV. zugewandt - leider ist sie heute
zerstört. Erhalten haben sich davon Sandsteinblöcke mit Textfragmenten von
Thutmosis I. und Amenophis II.
|
Blick von Süden her in den Hof IV.
mit (Rückseite des Tores in das Vorzimmer) ganz rechts im Bild
(PM²
II 87 [233] ) |
| Die südliche Begrenzungsmauer des Hofes ist heute
nicht mehr vorhanden. Das Bild zeigt den Blick von Süden in den Hof
IV. mit dem Tor (PM 233) im Hintergrund. Auf der östlichen Mauer des
Hofes haben sich noch zwei Lagen Steine erhalten (leider keine von
Thutmosis III.). Auf der obersten Steinlage befindet sich eine lange
Erneuerungsinschrift von Sethos II. Darunter - in etwas größerer
Schrift - ein Textzeile mit den Kartuschen von Ramses III.
Links und rechts des Prozessionsweges befinden sich Fragmente
von Osirisstatuen und Reste von 3 Säulen, welche den Hof umstanden.
Die Inschriften auf den Osirisstatuen wurden wahrscheinlich durch
König Amenmesse und danach von Sethos II. usurpiert. Original sind
sie von Thutmosis I. und wurden von Thutmosis III. nach seiner
Umgestaltung des Komplexes versetzt. |
|
Bild: mit frdl. Dank Saamunra
- alle Rechte vorbehalten - |
VI. Pylon und Vestibül - erbaut von
Thutmosis III.
- aus Sandstein - |
Vom VI. Pylon,
der sich zwischen dem Hof von Pylon V. und dem "Palast der Maat"
befindet, ist
nur noch wenig erhalten. Das Tor des Pylons war aus Granit gefertigt und mit
Elektron bedeckt. Der kleine Pylon war 15,70 m lang, 4,20 m breit und nur
12,50 m hoch.
Die Dekorationen zeigen
Thutmosis III., bei der Anbetung des Reichsgottes Amun-Re. Den Hof hinter dem
VI. Pylon ließ Thutmosis III. in unterschiedliche Bereiche aufteilen. Nach
seinem 42. Regierungsjahr fügte Thutmosis III. eine Reihe von überdachten
Verbindungswänden zwischen dem VI. Pylon und dem "Palast der Maat"
hinzu - wodurch die südlichen und nördlichen Portiken abgetrennt wurden.
Zusammen mit diesem Anbau wurde dadurch (und in Verbindung mit Trennwänden
und dem Tor des Königs im Hof des V. Pylons und dem Tor um die Obelisken der
Hatschepsut in der Wadjet-Halle) ein schmaler Korridor vom "Festhof"
zum Heiligtum des Tempels geschaffen.
Im hinteren Teil des Hofes
V ließ Thutmosis III. den Quarzitschrein,
den Königin Hatschepsut (Lacau,
Chevrier 1977) dort aufgestellt hatte (die Rote Kapelle der Königin
Hatschepsut) nun gegen Ende
seiner Regierungszeit versetzen und ersetzte ihn durch
seinen eigenen Schrein
aus Granit. Dieses neue Barkensanktuar Thutmosis III. wurde seinerseits unter
dem Makedonischen Philipp Arrhidaios (dem Halbbruder Alexanders des Großen)
durch einen Schrein ersetzt, der heute noch dort steht.
Die schwarze Granit-Tür
zum südlichen Portikus wurde von der Westwand der "roten Kapelle"
(von Hatschepsut) entfernt. Als die Kapelle unter Thutmosis III. abgebaut
wurde, verwendete er die beiden Haupttüren für seine Renovierung des
zentralen Teils des Tempels und für den Eingang im "Palast der
Maat" (nördliche Seite).
|
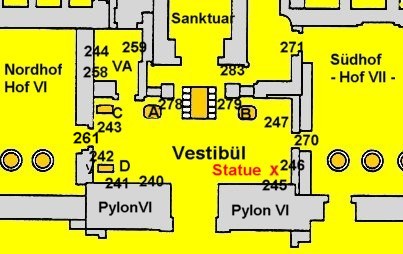
|
Vestibül hinter dem VI. Pylon
von Thutmosis III.
A+B Wappenpfeiler von Ober- u.
Unterägypten (aus Granit) (PM278+79)
C+D Statuen Amun und Amunet - Zeit Tutanchamun (usurp. Haremhab)
VA Raum VA
PM 240-244 zwei Szenen
König erhält Leben von Amun und
Mut (mit Renovierungstext
von Haremhab und Annalen, (Jahr
29-42 Thutmosis III), Renovierungs-Text von Sethos II. an der Basis
(der untere Teil von Kolumne 3-32, der größte Teil von Kolumne 33-47
und ein Teil des Textes darüber befinden sich heute im Louvre
-Inv.-Nr. C 51)
PM 245 König erhält Leben von Amun und Annalen, 33 Kolumnen und
Text - mit Renovierungstext von Sethos
II. an der Basis
|
|
- Plan: nach Porter u. Moss, ² II Plan XI
- modifiziert von Nefershapiland
PM 246+247 wiederverwendete Blöcke der Annalen -
evtl. von hier -
PM 259 Thutmosis III. mit der Großen Götterneunheit; der König opfert
"deshert-Vasen" vor Amun und einer Göttin.
PM 261 Tordurchgang in den Nordhof, Türsturz, Doppelszene, Kultlauf -
König mit "hes"-vase zu Amun-Re
PM 270 Tor in den Südhof
PM 271 Tor in den Südhof
PM 283 Torname |
|
Linke Front-Seite (oberes Bild) und rechte Seite
(unteres Bild) des VI. Pylons |
Torpfosten: links und rechts
PM² II 88 (239a - oberes Bild)
Der König betet vor der 9. Tagesstunde.
Torpfosten links: Reg. I. (nur noch der Unterkörper des Königs
ist erhalten, Rest zerstört); Reg. II.: nur noch die Titulatur des
Königs und seine Hand mit einem Weihrauchgefäß ist erhalten. Reg.
III. unten: Der König mit der unterägyptischen Krone steht vor einem
Gott (?), der das Was-Szepter in der Hand hält an dem sich oben das
Zeichen für "Leben und Dauer" befindet (der Gott ist nicht
mehr identifizierbar.
Torpfosten rechts: (PM² II 88 [239b)
Register I.: nicht mehr vorhanden
Register II: Der König mit der Atefkrone (mit Kugelperücke darunter)
steht vor Amun-Kamutef.
Register III: Der König mit der oberägyptischen Krone steht vor
einer nicht mehr erhalt. Gottheit. Der Gott hält ein Was-Szepter in
der Hand und gibt dem König "Leben und Dauer". An der Basis
befinden sich Weihetexte.
___________________________________________________________________________
Auf beiden Seitenwänden des Pylons befinden oben sich die Reste
von Darstellungen des "Erschlagen der Feinde" durch den
König (PM² II 88 [235 / links) + 238 rechts).
Darunter befinden sich 5 Reihen mit Namensringe der nördlichen
Völker und auf der rechten Wandseite der südlichen Völker, die vom
König unterworfen wurden. |
|
Beide Bilder: Courtesy to Hannah Pethen - Wikipedia
5. 4. 2011
CC
BY-SA 2.0 |
Kammern der Annalen
(Annalensaal)
Thutmosis III. teilte nach dem Bau
seines VI. Pylons den Peristyl-Hof durch zwei Mauern, die eine zentrale,
vorgelagerte Kammer vor dem heutigen Sanktuar von Phillipp Arrhidaeus (dem
früheren Barkensanktuar von Thutmosis III.) bildeten, in drei neue Abschnitte
ein. An den Wänden dieser Kammer - zusammen mit der Ostfassade des VI. Pylons
und den Außenwänden des Heiligtums ließ Thutmosis III. Aufzeichnungen
seiner Feldzüge nach Asien während seiner Regierungsjahre 23-42 (1457 v.
Chr. - 1438 v. Chr.) eingravieren, was zu dem Namen der Kammer ("Kammer
der Annalen"), die einst von einem Dach bedeckt war, das auf den
sogenannten "Wappenpfeilern" ruhte, führte.
Diese
"Annalen beginnen an der nördlichen Wand dieses Heiligtums. Erwähnt
werden auch die geleisteten Tributzahlungen der unterworfenen Länder und die
der befreundeten Nachbarstaaten, wobei die Inschriften an einigen Stellen
stark zerstört sind. Diese Texte werden unter den Wissenschaftlern als
authentisch angesehen und sie sind die umfangreichste und auch wichtigste
Quelle für die Feldzüge von Thutmosis III. Es handelt sich dabei um die
überarbeitete "Kurzform" eines Tagebuches (auf Lederrollen
geschrieben), das die Schreiber während des Feldzuges führten und welches
nach ihrer Rückkehr nach Theben dem Tempelarchiv übergeben wurde (siehe
Thomas Kühn in Thutmosis III. Kemet Heft 3/2001, S. 34).
Thutmosis III. gab
in seinem 40. Regierungsjahr den Auftrag, diese Ereignisse chronologisch nach
Regierungsjahren geordnet, zusammenzustellen (Quelle: Thomas Kühn: Die
Feldzüge Thutmosis III. Kemet 2010, S. 16)
|
Plan des Annalensaal mit Position der
Annalen-Inschriften von Thutmosis III.
A + B = Wappenpfeiler |
Plan nach Lexikon der Ägyptologie, W. Helck, E.
Otto / Band 1 Harrassowitz-Verlag 1975
modifiziert von Nefershapiland
(die blauen Nummern sind nach Porter & Moss)
- die Pfeile geben die Richtung der Schriftzeichen an - |
Die Annalen von
Thutmosis III. (die über 16 Feldzüge des Königs nach Asien berichten) beginnen an der nördlichen Wand dieses Heiligtums (PM² II, 97
[282] ) und beginnen
mit einer Einführung:
"Seine Majestät
[Thutmosis III.] befahl zu veranlassen, dass man verewigte [die Siege,
die ihm sein Vater Amun gewährte, in] einer Königsinschrift in dem
Gotteshaus, das seine Majestät für [seinen Vater Amun] gemacht hat,
[weil er veranlasse wollte, dass verewigt werde] der betreffende
Feldzug und die Beute, die [Seine Majestät von ihm[ heimbrachte,
sowie [die Dienstleistungen] aller [Fremdländer], die ihm sein Vater
Re gegeben hatte."
(Quelle: Thomas Kühn, Kemet Nr.10,
Heft 1/2010, S.19
Die Annalen wurden übersetzt und
publiziert von Kurt Sethe in den "Urkunden des ägyptischen
Altertums" Abt. IV, 645-734 (bzw. bis 756).
|
Thutmosis III. steht vor zwei
Obelisken und eine Fülle von Opfergaben. Diese umfassen Kassetten,
Goldarmbänder mit Edelsteinen, Alabastergefäße - gefüllt mit "reiner
Salbe für die göttlichen Rituale", ein Gefäß aus Edelsteinen, dass
"Seine Majestät nach der Absicht seines eigenen Herzens gemacht
hat" und alle anderen Arten von Gegenständen, deren Anzahl und Material
in der Opferliste angegeben wird und die von ihm für den Gott Amun-Re
gestiftet wurden.
|
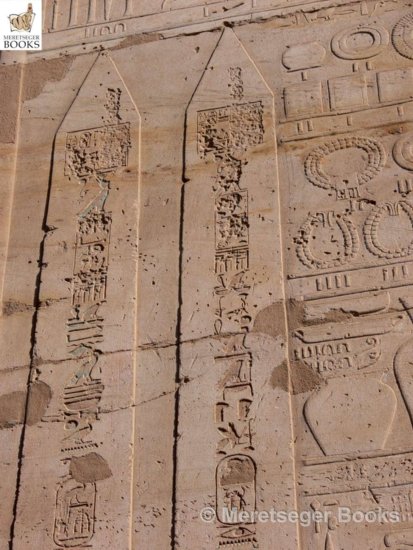
|
Unterhalb des Pyramidions der
beiden Obelisken ist bei genauerer Hinsicht ein (heute) stark zerstörtes
Bildfeld zu sehen, das einst den knienden König beim Opfer vor dem sitzenden
Amun-Re zeigt. Bei dem rechten Obelisken ist noch der "nw"-Topf (Nun-Topf)
zu sehen und die Beischrift kennzeichnet es als Weinopfer. Auf der
Obeliskenspitze, die sich unterhalb dieses Bildfeldes befindet, beginnt die
Obeliskeninschrift mit dem Serech (auf dem der Horusfalke mit der Doppelkrone
auf dem Kopf sitzt) daneben eine Sonnenscheibe mit Uräen, an denen ein
Anch-Zeichen hängt (Quelle: naunakhte 2009 - Forum Ägyptologie, Referat: Abwege)
Bild: Courtesy to www.meretsegerbooks.com
- Fotograf: Francois Olivier - |
Zwischen dem König und diesen
Opfergaben befinden sich zwei Fahnenmasten aus Zedernholz und zwei große
Obelisken aus Granit, auf der sich jeweils eine andere Inschrift befindet. Auf
dem linken Obelisk erklärt der König, "dass er zwei große
Granit-Obelisken mit einem Elektrum-Pyramidion an den Doppeltüren des Tempels
hat errichten lassen" (wohl die beiden Obelisken, die vor dem IV. Pylon
standen und von denen derzeit nur die Sockel übrig sind). Auf dem rechten
Obelisk wird auf die Errichtung der beiden großen Granit-Obelisken mit
Elektrum-Pyramidion verwiesen (dieses waren wahrscheinlich die beiden
Obelisken, die einst vor dem VII. Pylon standen und von denen der eine jetzt
in Istanbul steht).
|
Weihung der beiden Obelisken und der Opfergaben
durch Thutmosis III.
- Nordwand des Heiligtums - im Umgang links vom Sanktuar (PM²
II, 97 [282] ) - |
| Die Annalen beginnen an der nördlichen Wand des
Heiligtums und zeigen Thutmosis III., (in Begleitung seines Kas), der
den "mâkes cane" (ritueller Kultstab aus Holz) und die
weiße "Hedj-Keule" in seiner einen Hand hält und das
Sechem-Szepter in der anderen. Er weiht die Fülle der Opfergaben vor
sich im Namen von Amun-Re. |
|
Bild: Courtesy to Kairoinfo4U
- alle Rechte vorbehalten - |
|
Wand der Annalen - Nordwand des Heiligtums'
- Fortsetzung des oberen Bildes nach rechts - Umgang links vom
Sanktuar - |
| Der Opferaufbau auf der "Wand der Annalen"
zeigt eine Fülle von wertvollen Gaben, die der König für Amun-Re
opfert:: Schalen aus kostbarem Stein und Gold sowie verschiedene
Gefäße, Krüge, Teller, große Kessel und Scheiben, die kunstvoll
gefertigt wurden. Ganz rechts sitzt Thutmosis III. auf seinem Thron
und hält in seiner rechten Hand den Heka-Stab. |
|
Bild: Courtesy to Kairoinfo4U
- alle Rechte vorbehalten - |
Um das Sanktuar des Thutmosis
III. lauft ein aus schmaler Gang (links), dessen nördliche Mauer aus
Sandstein von Königin Hatschepsut dekoriert wurde. Thutmosis III. errichtete
vor dieser Mauer eine neue Wand mit den Aufzeichnungen seiner Annalen, auf
welcher er seine Schlachten, die Kriegsbeute und den an den Tempel des Amun
abgegebenen Teil (Opfergaben) aufzeichnen ließ. Dadurch
"verschwand" die Dekoration der Hatschepsut.
Französische Ausgräber (CFEEK)
hatten diese ursprüngliche Wand wiederentdeckt und ließen sie abbauen um sie
dann als Teil einer Zwischenwand zwischen den beiden nördlich vom Sanktuar
gelegenen "Magazinräumen" der Hatschepsut neu errichten. Diese Wand
weist aber eindeutige Zerstörungen der Darstellungen der Königin und auch
ihrer Kartuschen auf - die höchstwahrscheinlich von Thutmosis III. veranlasst
wurden (denn es gibt keine Hinweise darauf, dass die Wand mit den
Opferweihungen zwischenzeitlich mal abgebaut worden wäre). Dieses lässt
vermuten, dass die "Verfolgung" der Hatschepsut bereits begonnen
hatte, bevor dieser Wandteil der Thutmosis III.-Annalen erbaut worden war
(Quelle: Dr. Karl Leser, Ägyptologie-Forum 2012/Re Thutmosis und
Hatschepsut-Karnak)
Unterhalb dieser großen
Darstellung - welche die gesamte Wandfläche von der nordöstlichen Ecke bis
zum Graniteingang bedeckt - befinden sich 67 Textspalten, die von Ost nach
West gelesen werden und den ersten Feldzug des Königs dokumentieren (Beginn
der Annalen Kolumne 1-67, Jahr 22-23 und Text am rechten Ende). Thutmosis
berichtet, dass er in seinem 22. Regierungsjahre die Grenze bei "Tharu"
überquerte, um die Rebellion der Asiaten zu bekämpfen. Er braucht - nach
einem kurzen Aufenthalt in Gaza - drei Wochen, um in "Yehem"
anzukommen, wo er einen Kriegsrat abhält (nachdem er erfahren hatte, dass der
Fürst von Kadesch alle Prinzen von Palästina und Syrien mit ihren Truppen
und Pferden in Megiddo versammelt hatte, um gegen den ägyptischen König zu
kämpfen. Kriegsentscheidend war die anschließende Beratung von Thutmosis
III. mit seinen Generälen, welcher der 3 möglichen Wege über bzw. um das
Gebirge herum, wohl der richtige wäre. Der König entschied sich dann für
die direkte Route von Aruna durch die enge Schlucht - welche wohl die
gefährlichste war. Die beiden anderen Straßen waren vielleicht sicherer,
aber führten entweder nördlich oder südlich von Megiddo.
Die Annalen werden auf dem
schmalen Gang, der das Barkensanktuar Thutmosis III. (heute Philipp Arrhidaios) auf der rechten Seite umgibt, weitergeführt (PM² II 98 [284] )
und beschreiben auf dem heute zerstörten westlichen Mauerende beginnend,
wahrscheinlich die Feldzüge der Regierungsjahre
26-28. Die Ausgräber haben lt. Porter Moss "Spuren einer früheren
Szene (versteckt durch die Annalen) mit 12 Propheten und Opfergaben für das
Amunfest, begleitet von vier Priestern mit Opfergaben auf den gefundenen
Fragmenten entdeckt (siehe Sethe, Urk. IV. 678-9 [205], 877-8 [257]. Auch
Fragmente des einstigen Barkenschreins von Thutmosis III. wurden gefunden
(einige verbaut im II. Pylon), der hier abgelegt wurde (PM² II 98 [285] ) -
ebenfalls ein Granitblock (Thutmosis III.) vor Amun-Re mit einer Liste
darunter, der ebenfalls wohl aus dem Barkenschein stammt.
Die Annalen der Regierungsjahre
28-39 (heute zum größten Teil im Pariser Louvre) befanden sich auf der
nördlichen Wand des Raumes VA (PM² II
89 [242-244] ) - während die Annalen an der Rückwand der nördlichen
Pylonseite noch in situ sind - sie zeigen den König, der Leben von
Amun und von Mut erhält mit einem Erneuerungstext von Haremhab und die
Annalen der Jahre 29-42 (der untere Teil der Kolumnen 3-32, sowie das meiste
der Kolumnen 33-47 und Teile des oberen Textes sind heute im Louvre / C. 51).
An der Basis der Wand befindet sich ein Erneuerungstexte von Sethos II.
|
Nördliche Rückwand des VI. Pylons PM² II 89
(240-41) |
| Links erhält Thutmosis III. Leben von Amun-Re und
von Mut - dahinter die Annalen aus den Jahren 29-42 und ein
Erneuerungstext von Haremhab. An der Basis befindet sich ein
Erneuerungstext von Sethos II. Im Hintergrund ist der Obelisk von
Hatschepsut zu sehen und rechts im Bild die Statue des Gottes Amun-Re
(/mit dem jugendlichem Profil von Tutanchamun). |
|
Bild: mit frdl. Dank Saamunra
- alle Rechte vorbehalten - |
Ein
unpubliziertes Fragment der dortigen Annalen befindet sich lt. Porter &
Moss, S. 89 im Brit. Museum (Nr. 1684 - Eingangsjahr 1862).
Weitere
Annalentexte befinden sich auf der südlichen Rückwand des VI. Pylons (PM²
II 90 [245] ). Die Darstellungen zeigen den König, der Leben von Amun erhält
und 33 Kolumnen der Annalentexte mit Fest- und Opferbeschreibungen und einem
Erneuerungstext von Sethos II. an der Basis (siehe auch Schwaller de Lubicz,
Karnak, Pl. 140). Evtl. wiederverwendete Blöcke der Annalen - lt. Porter
& Moss evtl. von hier (?) - befinden sich an der südlichen Seitenwand -
links und rechts des Durchgangs - die von Sethos II. in die Wand "wieder
eingefügt wurden" (PM² II 90 [246 und 247] und Sethe, Urk. IV 736-8
(208) A, B.
|
Rückseite Südflügel des VI. Pylons mit
Annalentexte (PM² II 90 [245] )
- ganz rechts im Bild, der Rest des inneren Pylondurchganges mit
Torpfosten - |
| Auf der Rückseite des Südflügels des VI. Pylons
befinden sich 33 Kolumnen Annalentext von Thutmosis III mit der Angabe
von Opfergaben für Feste. Oben links steht Thutmosis III. in
einer Bilddarstellung vor Amun-Re, der ihn an der Hand berührt und
ihm mit der anderen Hand das "anch"-Zeichen - als
Zeichen für Leben - an die Nase hält. Deutlich sind hier die Spuren
der Wiederherstellung des Gottes Amun-Re erkennbar.
Zwischen dem links anschließenden Annalentext von Thutmosis
III. und der Figur des Amun-Re befindet sich eine kurze Textkolumne
mit einem Renovierungsvermerk, der von Tutanchamun stammt, aber
später von Haremhab usurpiert wurde - so wie die weiteren
Renovierungsinschriften in Raum V (Quelle: Silke Grallert, "Bauen-Stifen-Weihen").
Die letzten beiden Kolumnen des Annalentextes zählen Opfergaben
auf (wie etwa 318 weiße Brote für die vier Obelisken Thutmosis III).
An der Basis befindet sich ein Renovierungstext von Sethos II. aus der
19. Dynastie.
Vor der Wand befindet sich eine Sitzstatue von König Amenophis
II (PM² II 90 [254] ). |
|
Bild: Palast der Maat
Autor: Olaf Tausch, Wikipedia 2019
Lizenz: CC
BY 3.0 |
Wappenpfeiler
(PM² II 91 [255+256] )
Die Kammer der Annalen war einst von einem Dach mit
Architraven bedeckt, die auf sog. Wappenpfeilern ruhten. Thutmosis III. ließ
vor seinem ursprünglichen Naos - den Phillipp Arrhideus später mit seinem
eigenen Sanktuar überbaute - zwei 6,77 m hohe Granitsäulen aufstellen, die auf ihrer
Ost- und Westseite vier Szenen und auf ihrer Nord- und Südseite symbolische
Pflanzen der beiden Länder tragen, die außergewöhnliche Details zeigen, die
sog. "Wappenpfeiler". Diese "Pfeiler" sind die einzigen
bekannten Beispiele dieses Typs und ihre architektonische Rolle war in der
Vergangenheit oft Gegenstand von einigen wissenschaftlichen Diskussionen. Der
König trägt auf der südlichen Säule die weiße Krone und wird im oberen
Register von Amunet und unten von Amun umarmt. Auf der nördlichen Säule
trägt der König die rote Krone und wird von Hathor und dann von Amun umarmt.
An der südöstlichen Ecke der südlichen Säule befindet sich über den
Pflanzendarstellungen die Kartusche von Thutmosis mit seinem Thronnamen "Nefer-cheperu"
und darüber wird der König von der Göttin Mut umarmt. Diese Umarmungsszene
erscheint ebenfalls im oberen Abschnitt auf der Ostseite des Nordpfeilers.
|
Südpfeiler:
Blick nach Norden
- oben: Mut umarmt Thutmosis III. -
unten: der König wird von Amun-Re umarmt
die westliche und östliche Seite zeigt die Wappenpflanze (Lilie) von
Oberägypten |
Nördliche Pfeiler:
der von Mut umarmte
Thutmosis III.
- obere Darstellung: der König trägt das Nemes-Kopftuch -
die westliche und östliche Seite zeigt die Wappenpflanze (rechts) von
Unterägypten (Papyrus)
|
|
Bild: Courtesy to www.meretsegerbooks.com
- Fotograf: Francois Olivier - |
Bild: Courtesy to Jon Bodsworth, Wikipedia
- public domain - |
|
Nördlicher Wappenpfeiler vor dem Sanktuar
oben: der König mit der unterägyptischen Krone - er
wird von Hathor umarmt.
unten: der König wird von Amun-Re umarmt |
Südlicher Wappenpfeiler vor dem Sanktuar
oben: Thutmosis III. mit der oberägyptischen Krone
wird von Amunet umarmt
unten: Thutmosis III. wird von Amun-Re umarmt. |
|
Bild: Courtesy to Hanna Pethen, Flickr 2012, CC
BY-SA-2.0 |
Bild: Courtesy to Hanna Pethen, Flickr 2012, CC
BY-SA-2.0 |
Statuen Amun-Re und
Amunet (nicht Thutmosis III.)
In der nordwestlichen Ecke des Hofes
V - vor dem Durchgang zum Nordhof von Thutmosis III. - befinden sich
zwei etwa 6 m hohe Statuen aus rotem Sandstein (lt. Legrain) von Amun-Re und
Amunet im Profil, vor der Innenwand des Nordflügels des VI. Pylons - dahinter
befindet sich ein Text, der die Tribute aufzeichnet, die während der letzten
Feldzüge des Königs in den Jahren 39 und 42 seiner Regierung von den
unterworfenen Völkern geleistet wurde. Die Aufzählung der Tribute endet mit
einer Inschrift Thutmosis III.: "Siehe,
S. M. befahl die Aufzählung der Siege, die er vom 23. bis zum 42. Jahr
errungen hatte, als diese Inschrift auf seinem Heiligtum geschrieben
wurde......".
|
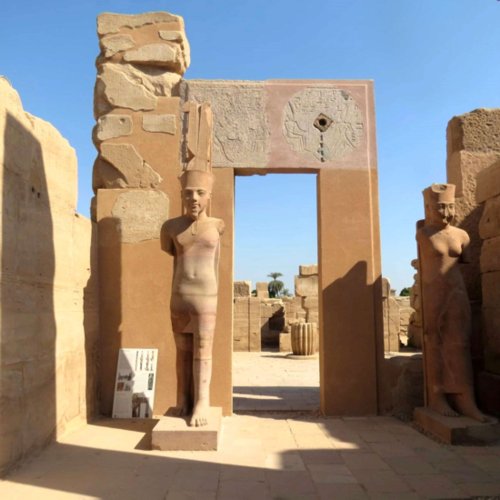
|
Zwei Statuen vor dem Durchgang in Hof VI
(PM² II. 90 [252+253] )
Beide Statuen wurden
zweifellos aber erst während der Herrschaft von König Tutanchamun
hergestellt und hier aufgestellt und später von Haremhab usurpiert. Die
Statue von Amun (mit den Gesichtszügen von König Tutanchamun)
war in viele Stücke zerbrochen. Hinter den Federn auf seinem
Kopfschmuck befindet sich jedoch eine Inschrift mit dem Horusnamen von
Tutanchamun und über seinen Kartuschen die von Haremhab. Der
fragmentarische Körper von Amunet - war aber leider ohne Kopf (der
wurde später erst gefunden). Wahrscheinlich wurden beider Statuen in
der römischen oder koptischen Zeit zerschlagen.
Bild: Courtesy to
Elvira Kronlob 2023
- alle Rechte vorbehalten - |
Tordurchgang zum
Nordhof PM² II 92 (261a-b)
Zur Zeit der ersten Grabungen im
Tempel des Amun-Re war der granitene Türsturz über dem Tordurchgang - die
Verbindung zwischen Hof V und dem Nordhof (Hof VI) wohl bereits zerstört,
jedoch fand sich noch vor Ort die linke Hälfte des Türsturzes. Bei einer
späteren Restaurierung wurde der aufgefundene linke Teil des Türsturzes
wieder an seinem ursprünglichen Platz angebracht. Vor nicht allzu langer Zeit
wurde dann zumindest ein Teil des rechten Fragments des Türsturzes, der zu
einer heute nicht mehr zu bestimmenden Zeit als Mühlstein zum Kornmahlen
umgearbeitet worden war und sich später in einem Steinlager befand, ebenfalls
wieder an seinem angestammten Ort eingefügt. Zum Glück hat sich die
Darstellung auf dem Mühlstein besser erhalten als die auf dem linken Teil.
Kürzlich restaurierter Türsturz zum Nordhof
Thutmosis III. (PM² II 92 [261] ) |
| Lange Zeit war der rechte Teil
des Türsturzes verschwunden, bis man ihn - als Mühlstein zum
Kornmahlen umgearbeitet - in einem Steinlager wiederfand, so dass der
Türsturz nun - als Ganzes wieder zusammengefügt - an seinen
ursprünglichen Platz wieder eingefügt werden konnte.
Glücklicherweise hatte sich die Darstellung auf dem Mühlrad
wesentlich besser erhalten, als die auf dem linken Teil.
Der Türsturz zeigte einst eine
Doppelszene: rechts der König (Thutmosis III.) im Kultlauf, wohl mit hes-Vasen
vor dem thronenden Gott Amun-Re und links beim sog. Ruderlauf vor
einer thronenden Gottheit (wohl ebenfalls Amun-Re). |
|
Bild: Courtesy to Elvira Kronlob 2023
- alle Rechte vorbehalten - |
Tordurchgang zum
Südhof (PM² 95 [270a-b] )
Auf der linken Seite des V. Hofes
befindet sich ein Tor, das zum Südhof (Hof VII) führt und das in der
18. Dynastie unter Thutmosis III. - unter Wiederverwendung von Bauteilen aus
der "Chapel Rouge" (Osttor) von Königin Hatschepsut - errichtet
wurde (PM² II 95 [270a-b]. In der ramessidischen Zeit wurde dieses
thutmosidische Tor komplett umgebaut und erhielt erst unter Amenmesse und
Sethos II. seine jetzige Beschriftung (vor allem auf der Seite im südlichen
Hof VII.
Auf der nördlichen
Seite des Tores (vom Vestebül Thutmosis III. aus gesehen) befindet sich auf
dem Türsturz eine Doppelszene, in welcher auf der linken Hälfte ein König
mit dem Cheperesch auf dem Kopf vor dem thronenden Amun-Re opfert (lt. PM² 95
[270a-b] Thutmosis III. Auch Reste der Torpfosten haben sich auf der Nordseite
(im Gegensatz zur Südseite des Tores) erhalten.
|
Linker Torpfosten mit Texten und Name des Tores
|
Rechter Torpfosten mit Türsturz
- Reste eines Weihetextes von Thutmosis III. mit Namen des Tores
darüber im Text von Sethos II. (PM² 95e [270a-b] ). |
|
beide Bilder: Courtesy to Elvira Kronlob März
2023
- alle Rechte vorbehalten - |
|
Türsturz linke Seite des
Durchgangs in den Hof VII (PM² II 95 [270] ) |
| Die auf der linken Seite des Türsturzes erhaltenen
Darstellungen zeigen König Thutmosis III. - mit dem Cheperesch auf
dem Kopf - der eine Figur der Maat vor dem thronenden Amun-Re opfert. |
|
Bild: Courtesy to Elvira Kronlob März 2023
- alle Rechte vorbehalten - |
Raum VI. und Raum VII.
- Nordhof und Südhof - |
Zu beiden Seiten der
Kammer der Annalen (Raum V) ließ Thutmosis III. einen Peristylhof errichten,
wobei er einen Portikus aus fächerförmigen Säulen mit jeweils sechs "Papyrus-Bündeln" errichten ließ, deren Basen
und Stengeln fein gearbeitet waren und teilweise mit Blattgold bedeckt waren.
Die beiden Durchgänge (Toreingänge) im Norden und im Süden führten jeweils
in den Hof, dessen nördliche und südliche Rändern ursprünglich von
Kalksteinkapellen, erbaut von Amenophis I. begrenzt wurden. Diese kleinen
Kapellen enthielten wohl Statuen des Königs, die Opfergaben erhalten sollten.
Thutmosis III. (evtl. auch schon Hatschepsut ?) ersetzte diese durch
Sandsteinkapellen. Die Innendekorationen zeigten sowohl Thutmosis III. als
auch den nun vergöttlichten Amenophis I.
Raum VI (Nordhof)
Thutmosis
III. ersetzte die Kalksteinkapellen König Amenophis I. durch solche aus
Sandstein.
Die Kammern waren alle mehr oder weniger gleich gearbeitet mit Ausnahme eines
einzigen Raumes im Nordhof, der erheblich größer war und und den Inschriften
an den Wänden nach ein Weihrauchraum war. Es wird unter den Ägyptologen
darüber spekuliert, ob dieser Raum an der Stelle eines von Königin
Hatschepsut errichteten Raumes steht, den Thutmosis III. bei seiner
Umgestaltung des Areals möglicherweise zerstört hatte. Die Wände dieser
Kapelle werden durch Abbildungen von Weihrauchbäumen aus Punt sowie viele
verschiedener Weihrauchkugeln geschmückt zusammen mit Widmungsinschriften von
Thutmosis III.
(Quelle: Karnak, Elizabeth Blyth,
Routledge-Verlag London and New York 2006, S. 81.82)
|
Blick in Hof VI - nördlicher Peristylhof |
| Blick auf die sog. "Weihrauchkapelle" (2.
von links) im Bildhintergrund und die Kapelle 3 (mit Türsturz.
Am linken Bildrand und vor dem Zugang zu der Kapelle die Reste
der Papyrusbündelsäulen. In der Hofmitte das Fragment einer
Statuenpfeilers mit dem König und Götterfiguren (sehr ähnlich dem
Exemplar, welches Ende des 18. Jahrhunderts von den Gelehrten der
Napoleonischen Expedition gesehen und gezeichnet wurde und
anschließend von Belzoni abgebaut und als Bestandteil der Sammlung H.
Salt 1821 in das Brit. Museum gelangte / BM E12) (siehe Description de
l'Egypte).
|
Bild: Luxor,
Luxor City
Autor: Almondox, Wikipedia 2012 - Bild modifiziert
(beschnitten) von Nefershapiland
Lizenz: CC
BY-3.0 |
| Im
Hof VI befindet sich heute das untere Fragment eines
"Statuenpfeilers" (sehr ähnlich einem weiteren Monument von
Thutmosis III. ähnlicher Bauart, das sich heute im Brit. Museum EA12
befindet, und ebenfalls aus dem Karnak-Tempel stammt - Sammlung Henry
Salt - seit 1823 im Brit. Museum)
Dieser
"Statuenpfeiler" von Thutmosis III. (PM² II [307] -
Pillar-base, with six figures in high relief: Hathor on narrow faces,
Monthu and Tuthmosis III. on wider faces, all holding hands / granite,
wurde 1928 bei Pillet (Maurice Pillet, Thebes, Karnak et Louxor, Paris
1928, S. 62, Fig. 52) vorgestellt. Allerdings befand sich ihr Standort
damals noch auf der Nordseite des Barken-Sanktuars (Nord-Korridor,
Raum XIV A - siehe Plan unten) Die Zuweisung des Statuenpfeilers
(heute im Hof VI) an Thutmosis III. ist allerdings umstritten, da sie
keine erhaltene Beschriftung aufweist und die Datierung nur anhand
stilistischer Merkmale vorgenommen wurde.
Matthias
Seidel (Hildesh. Ägyptologische Beiträge, Bd. 42, Gerstenberg-Verlag
Hildesheim, 1996, S. 67-68 und Tafel 22a,b) möchte dieses Monument
für Amenemhet I. (Mittleres Reich) datieren, da es in seiner
Aufführung mehr dem Statuenpfeiler von Amenemhet I. mit Month
und Hathor aus Armant ähnelt als dem Statuenpfeiler Thutmosis III.
mit Month und Hathor (heute im Brit. Museum London EA 12) (PM² II
[296] ).
|
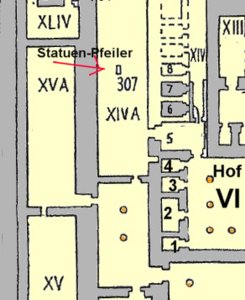
|
Originaler
Fundort des "Statuenpfeilers"
lt. PM² II 103 [307] aus Granit
Paul Barguet (Le temple d'Amon-Ré, 1962)
möchte dieses Bauwerk eher als Sockel für ein Wasserbecken
sehen, in das "Wasser aus dem nahegelegenen reinen Brunnen
floss", was aber bei der Höhe des "Pfeilers" von
158 cm (ohne Basisplatte) und einer Breite von 82 cm etwas zu hoch
ist.
Porter & Moss datiert nach Barguet und
weist die Königsfigur für Thutmosis III. (mit Widder-Gesicht)
zu. |
Das Fragment des rechteckigen Pfeilers setzt sich aus
je zwei Figuren des Königs, des Month und der Hathor zusammen und
erhebt sich über eine mächtige Basisplatte.
Alle
Figuren halten sich an den Händen und sind vor dem massiven Pfeilerkern
gestellt, den sie umringen, aber noch eng mit dem Pfeiler verbunden sind
- im Gegensatz zu dem Parallelstück im Brit. Museum. Sämtliche Figuren
halten ihre Füße geschlossen.
|
|
Bild: mit freundl. Dank Hanne Siegmeier
- alle Rechte vorbehalten - |
An den äußeren Südwänden der
Kapellen im Nordhof befinden sich mehrere interessante Darstellungen. In der
einen Szene hält der König in seiner einen Hand den Ach-Vogel (einen Ibis)
und in der anderen vier lange Pfähle (vielleicht um das Netz für eine
Vogeljagd zu halten). Thutmosis III. befindet sich im Kultlauf (Vogellauf) vor
der Göttin Hathor, die ihm mit ihrer rechten Hand das "menat"
entgegenstreckt - in ihrer linken Hand hält sie die Jahresrispe. Vor Hathor
steht in einem kleineren Format ihr Sohn "Ihy" (ihr gemeinsames Kind
mit dem Gott Horus, der als unbekleideter Jüngling mit Seitenlocke
dargestellt wird) der ein Sistrum in seiner Hand hält. Der König trägt die
Lockenperücke mit Diadem, darüber die Atefkrone, am Kinn den Zeremonialbart.
In der linken Hand hält er den "akh"-Vogel (Ibis comata), in
der rechten Hand vier lange Stäbe (PM² II 93 [267-68] ).
Über dem Türsturz einer der
anderen kleinen nördlichen Kapellen (PM 267-68) befindet sich eine etwas
"merkwürdige" Darstellung: im hinteren Teil eines Papyrusbootes
befindet sich eine verkleinert dargestellte Person, die hinter einer anderen
Person (die aber größer dargestellt ist) steht (vielleicht der König ?).
Die Beine und Füße der kleineren Figur sind vollständig aus Entenköpfen
dargestellt und sollen wohl einen obskuren Gott mit Namen "Cheddu"
(eine alte Fischgottheit) darstellen (Quelle: Schwaller de Lubicz / The
Temples of Karnak, Thames & Hudson 1982, S. 617)
|
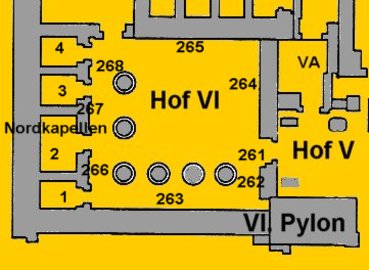
|
Hof (Raum) VI / Nordhof
- nach Porter & Moss² II 92-93
(261-268) -
PM 261: Türsturz - siehe Bild und
Beschreibung weiter oben
PM 262: Teile einer Opferdarstellung - Taharqa opfert Figur der Maat.
PM 263: Reste von Szenen - der König und sein Ka beim Treiben der
Kühe
vor Amun-Re; Basis: Nil- und Gaugötter von Oberägypten
PM 264: Darstellungen in 2 Szenen - Taharqa Opferdarstellungen
PM 265: Oberer Teil von Szene - Sethos I. kniend vor den Göttern
PM 266: Nordkapellen: Thutmosis III. errichtet ein
"Zelt" vor Amun-Kamutef
PM 267-68: 2 Register - 1) Reste einer Szene: Thutmosis III.
mit zwei Sumpfgotthottheit in einem Papyrusboot im Sumpf.
2) Thutmosis III. im Vogelkultlauf mit Stäben vor Hathor - vor
ihr
steht ihr Sohn Ihy mit Sistrum (Türdurchgang) und Nilgötter |
An den zerstörten Torpfosten befindet sich der Torname. Im Hof VI.
(Nordhof) wurden zwei Stelen (oder die Fragmente davon) gefunden
-
Poetische Stele
Thutmosis III. aus Granit - heute im Museum Kairo CG 34010
-
Fragment einer
Granitstele mit Bautext (betr. einer Ziegelumwallung) aus dem Jahr 24 von
Thutmosis III. - heute in Kairo CG 34012
|
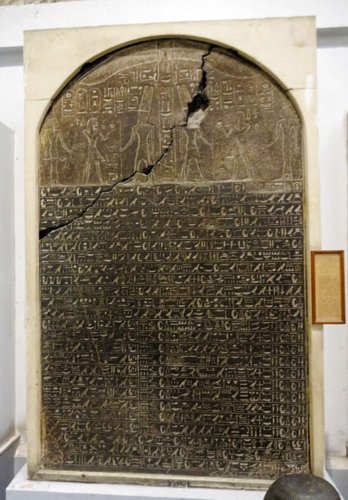
|
Original
der sog. "Poetischen Stele"
von Thutmosis III. aus Granit'
- Museum Kairo: CG 34010 / JE 3425 -
Höhe: 170m - Breite 1,03 m Auguste
Mariette fand im Jahre 1895 im nördlichen Vorhof (Hof VI) eine in
zwei Teile zerbrochene, aber vollständig erhaltene Stele aus Granit
aus der Zeit von Thutmosis III. Es ist allerdings unklar, ob dieses
der ursprüngliche Aufstellungsort der Stele war oder ob sie im Laufe
der Jahre hierher verschleppt wurde. Wie
auch beim Duplikat der Stele (gefunden südlich des VII. Pylons) und
ebenfalls heute in Kairo (CG 34011) ist auch beim Original zu
erkennen, dass hier in der 19. Dynastie Restaurationen vorgenommen
wurden (obwohl keine Restaurationsinschriften auf der Stele
vorgefunden wurden) und davon auszugehen, dass diese in der
Regierungszeit von Sethos I. vorgenommen wurden (wie auf der Dublette
der Stele). Dieses unterblieb evtl. aus Platzgründen. Bild:
mit frdl. Dank Saamunra
- alle Rechte vorbehalten - |
Im gerundeten Oberteil der Stele
ist die geflügelte Sonnenscheibe mit herabhängenden Uräen zu sehen. Diese
tragen jeweils die Weiße bzw. die Rote Krone, sowie ein "anch"-Zeichen
um den Hals. Unter der Sonnenscheibe befindet sich eine antithetische Szene,
die durch eine Inschriftenzeile getrennt ist.
Links: Der König hält in beiden Händen einen Becher, in dem er Weihrauch
verbrennt. Hinter ihm steht die Göttin Waset - in der einen Hand einen Bogen
und Pfeile haltend, in der anderen eine Keule und ein "anch"-Zeichen.
Auf ihren Kopf befindet sich das Gauzeichen des 4. oberägyptischen Gaus. Das
ganze spielt sich vor Amun-Re ab, der ein Was-Zepter in der einen und ein
"anch"-Zeichen in der anderen Hand hält.
Rechts:
Der König hält in beiden Händen je ein Kugelgefäß mit Wein, das er
Amun-Re opfert. Der wiederum hält ein "was"-Szepter in der einen
und ein "anch"-Zeichen in der anderen Hand. Hinter dem König steht
- ebenso wie auf der linken Seite die Göttin Waset - in der einen Hand hält
sie Bogen und Pfeile, in der anderen ein "anch-Zeichen" und auf dem
Kopf das Gauzeichen des 4. oberägyptischen Gaus.
*
Im
Hof VI. gefundene Statuen:
1.
Kniestatue König Mentuhotep–Seanchkare mit zwei Kugelgefäßen in
den Händen.
Unterteil
aus Alabaster, in Kairo, CG
42006
– Name auf dem Gürtel
2.
Eine identische Statue bei der die Kartusche ausgelöscht
wurde;
3. Kopf einer Sphinx Sesostris I.
aus Granit, Kairo CG
42007
4. Ein
Kniestatue eines Königs mit Gefäßen in den Händen, ohne Kopf, Kairo CG
42031
(alles nach PM² II
93 [Finds from North Court] )
|
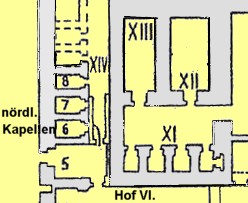
|
Die nördlichen Kapellen 5-8
Plan nach PM² II Plan XI
- modifiziert von Nefershapiland - |
An allen Torpfosten und
Türstürzen der Kapellen 2-8 befinden sich Inschriften von Thutmosis III.
-
Kapelle: Seitenwände,
Priester und Opfergaben vor Thutmosis III.
-
Kapelle: Magazin für
Weihrauch - die sog. "Weihrauchhalle";
Thutmosis III. ließ diese Kammer als Ersatz für die von ihm abgerissene
Kapelle von Hatschepsut errichten. Die Kammer ist größer als die sie
umgebenden Kammern. An der Eingangswand und den Seitenwänden befinden
sich Darstellungen von Ölen, an der Rückwand eine Doppelszene (rechts
zerstört, ausgenommen die Darstellung von Amun-Re) - Thutmosis III.
opfert Weihrauch und Weihrauchbäume vor Amun-Re mit Text betreffend Punt.
Auf den Türpfosten befinden sich Inschriften: "Er [König Thutmosis
III.] [mach]te sein Denkmal für seinen Vater Amun, dem Herrn der beiden
Länder, in Form des für ihn Errichten eines Weihrauchmagazins
(wörtlich: Schatzhauses) erbaut wurde [.....] um wertvolle Duftsalben
herzustellen, damit [er [= Amun) immer im Duft (Geruch) der heiligen
Sachen bleibe). Die Verzierungen und die Darstellungen dieser Kammer
bestätigen ihre Funktion als Weihrauchkammer. Die Darstellung an der
linken Hälfte der nördlichen Wand zeigt den König der Stapeln von
Weihrauch sowie Weihrauchbäume an Amun-Re reicht, die in zwei geordnete
Reihen aufgereiht sind. In der westlichen Hälfte dieser Szene sehen wir,
wie der König vor Amun-Re steht und eine Keule in der linken, verdeckten
Hand hält. Im oberen Register sind drei jeweils in einem Beet
eingepflanzte Weihrauchbäume zu sehen nebst Inschriften. Die Darstellung
an der östlichen Wand fehlt zum größten Teil. Erkennbar sind noch Reste
des Gottes Amun-Re, der die Opfergaben entgegennimmt.
An
den Resten der rechten Seitenwand, werden noch die Ölsorten gezeigt die
hier einst eingelagert waren. Die Szenen an der östlichen Wand zeigen König
Thutmosis III. wie er Min-Amun
und Isis Öl opfert. Die Szenenüberschrift lautet:
"Das
Darbringen (Geben) von Festduftsalbe, von hknw–Öl und sft–Öl".
Die
Szenen an der linken Türseite zeigen, wie der König Amun-Re vier Gefäße
auf einem
Tablett
stehend darbringt. Auf der westlichen Wand opfert der König ebenfalls Öl
vor Amun–Re und Isis.
-
Kapelle: Seitenmauern,
Priester mit Opfergaben und Opferliste vor Thutmosis III.
-
Kapelle: Linke Mauer -
ähnliche Szene
-
Kapelle: Text aus Jahr
17 von Königin Hatschepsut
-
- 8. Kapelle:
Seitenwände, Opferlisten, Priester und Opfergaben vor Thutmosis III:
Raum
(Hof) VII - Südhof
Der
Hof VII (Südhof) stammt original wohl aus der Zeit Thutmosis
III./Hatschepsut. Die südlichen Kapellen 9-13 stammen ursprünglich aus der
Zeit Amenophis I. und wurden original aus Kalkstein gebaut - später ebenso
wie die nördlichen Kapellen 1-8 von Thutmosis III. durch Sandstein-Kapellen
(Quelle: Porter & Moss, S. 96; Barguet, Temple, pp. 126-7 and 126, note 2)
ersetzt. An den Wänden von Hof VII befinden sich Darstellungen von Thutmosis
III. An den Tordurchgängen und Torpfosten ließ Sethos II. Inschriften und
seine Kartuschen hinzufügen - ebenfalls auf dem Türsturz PM² II 95 (270a-b)
und an einigen der Wänden von Hof VII.
|
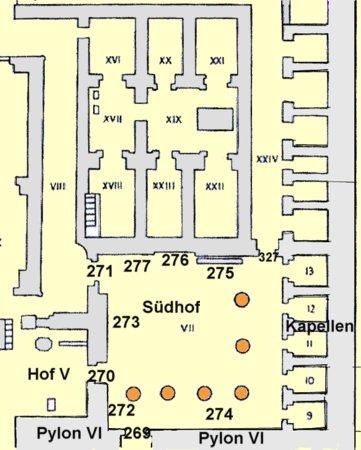
|
Plan des Südhofes (Hof VII)
- nach Porter u. Moss Plan XII -
PM 269 Tor in der Westwand - mit zwei
Kolumnen Text von Sethos II.
PM 270 Tor in der westlichen Hälfte der Nordwand, Türsturz Südseite
mit Doppel
Szene Thutmosis III. opfert die Maat vor einem Gott und der König vor
Mut. Links: Thutmosis III. opfert Salbe vor [einem Gott] und opfert vor
Amun-Re - und Torname
PM 271 östlicher Durchgang in Raum VIII - zwei Register: König opfert
Blumen
und die Maat vor Amun-Re; Block mit 12 Textkolumnen, auf dem Kopf
stehend hier verbaut
Nordwand des Südhofes VII:
PM 272 Linker + rechter Teil der Wand: Sethos II. opfert vor Amun-Re
u. Chons
PM 273 Östl. Teil der Wand: Sethos II. beim Treiben d. Kälber und beim
Weih-
räuchern und libieren vor Amun-Re und Ament.
PM 274 An der Basis: kniende Nilgötter u. Kartuschen von Ramses IV.
PM 275 evtl. Fragmente aus Granit - wohl von der Außenseite des
ehemaligen
Barkenschreins Thutmosis III.
PM 276 Scheintür (?) Thutmosis III mit Weihetext an den Pfosten betr.
Elektron
und Lapislazuli
PM 277 Fortsetzung von PM 271- Thutmosis III. weiht Schätze vor Amun-Re
und
Teile von zwei Reihen mit Vasen aus verschiedenen Metallen.
PM 327 Zugangstor zum Süd-Korridor - Raum XXIV: Türsturz (äußerer)
mit Doppelszene: Thutmosis III. kniend, opfert Wein vor einem Gott. |
Der Hof weist vier Torzugänge auf (siehe
Plan: PM 269, 270, 271 und 327) –
einer an der Nordwestecke , einer im westlichen Teil der Nordwand und einer
weiterer an der Nordostecke, der vierte und letzte befindet sich an der Südostecke
des Hofes.
Nur die Tore 271 und 327 weisen heute noch Inschriften aus der
Zeit Thutmosis III. auf.
|
Rückseite des Tores zwischen Hof V und Hof VII
(PM² II 95e [270a-b] )
- Vorderansicht siehe weiter oben: Tordurchgang zum Südhof -
- mit Blick auf die Statue von Amun-Re/Tutanchamun in Hof V -
|
Das Verbindungstor vom zentralen Hof V in den
Südhof (Hof VII) war stark zerstört und es wurde seit 2003 vom
Centre Franco-Egyptian restauriert und neu aufgebaut. Diese Arbeiten
wurden vor einigen Jahren abgeschlossen.
Das Tor zwischen Hof V und Hof VII. wurde in der 18. Dynastie von
Thutmosis III. erbaut, der das ursprüngliche Tor (evtl. schon unter
Hatschepsut erbaut ?) durch die Wiederverwendung von Bauteilen aus der
"Chapel-Rouge" (Rote Kapelle) von Königin Hatschepsut
errichten ließ (Quelle: PM² II 95e [270a-b] ).
In der ramessidischen Zeit wurde dieses Tor dann komplett
umgebaut und erhielt erst unter König Amenmesse und Sethos II. seine
jetzige Dekoration mit allen Inschriften und Kartuschen auf den
Wänden links und rechts vom Tor (PM² II 95 [272] die heute nur noch
den Namen von Sethos II. zeigen. |
|
Bild mit freundl. Dank Saamunra
- alle Rechte vorbehalten -
|
|
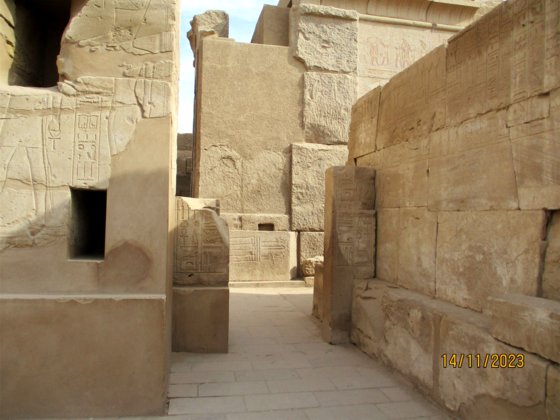
|
Durchgang PM in den Umgang der Kapelle
von Philipp Arrhidaeus (Raum VIII)
Der Durchgang PM 271 (siehe
Plan) führt in den östlichen Raum VIII (Umgang der Kapelle Philipp
Arrhidaeus). Auf dem Torpfosten befinden sich im oberen Register
Darstellungen, die nur noch teilweise erhalten sind.
Bild: Courtesy to Elvira
Kronlob, Nov. 2023
- alle Rechte vorbehalten - |
Sie zeigen einen König,
der Blumen an Amun-Re opfert und im unteren Register ein Bildnis der Maat an
Amun-Re. Sowohl im unteren wie auch im oberen Register wurde die Fläche, in
welcher einst die Königsnamen standen geglättet, aber keine neuen Namen
eingefügt. Original hat hier vielleicht der Name von Thutmosis III.
gestanden. Die königlichen Titeln lauten: "Herr der Riten, Herr der
Beiden Länder (dann der ausgelöschte Thronname), Sohn des Re von Seinem
Körper (und der Geburtsname - auch ausgelöscht). Die Löschungen gehen
wahrscheinlich auf die Zeit der Thronwirrungen Amenmesse / Sethos II. zurück.
|
Östlicher Tordurchgang von Hof VII in Hof V
(linker Torpfosten) |
Östlicher Tordurchgang - linker Torpfosten -
unterer Teil |
|
Beide Bilder: Courtesy Stevie Doidge
- all rights reserved (alle Rechte vorbehalten) - |
|
Östliche Wand des thutmosidischen Südhofes VII
(PM² II 95 [275-277] ) |
Rechts im Bild - vor dem südlichen Teil der
inneren Ostwand - befindet sich ein großer, vorgebauter Block mit
zwei Szenen, der lt. PM Nr. 275 vom Barkenschrein des Thutmosis III.
stammt. Weiter nach links folgt eine "Scheintür" -
ebenfalls aus der Zeit von Thutmosis III. mit einem Weihetext
betreffend "Elektrum und Lapislazuli" an den Türpfosten
(siehe Sethe Urk. IV. 852 [245] ). Links von der Scheintür folgt (PM
schreibt hier: als Fortsetzung von PM 271) eine Darstellung Thutmosis
III. bei der Weihung von Schätzen vor Amun-Re (Zwei Reihen von Vasen
sowie Räuchergefäße und Kohlebecken).
Ganz links im Bild der Naos von Philipp Arrhidaeus im Palast der
Maat. |
|
Bild: Courtesy to Kairoinfo4U
- alle Rechte vorbehalten - |
Bei dem vorgesetzten Block (PM
275) handelt sich um mehrere Fragmente aus Granit wohl der linken Außenseite des
Barkenschreins / Sanktuars Thutmosis III. Der König hatte diesen errichten
lassen, nachdem er den
Schrein von Hatschepsut entfernt hatte. Zu sehen sind zwei
Szenen, rechts der König im Weihegestus vor Amun–Kamutef, links der König
im Kultlauf.
|
Östliche Wand des thutmosidischen Südhofes
VII
Der König (rechts im Bild) weiht Opfergaben/Schätze - dahinter
die "Scheintür") |
|
Bild: Courtesy to Kairoinfo4U
- alle Rechte vorbehalten -
- Bildausschnitt erstellt von Nefershapiland - |
Der
Hof VII. weist vier Säulen an der Westseite und zwei
an der Südseite auf (von
Thutmosis III.)
(PM² II 96).
Während Thutmosis
I. seinen Peristyhof mit sechzehneckigen polygonalen Säulen umgab, umfasste
Thutmosis III. seinen neuen Innenhof mit sechzehn-zackigen Säulen, deren
Basen sehr fein gearbeitet waren. Diesem Portikus standen im Norden und Süden
die heute teilweise stark verfallenen Süd-Kapellen 9-13 gegenüber, die
original von Amenophis I aus Kalkstein erbaut wurden und die dann von
Thutmosis III. durch solche aus Sandstein ersetzt wurden. Die
Kartuschen von Thutmosis III. wechseln auf den Eingängen mit denen von
Amenophis I. ab.
Blick auf die Südwand mit den Säulen und der
Kapelle 9+10
- vor der rechten Hofwand / hinter der Säule befindet sich in situ
eine Sitzstatue von Thutmosis III. aus Granit, die in Kapelle 12
gefunden wurde - |
|
Bild: mit frdl. Dank Elvira Kronlob
- alle Rechte vorbehalten |
Auf den äußeren Türpfosten von Kapelle 10 und 11
befinden sich im unteren Bereich zwei Kolumnen Text von Thutmosis III. Auf den
Ostmauern in Kapelle 9, 10, 12 und 13: der thronende König Amenophis I. vor
Opfergaben - darunter Ritualszenen. Auf den Westmauern in den Kapellen 10, 12
und 13: zwei Register mit Opfergaben und Priestern vor Thutmosis III. und mit
Opfergaben bei Kapelle 10.
Die Tordurchgänge von Kapelle 10, 11, 12 und 13
zeigen einen Text von Amenophis I. mit einem Weihetext von Amenemopet (3.
Prophet des Amun-Re im Jahr 3 von König Ramses III. - in der Kapelle 11
befinden sich lt. PM die königlichen Titel und Namen von Ramses III. (?)
(Quelle: PM² II 96 [South chapels, 9-13] ).
Zwei Sitzstatuen von Thutmosis III., gekleidet im
"heb-sed-Gewand" - die eine aus Granit wurde in situ in Kapelle 12
gefunden, die andere aus Schist (nur noch fragmentarisch erhalten) - befinden
sich heute im Museum Kairo (Quelle: PM² II [96] ) (CG 42098/JE 38245 temp.
6.11.26.3). Der untere Teil der Statue (gefunden von Legrain 1901) fehlt - die
Statue wurde ohne Kopf gefunden. Dieser wurde in der Cachette von Kairo
entdeckt (JE 37901) im April/Mai 1905 und wieder mit dem Körper vereint.
In der
Kapelle 13 fand man an der Rückwand gelehnt eine Statue des Gottes Ptah aus
Granit (ohne Kopf).
Palast der Maat (Kammern der
Hatschepsut)
- Räume nördlich und südlich des Granitsanktuars gelegen
-
- usurpiert von Thutmosis III -
(Raum XI-XXIII) |
Das Zentrum der
Tempelanlage von Karnak stammt aus dem Beginn des Neuen Reiches und findet
sich in neuerer Literatur bei Barguet (Le Temple d'Amon-Re á Karnak, 1962)
und E. Blyth (Karnak-Evolution of a Temple, 2006) häufig die Bezeichnung
"Palast der Maat". Aber häufig findet sich in dieser Literatur
keinerlei Angaben, auf welchen Bereich des Karnak-Tempels diese Bezeichnung
anzuwenden ist. Auf dem Nordobelisken von Thutmosis I. findet sich lt. Urk.
IV., S. 94,6 ein Hinweis auf "....einen Palast der Wahrheitsgöttin, Sohn
der Sonne, Thutmosis....." (Die Wahrheitsgöttin war Maat). Auch bei
Hatschepsut findet sich auf einem Block aus der Roten Kapelle (Nr. 184, Spalte
5, Block 184), der sich auf der Südwand der Kapelle im 1. Register befindet
ein Hinweis auf eine "Halle der Gerechtigkeit" (der Block gehört
zum sog. "Orakeltext" und beschreibt den Ablauf der Krönung von
Hatschepsut), wobei die "Halle der Gerechtigkeit mit dem "Palast der
Maat" gleichzusetzen ist. Eine weitere Erwähnung befindet sich in der
Weiheliste von Thutmosis III., die nördlich des Barkensanktuars die Außenseite
der dortigen Nordkammern der Hatschepsut bildet (2).
Aber keine dieser Quellen für
die Bezeichnung "Palast der Maat" erlaubt eine sichere Zuweisung,
um zu bestimmen, was oder welches Gebäude im Karnaktempel mit diesem
"Palast" gleichzusetzen ist. In der modernen Literatur wird diese
Bezeichnung für die nördlich und südlich vom zentralen Barkensanktuar des
Philipp Arrhidaeus gelegenen Kammern der Hatschepsut und für die Rote Kapelle
der Hatschepsut (bzw. dem unter Thutmosis III. erbauten Ersatz) verwendet
(2).
Wenn man den Forschungen des
CFEETK folgt, war die Rote Kapelle zwischen den nördlichen und den südlichen
Gebäudekomplex des Barkensanktuars platziert. Es gibt aber auch einige
Autoren (wie Warbuton und A. Sullivan (Karnak: Development of the Temple of
Amun-Re UCLAEE 2010), welche die "Rote Kapelle" nicht zum
"Palast der Maat" zählen (2).
Plan des Palast der Maat
-- links und rechts des Sanktuars -
- rote Zahlen sind Statuen oder Podeste
(?) -
PM 299: Türdurchgang ans Granit, wiederverwendet vom
Barkenschrein
der Hatschepsut.
PM 300-301: ident. Szene Thutmosis III. vor Opfertisch
PM 302: Wand der Hatschepsut / geführt von Atum (?) und Month zu Amun
PM 303: Hatschepsut, usurpiert von Thutmosis III. vor Amun und
Opferliste
sowie vor Opfer vor Amun
PM 304: Rechter Türpfosten, Titel von Thutmosis III.
PM 313: äußerer Türsturz, rechte Hälfte, (replaced) königl. Titel -
linker
Türpfosten: Text v. Thutmosis III mit Tornamen und Erneuerungstext
von Sethos I auf der Basis.
PM 314a: König wird von 2 Göttern gereinigt b) unterer Teil eines
Königs
c) König wird umarmt von Amun d) König umarmt von einem Gott
PM 315: Äußerer Türsturz, Doppelszene, König opfert Wasser (links)
und Wein
(rechts) an Amun-Re. Innerer Türsturz: 3 Götter, Falken und Seelen
von Nechen.
PM 316: a) [Hathor] säugt König in Anwesenheit v. Amun u. Chnum
b) Nilgötter mit Opfergaben c) Reste einer langen Opferliste
PM 317: Doppel-Sitzstatue, Thutmosis III. und [Amun - komplett
zerstört]
nur noch unterer Teil des Königs erhalten.
PM 318: Doppel-Sitzstatue Amenophis II, oberer Teil und auf d. Basis
die
"9 Bögen" der Fremdvölker (rechte Götterfigur vollkommen
zerstört)
PM 319: Thutmosis III. weiht und übergibt Schätze an Amun-Re
PM 320: Äußerer Türsturz, Nilgötter mit Opfergaben, Innerer
Türsturz und
linker Türpfosten: Texte
PM 321: a) Hatschepsut (usurp. v. Thutmosis III. für seinen Vater
Thutmosis II
vor Amun-Re und Dankes Text
b) Block mit Figur Thutmosis III, (wieder eingefügt) c) 2
Register:
I. Kultzeremonie (HtS) II. Reste
von Szenen: Hatschepsut, (usurp. zu
Thutmosis II. - doppelt dargestellt) beim Errichten von 4 Statuen von
Dedwen v. Nubien (Sopt v. Osten, Sobek v. Libyen, Horus v. S. und N.)
PM 322: Altar (?)-Basis Thutmosis III. aus Granit
PM 323: a) 3 Szenen: 1). Thutmosis III. opfert 4 Armreifen v. Amun-Re
2) Hatschepsut vor Amun-Re 3) Thutmosis III. berührt Amun-Re -
b) drei Szenen: Thutmosis III. mit Statue von Amun-Re (1+3 fast
zerstört) 2) König stützt Statue
c) König wird von [Amun-Re] umarmt.
PM 324: a) 3 Szenen: 1. der [König] libiert vor Amun-Re 2. Thutmosis
II. opfert
Wein vor Amun-Re 3. der [König] (Rest zerstört).
b) Reste von 3 Szenen: 1. König mit Opfertablett vor einem Gott
2. König opfert "nemset"-Vasen 3. der König
opfert......
c) der König vor einem Gott
PM 325: a) 4 Szenen: 1-4 Hatschepsut (usurp. v. Thutmosis III.) reinigt
die
Statue d. Amun-Re mit Natron b) 4 Szenen: Hatschepsut vor Amun-Re
1. zerstört 2. opfert einen Halskragen 3. streut Sand 4. opfert
Weihrauch
PM 326: a) 4 Szenen: Thutmosis II. vor Amun-Re
b) 4 Szenen: Thutmosis II. vor Amun-Re
c) Thutmosis II. weiht Opfergaben vor Amun-Re |
| Die südlichen Räume sind leider für Besucher nicht
zugänglich (wahrscheinlich aufgrund der engen Räume. Bilder davon
findet man bei Schwaller de Lubicz (Tafel 165), beim Chicago Oriental
Institute und Texte bei Sethe (Urkunden IV) und bei www.maat-ka-re
(Palast der Maat-Südkammern der Hatschepsut - Seite von Dr. Karl Leser
in deutsch und englisch). |
| Im Raum XIX (19) befindet sich ein großer
Block aus Rosengranit (PM 322), der sich auf der Südseite des Raumes
befindet. Ursprünglich war der Block mit Hohlkehle und einem Rundstab
versehen. Auf den Längsseiten (Ost- und Westseite) befindet sich ein
Inschriftenband (übersetzt von Ernst in seiner Dissertation - wobei
dieser annimmt, dass es sich hier um einen Opferaltar handelt, auf dem
die tägliche "Speisung der Götter" vorgenommen wurde.
Barguet hält diesen Block allerdings für einen
Schreinuntersatz).
In Raum XVII (17) der südlichen Kammern befinden sich die
Überreste von zwei Doppel-Sitzstatuen aus Kalkstein, welche den König
neben Amun-Re zeigen (die größere und besser erhaltene Statue zeigt
Amenhotep II. (Kartusche auf dem Rückenpfeiler) und die kleinere (ohne
Kopf) zeigt Thutmosis III. (seine Kartusche befindet sich neben dem
rechten Unterschenkel, wobei die Figur des Amun-Re auf beiden Statuen
vollkommen zerstört ist. Beide Könige setzen ihre Füße auf die
"Neun Bögen".
|
|
Plan nach Lacau, P., in ASAE
- modifiziert von Nefershapiland - |
Hatschepsut ließ direkt vor den
Gebäudeteilen aus dem Mittleren Reich den "Palast der Maat" aus
Sandstein errichten, der eine Grundfläche von 19 x 47m hatte. An der Außenwand
der nördlichen (linken) Räume befindet sich eine Inschrift, die
berichtet, "......dass diese Räume im Jahre 17 der Hatschepsut/Thutmosis
III erbaut wurden oder fertig waren". Die Forschungen des CFEETK beweisen, dass
der Palast der Maat (und die Rote Kapelle) auf einem eigenen Podium errichtet
worden waren, welches aus drei Lagen großer Sandsteinblöcke errichtet war.
Damit liegt die Oberfläche des Podiums höher als der Boden des umliegenden
Tempels und ist klar erkennbar (auf der Ostseite) und nur über mehrere Stufen
erreichbar (2).
Nördliche
Kammern (links)
Den Zugang zum Vorraum in die
nördlichen Kammern erreicht man, wenn man um das Barkensanktuar des Philipp
Arrhidaeus herumgeht und sich an der Weiheliste von Thutmosis III. mit der
Obelisken- und Fahnenmastendarstellung orientiert und dann durch das Tor aus
dunklem Granit, welches ursprünglich für das Osttor der Roten Kapelle
bestimmt war (dieses wurde von Thutmosis III. wiederverwendet und dekoriert)
geht.
|

|
Palast der Maat PM² II 102
[299]
Tor aus Granit nördlich des Sanktuars von Ph.
Arrhidaeus
- wiederverwendet vom Barkenschrein der Hatschepsut -
Links von der Weihedarstellung (siehe
oben) von Thutmosis III. befindet sich ein Türdurchgang aus Granit, der
zum Barkenschrein der Hatschepsut führt.
Auf dem äußeren Türsturz befinden
sich die königlichen Titel und Namen von Thutmosis III. Auf beiden Türpfosten wird der König von Amun-Re umarmt - darunter befindet sich
der Name des Tores: "sbA Mn-Xpr-Ra Imn
wr bA.w" = Tor des Men-cheperu-Re
[mit Namen] Amun, groß an Ba-Kräften (Quelle: Th. Grotthoff, die Tornamen
ägyptischer Tempel, Aachen 1996, S. 94).
Dieses Tor aus
Granit war original das Osttor der Roten Kapelle von Königin
Hatschepsut, das Thutmosis III. beim Abriss der Kapelle - mit seinen
eigenen Dekorationen - hier wiederverwendet. Der Torname stammt
ebenfalls nun von Thutmosis III.
Bild: Courtesy to www.meretsegerbooks.com
- Fotograf: Francois Olivier -
|
Der Tordurchgang aus Granit
führt in den Vorraum (lt. PM ² II 102 [Raum XI] und Chic. Or. Inst. photo.
8403; Schwaller de Lubicz, Karnak II, pl. 150). Von hieraus gelangt man durch
den Zugang in die Räume XII und XIII - sowie in die kleinen Kammern 1-5, die
sich auf der Westseite befinden. Die Innenseite des Tores ist stark
beschädigt und wird auf der linken Seite fast vollständig von der westlichen
Wand der beiden Räume XII und XIII verdeckt. Auf den Wänden des Vorraumes XI ist nur noch wenig von den Darstellungen
erhalten, wobei aber der Originalfußboden des Raumes XI noch zum Teil
vorhanden ist.
|
Die "Hatschepsutwand" - Palast der
Maat, Raum XII.
Hatschepsut
wird von Atum (?) und Month zu
Amun–Re geleitet (I. Register)
|
| Oberhalb der Darstellung befinden sich
die zerstörten Kryptogramme der Hatschepsut (wahrscheinlich zerstört
nach ihrem Tod von Thutmosis III oder in der Regierung seines Sohnes
Amenophis II.), welche den Wandabschluss zur Decke hin bildeten. Alle
Darstellungen der Königin sind absichtlich zerstört, die Darstellung
der Götter hingegen blieben unbeschädigt, da diese nach der
Errichtung der Annalenwand von Thutmosis III nicht mehr sichtbar waren
(also auch nicht in der Amarnazeit, wo viele Götterdarstellungen
zerstört wurden). |
|
Bild: Courtesy to Peter Alscher
- alle Rechte vorbehalten - |
|
Die "Hatschepsutwand" - Palast der
Maat, Raum XII.
(PM² II 203 [302 / II. Register] ) - Relief auf der linken Wand im
Raum XII. |
| In der Mitte stand original die Königin
Hatschepsut, die von Thot (rechts) und Horus von Edfu (links)
gereinigt und mit "anch"-Zeichen übergossen wird.
Die Figur der Hatschepsut wurde unter Thutmosis III ausgehackt und
ihre Kartuschen teilweise zerstört. |
|
Bild: Courtesy to Peter Alscher
- alle Rechte vorbehalten - |
Auch die Darstellungen in Raum
XIII sind nur noch schlecht erhalten - neben dem Eingang in diesen Raum
befindet sich eine Darstellung: Thutmosis III. vor einem Opfertisch mit Gaben.
Ein Teil der rechten Türlaibung steht vor dem Eingangsportal von Raum XIII
(nach Porter & Moss) - Stücke des Architravs liegen im Raum verteilt
(beide Fragmente tragen die Namen und Titel von Thutmosis III). Von der
Dekoration dieses Raumes an den beiden Schmalseiten sind nur noch Farbreste
erhalten.
Die Wände der nördlichen
Kammern des "Palast der Maat" sind schwer beschädigt und von den
Kammern 1-5 auf der westlichen Seite sind ihre Mauern nur noch bis zu einer
Höhe von ca. 1 m erhalten, wobei ihre Dekoration heute fast völlig
verschwunden ist (2). Alle Darstellungen von Hatschepsut und auch die meisten
ihrer Kartuschen sind zerstört - aber die Darstellungen der Götter (auch die
des Amun) blieben unbeschädigt, da sie nach der Errichtung der Annalenwand
unter Thutmosis III. in der Amarnazeit (wo die Zerstörungen der meisten
Götter unter Echnaton durchgeführt wurden) nicht mehr sichtbar waren.
Thutmosis III. hatte seine Annalenwand aus Sandstein direkt vor der originalen
Wand der Hatschepsut bauen lassen und die Darstellungen und Kartuschen seiner
Vorgängerin (im erhabenen Relief) durch Meißelschläge zu löschen und
versucht die Inschriften zu glätten und umzuwidmen. Dieses zeigt, dass schon
in der Zeit von Thutmosis III. versucht wurde, das Andenken seiner
Vorgängerin auszulöschen (2). Bei den Restaurationsarbeiten durch die
Franzosen wurden die Blöcke dieser Wand durchgesägt und die Seitenteile mit
den - bisher von den Annalen - verdeckten Reliefs, anstelle der fehlenden
Trennwände der beiden östlichen Kammern 6 und 7 neu errichtet. Am alten
Platz wurde dann die Rückseite mit den Originalteilen wiederaufgebaut - auch
die Annalenwand von Thutmosis III (2).
Südlichen
Kammern (rechts)
Die südlichen Kammern des "Palast der Maat" sind heute für die
Besucher gesperrt / oder nur mit einer Sondergenehmigung zugänglich (aufgrund
der engen Raumverhältnisse), deshalb gibt es auch kaum Fotos davon (außer
beim Chicago Oriental Institute online und einige wenige bei Schwaller de
Lubicz (Tafel 165). Auf der Nordwand des Umganges zwischen dem Barkenschrein
und der nördlichen Wand der Kammern befinden sich am oberen Rand noch einige
schlecht sichtbare Dekorationsreste aus der Zeit Hatschepsut/Thutmosis III. Zu
sehen sind (bei guten Lichtverhältnissen) einige Opfergaben und eine Reihe
von Opferträgern (2).
Das Eingangstor zu den
südlichen Kammern (PM² II 104 [313] ) liegt am Ostende des Umganges und ist mit den Namen von
Thutmosis III. dekoriert. An der Basis des linken Türpfostens befindet sich
der Torname "Geliebter des Amun-Re wegen [der Größe] seiner
Denkmäler" (nach Urk. IV, 851.8) und ein Erneuerungstext von Sethos I.
an der Basis.
Die Wände des Raumes XVI (in
der Nord-Ost Ecke) sind sehr stark zerstört und die Dekorationen sind nur
noch teilweise erhalten. Auf der Ostseite ist eine Reinigungsszene zu erkennen
(PM² II 104 [314a] ), in welcher Thutmosis III von zwei Göttern gereinigt wird (ähnlich
der Szene in Raum XII in den Nordkammern der Hatschepsut). Auf der Südwand
(PM 314b) wird Thutmosis von Thot und Horus zu Amun geführt. Dieser bedankt sich mit
einer Ansprache für die Erbauung des Tempels. Auf der Nordwand und der
Westwand wird Thutmosis III. von zwei nicht mehr zu identifizierenden Göttern
umarmt (PM 314 c+d).
Ein erhalten gebliebenes
Architrav eines Tores, das den Raum XVI mit Raum XVII verbindet (siehe
PM² II 105 [315], zeigt in einer Doppelszene Opferdarstellungen des
Königs (evtl. Thutmosis III. - nur der untere Teil der Darstellung ist
erhalten / ohne Kartusche) auf dem äußeren Türsturz (links): Wasser und
(rechts): Wein an Amun-Re (PM 315). Auf dem inneren Türsturz befinden sich drei
Gottheiten, ein Falke und die Seelen von Nechen. Auf dem linken Türpfosten:
Nilgötter.
In Raum XVII befinden
sich die Überreste von zwei Doppelstatuen (PM² II 105 [318+317] ) der
Könige (Amenhotep II. und Thutmosis III.), die ihn auf seinem Thron sitzend
neben Amun-Re zeigen (der aber in beiden Fällen heute nicht mehr vorhanden
ist. Beide Figuren des Gottes wurden wohl in der Amarnazeit komplett
zerstört. Die besser erhaltene (größere) Sitzstatue trägt auf ihrem
Rückenpfeiler die Kartuschen von Amenophis II (dem Sohn und Nachfolger von
Thutmosis III) und die kleinere, nur noch im unteren Bereich vorhandene Statue
trägt neben dem rechten Unterschenkel des Königs, die Kartuschen von
Thutmosis III. Auf beiden Sockeln setzt der König seine "Füße auf die
Neun Bögen". Die kleine Statue von Thutmosis III. steht links vor dem
Durchgang zu Raum XVI.
|
Doppelstatue Amenhotep II (links) und Amun
(rechts - komplett zerstört) |
| Beide Doppelstatuen (diese hier und die rechts davon
(nicht im Bild) stehen in Raum XVII. Die hier gezeigte Doppelstatue
trägt auf dem fragmentierten Rückenpfeiler (oben) die Kartuschen von
Aa-cheperu-re (Amenophis/Amenhotep II), dem Sohn und Nachfolger von
Thutmosis III. Sie wurde vor der Nordwand des Raumes platziert - die
andere Statue (mit den Kartuschen von Thutmosis III. auf dem rechten
oberen Bein, steht vor dem linken Torpfosten zu Raum XVI.
Lt. PM ² II 105 (316) befindet sich hinter der obigen Statue
Reste einer Opferliste an der Wand. Die gegenüberliegende Wandseite
von Raum XVII zeigt eine schwer beschädigte Szene, in welcher
Thutmosis III. von einer Göttin (wahrscheinlich Hathor) gesäugt wird
- im Beisein von Amun-Re und Chons. Alle Götterfiguren wurden in der
Amarnazeit zerstört. |
|
photo: Courtesy to Glyn Morris (1975)
- all rights reserved - |
Auf der gegenüberliegenden
Südwand des Raumes befindet sich eine stark zerstörte Darstellung, die
Thutmosis III zeigt, der in Gegenwart von Amun-Re von einer Göttin
(vermutlich Hathor ?) gesäugt wird, wobei alle Götterabbildungen in der
Amarnazeit zerstört wurden (PM² II 105 [316] ) In der
Südwand befindet sich ein Durchgang, der in die Räume XIX-XXIII führt.
In Raum XVIII befindet sich eine
Treppe (in der Nordwestecke), die früher auf eine heute nicht mehr vorhandene
Dachterrasse führte (oder auf ein Obergeschoss ?).
|
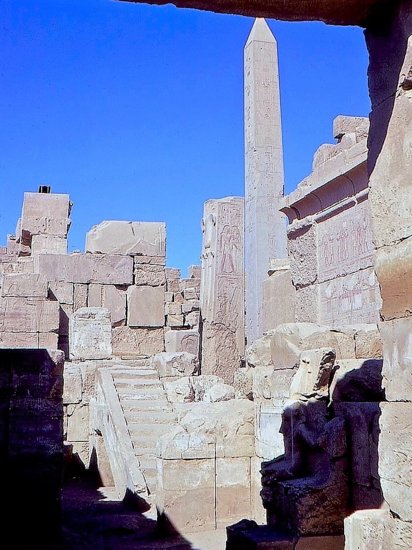
|
Treppe im Raum XVIII
in der rechten Ecke von Raum XVIII (gesehen
von Raum XVII)
- im Vordergrund (im Schatten) die Doppelstatue Amenophis II -
Die Reste einer Treppenanlage, die wahrscheinlich
einst auf eine Dachterrasse oder in ein heute nicht mehr vorhandenes
Obergeschoss führte.
Auf der rechten Seite - im Hintergrund - ist der
nördliche Obelisk von Hatschepsut zu sehen und rechts im Vordergrund
das Barkensanktuar von Philipp Arrhidaeus und der südliche
Wappenpfeiler Thutmosis III. |
|
Bild: Courtesy to Glyn Morris (1975)
- all rights reserved - |
Auf der Südwand von Raum
XVIII ist Thutmosis III (mit der Atef-Krone auf dem Kopf) zu sehen bei der
Überreichung von Schätzen an Amun-Re (dessen Figur - wohl in der Amarna-Zeit
?) ausgehackt wurde (PM 319). Auf dem linken Türpfosten zu Raum XIX sind
Nil-Gottheiten mit Opfergaben zu sehen - auf dem inneren Türsturz und dem
linken Türpfosten befinden sich Texte (PM 320).
In Raum XIX befinden sich auf der Südseite die Überreste eines
großen Rosengranit-Blocks (PM² II 105 [322] ), auf dessen Längsseiten (Ost-
und Westseite) sich Inschriften befinden, wobei Barguet davon ausging, dass es
sich bei diesem Block um einen Schreinuntersatz handelt - andere Ägyptologen
sind der Meinung, es handle sich hier um die Überreste eines Opferaltars.
Mehrere Stufen führten auf der Nordseite auf die heute zerstörte Plattform
des Blocks. Die Kartusche von Thutmosis III. ist links neben der obersten
Treppenstufe erhalten geblieben. Dieser Raum ist von Thutmosis III für seinen
Vater Thutmosis II geweiht - ursprünglich standen hier die Kartuschen von
Hatschepsut, die von Thutmosis III. in die seines Vaters umgeschrieben wurden.
Auf der Nordwand von Raum
XIX - neben dem Tor zu Raum XVII (siehe Plan oben) befindet sich eine
Darstellung der Königin Hatschepsut (PM 321a) vor Opfergaben vor Amun-Re, der
sich für die Errichtung des Tempels bedankt und den Kartuschen von Thutmosis
II. (die Kartusche von Hatschepsut wurde von Thutmosis III. für seinen Vater
Thutmosis II. usurpiert).
Auf der östlichen Wand
befinden sich die beiden Eingänge zu den oberen Räumen XX und XXI.
Die Kartuschen auf dem Türsturz von der Kammer XIX in die Kammer XX wurde von
Thutmosis III. überarbeitet (geglättet und nur noch sehr schwach sichtbar)
und in
der oberen Reihe von Maat-ka-Re auf den Namen seines Vaters Thutmosis II. (Aa-cheperu-n-Re)
geändert und ebenfalls in der unteren Reihe (leider gibt es bei Porter &
Moss zu diesen Wänden und Durchgängen keine Informationen - vielleicht waren
diese Wände damals als die beiden Frauen (Porter & Moss) sie beschrieben nicht sichtbar oder
wurden erst später restauriert?)
Auch auf dem Architrav befanden sich einst
Kartuschen, die aber heute zerstört sind. Auf der nördlichen inneren
Eingangswand (PM 321c, Register II) sind Reste von Szenen der Königin zu
erkennen (abgeändert in Thutmosis II), die in einer Doppeldarstellung beim
Ritual "des Errichten von 4 Statuen von Dedwen von Nubien, Sopt von
Osten, Sobek von Libyen und Horus von Süden und Norden zu sehen ist (siehe
Barguet, Temple, S. 145).
Im oberen Raum XX
befinden sich an der nördlichen, östlichen und südlichen Wand erhaltene
drei Szenen, in denen der König (Thutmosis III) sämtlich vor dem
ithyphallischen Amun-Kamutef (Erscheinungsform von Amun) steht. Auf der
nördlichen Wand opfert der König 4 Armbänder vor dem Gott; steht vor
Amun-Kamutef (lt. PM ² II 105 [323a - Szene 2 wird hier die Königin
Hatschepsut gesehen (?) und der König berüht den Gott (Szene 3). Die drei
Szenen auf der südlichen Wand (PM 323 b) sind zum größten Teil stark
zerstört und zeigen ebenfalls den König vor dem ithyphallischen Amun-Kamutef.
Auf der östlichen Wand wird der König von
Amun-Kamutef umarmt.
Die Südwand von Raum XXI
zeigt in drei Szenen den König (Thutmosis III. lt. PM 324) libierend vor dem
schreitenden Amun, in der Mitte bringt Hatschepsut - usurpiert von Thutmosis
III. auf seinen Vater Thutmosis II., wobei die Kartuschen eindeutige Spuren
einer Überarbeitung tragen) - Wein vor Amun-Kamutef dar. Die rechte
Darstellung ist sehr stark zerstört, so dass nur noch die Beine eines Königs
vor dem schreitenden Gott (wohl wieder Amun-Kamutef) zu erkennen sind
(2).
Auf der Nordwand befinden sich
ebenfalls 3 Szenen mit der Darbietung von Gaben des Königs vor dem
ithyphalischen Gott Amun - ebenfalls auf der Ostwand, wo der König vor dem
Gott steht.
Die beiden letzten Räume
XXII und XXIII zeigen starke Zerstörungen auf den Mauern, wobei außerdem
im Raum XXII die ganze westliche Rückwand fehlt. In der Amarnazeit wurden die
Darstellungen des Gottes Amun ausgemerzt, später teilweise wieder
restauriert. Wahrscheinlich waren in beiden Räumen die Decken mit einem
Sternenmuster verziert (goldene Sterne auf blauem Grund - wie die noch
vorhandenen Decksteine vermuten lassen). Unter Thutmosis III. wurden die
Seitenwände in beiden Kammern mit einem Checker-Fries verziert (2).
Raum XXII liegt in der Westecke
der Kammern der Maat und PM ² II 106 (325 ff) beschreibt die noch vorhandenen
Szenen
(nach Barguet, Temple, Seite 148) wie folgt:
PM 325a: vier Szenen
Szene 1-4: Hatschepsut (usurpiert von Thutmosis III) reinigt die Statue
des Amun-Re mit Natron
PM 325b: vier Szenen / Hatschepsut vor Amun-Re
Szene 1: zerstört
Szene 2: Hatschepsut opfert einen Halskragen vor Amun-Re
Szene 3: Hatschepsut beim Streuen von Sand vor Amun-Re
Szene 4: Hatschepsut opfert Weihrauch vor Amun-Re
Die Darstellungen im letzten
Raum XXIII zeigen ebenfalls lt. PM² II 106 (326a-c) Ritualszenen, wobei
auch hier die Kartuschen von Hatschepsut durch Thutmosis III. für seinen
Vater Thutmosis II. usurpiert wurden, vor beiden Erscheinungsformen des
Amun-Re. An der Südwand befindet sich an deren oberen Wand noch ein
Checker-Fries, das unter Thutmosis III. entstand. Bei genauerem Hinsehen ist
auch hier die Änderung der Kartuschen und Inschriften von Hatschepsut in
Thutmosis II (von Thutmosis III. für seinen Vater abgeändert) zu erkennen.
Die Darstellungen und Kartuschen auf der westlichen Seite der Südwand in Raum
XXIII zeigen noch ihre ursprüngliche Farbe und sind teilweise noch sehr gut
zu erkennen.
PM 326a: vier Szenen,
Hatschepsut/Thutmosis II. vor Amun-Re (Südwand)
Szene 1+2: Thutmosis II. reinigt beide Erscheinungsformen von Amun mit
Natron
Szene 3: Thutmosis wird bekleidet (?) mit dem mit dem Nemes-Kopftuch
vor Amun-Re
Szene 4: Thutmosis II. berührt Amun-Re und salbt ihn.
PM 326b: vier Szenen,
Hatschepsut/Thutmosis II. vor Amun-Re (Nordwand)
Szene 1: Thutmosis II. steht vor Amun-Re
Szene 2: Thutmosis II. opfert Weihrauch vor Amun-Re
Szene 3: Thutmosis II. opfert 4 Vasen vor Amun-Re
Szene 4: Thutmosis II. opfert vor Amun-Re (die Szene ist so stark zerstört,
dass die weitere Handlung nicht mehr zu erkennen ist).
PM 326c: Der König (Thutmosis
II.) weiht Opfergaben vor dem links stehenden Amun (zerstört in der
Amarnazeit) (Westwand)
Raum nördlich des Granitsanktuars
Philipp Arrhidaeus
- Raum XV (PM² 103 [308] -
(Traunecker Raum 2 - Thutmosis III., das sog. "Goldhaus") |
Nördlich des
Granitsanktuars von Philipp Arrhidaios liegt - zwischen den Umfassungsmauern
von Thutmosis I. und Thutmosis III. - eine unter Thutmosis III. errichtete
Raumgruppe, die zu den sog. "Nordmagazinen" gehört.
Raum 15 (bei Traunecker: Raum 2
/ Thutmosis III, das sog. "Goldhaus" war ein Lagerraum nördlich des
Granit-Sanktuars von Philipp Arrhidaeus (direkt an der nördlichen
Umfassungsmauer des Karnaktempels gelegen), der aus der Zeit von Thutmosis
III. stammt.
"Umdekoriert" wurde er
in der 19. Dynastie. Der linke Torpfosten des Zugangs zu dem Raum 15 zeigt
eine Szene (PM 308), in welcher ein König den Gott Amun-Re und die Königin
Ahmose-Nefertari verehrt und ihnen Opfer darbringt. Porter & Moss folgt in
seiner Beschreibung der Kartuschen Paul Barguet (Temple d'Amon-Ré á Karnak,
209-10 n.1), der diese als ´"Sethos II" identifiziert - usurpiert
von Ramses II., während Alfred Wiedemann (Ägyptische Geschichte) die
Kartuschen des Königs als die von Sethos II betitelt, welche dieser über
denen von König Amenmesse usurpiert hatte.
|
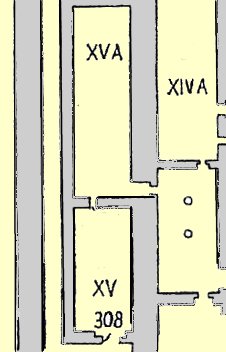
|
Magazin-Raum XV (15)
- PM² 103 (308) -
- modifiziert von Nefershapiland -
Auf dem linken Torpfosten des
Durchgangs zum Lagerraum Nr. 15 befindet sich eine Darstellung, in
welcher der König Amun-Re und die Königin Ahmose-Nefertari verehrt und
ihnen Opfer bringt.
Die Beischrift nennt die Kartuschen
von Sethos II - die dieser evtl. von Ramses II. - oder nach Wiedemann
über die von König Amenmesse usurpiert hatte.
Die Räumlichkeiten stammen aber aus
der Zeit von König Thutmosis III.
|
|
|
Linker Torpfosten des Zugangs
zu Raum 15
des sog. "Goldhauses" von Thutmosis III. (PM² II 103 [308]
) |
|
Bild: mit frdl. Dank Saamunra
- alle Rechte vorbehalten -
|
Bei dem langgestreckten Raum XV.
handelt es sich um einen Raum mit einem "geheimen" Zugang zwischen
den beiden Umfassungsmauern des Amuntempels auf dessen Nordseite. Es ist der
erste Raum des Kammersystems, das in der letzten Bauphase von König Thutmosis
III. am Amuntempel errichtet wurde. Das sog. "Goldhaus" ist nicht zu
verwechseln mit dem gleichnamigen Schatzhaus des Königs. Dieses Goldhaus
diente als Ort, an dem die neu gefertigten Statuen und Ritualgeräte, die für
den Tempel bestimmt waren, rituell belebt wurden. Damit die Statuen
"funktionsfähig" wurden, vollzog man an ihnen die
"Mundöffnung" (lt. A. Schlüter, Ägypten und das Alte Testament,
Nr. 78).
Im oberen Teil der Südwand
befindet sich ein Block (und weitere Blöcke aus dem unteren Teil der
Südwand) auf denen Thutmosis III. das "Mundöffnungsritual" an der
"wsr-HAt"-Barke
("Userhat"-Barke des Amun-Re) vollzieht, damit sie
"funktionsfähig" wird (dahinter folgt eine
Barkenprozession) (PM² II 104 [(310] ). (Siehe dazu: Claude Traunecker
in Le "Chateau de I'Or" de Thoutmosis III et les magasins nord du
temple d'Amon, Cripel 11 / 1989, 89-111).
In Raum XV befindet sich an der
östlichen Nordwand (PM 309, Register 2) eine Szene, in welcher der König -
in Begleitung von zwei Wesiren vor einem Pylon steht. Lt. Wolfgang Helck
(Verwaltungen) sind diese Darstellungen der früheste gesicherte Beweis für
die Teilung des Wesirrats im Neuen Reich. Der Wesir von Oberägypten befindet
sich an erster Stelle in der obersten Reihe. Er ist leicht zu erkennen an
seiner typischen Amtstracht und der begleitenden Inschrift mit dem Titel
"Wesir". Das gleiche gilt für die untere Reihe, in der wiederum an
erster Stelle der Wesir (diesmal von Unterägypten) zu erkennen ist durch
seine Kleidung und seine Titel.
Die Darstellung des Pylons
besteht aus zwei geraden Pylontürmen. Vor diesen befindet sich jeweils ein
Flaggenmast und ein Obelisk. Leider ist der obere Abschluss der Pylontürme
heute verloren, da die oberen Steinlagen der Wand nicht mehr vorhanden sind.
Aufgrund der heute noch sichtbaren Farbreste einer roten Bemalung der
Obelisken und des Türsturzes war das originale Material der Bauteile
vermutlich aus Rosengranit gefertigt. Beiderseits des Tordurchganges stehen
zwei königliche Statuen, wobei die linke Statue die Doppelkrone und die
rechte die oberägyptische Krone trägt. Erhalten geblieben sind von der Figur
des Königs nur noch die Beine sowie der Schurz und ein Teil der linken Hand.
Der König hielt drei Seile in seiner Hand, die hinten in ein "anch-Zeichen"
auslaufen. Hinter dem König folgt ein Diener, der in einem kleineren Maßstab
als der König dargestellt ist.
Die Inschrift dazu lautet:
„Lobpreis geben dem Herrn der Beiden Länder. Die Erde küssen für den
vollkommenen Gott, das Oberhaupt, Leben, Heil, Gesundheit, den König von
Ober– und Unterägypten (Mn–xpr–Ra)|.
Deine Monumente werden bleiben wie der Himmel, deine Lebenszeit wie die
Sonnenscheibe in ihm".
Lt. PM ² II 104 [309] ) könnte
es sich bei dem dargestellten Pylon um den von König Thutmosis III. erbauten
VII. Pylon handeln, aber auch um den Eingang zur Barkenstation von Thutmosis
III. Vor dem Pylon stehen zwei Obelisken und er besitzt zwei Nischen mit
Fahnenmasten. Nach Traunecker ist der König beim Errichten von Obelisken und
Fahnenmasten im Tempel des Amun-Re dargestellt. Der König trägt die Krone
von Oberägypten auf seinem Kopf und hält mehrere Seile in der Hand (mit
deren Hilfe er anscheinend das "Aufrichten der Obelisken und
Fahnenmasten" bewerkstelligt).
Raum XXIV: südlich des Granitsanktuars
Philipp Arrhidaeus
- ursprünglich erbaut durch Hatschepsut, dann
von Thutmosis III.
für sich und für seinen Vater Thutmosis II. umgewidmet - |
Südlich der südlichen Räume des sog.
"Palast der Maat" befindet sich eine Passage mit mehreren
Magazinräumen (?)
Auf der westlichen Seite des
Korridors XXIV (der auf seiner rechten Seite Magazinräume enthält) befinden sich Darstellungen von der Inthronisierung Thutmosis III und ein
Festkalender (auch von Thutmosis III) - am Ostende ein inthronisierter
Sesostris I. - womit wahrscheinlich der Vorgängerkönig geehrt werden sollte,
da seine Anlage östlich des "Palastes der Maat" abgerissen worden
war. Auf der Westwand der südlichen Kammern befindet sich eine Scheintür von
Thutmosis III, die dieser anstelle der Roten Kapelle errichten ließ (siehe
weiter oben Hof VII). Teile der Fundstücke wurden hier aufgestellt - andere
befinden sich hinter dem Barkenschrein des Philipp Arrhidaeus.
|
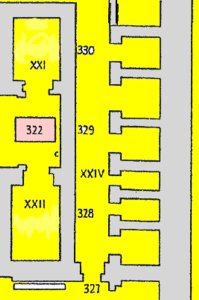
|
Räume und Passage südlich des Sanktuars Ph.
Arrhidaeus
- Südpassage Raum XXIV (24) -
PM 322: Altar(?)-Basis, Thutmosis III. aus Granit
PM 327: Äußerer Türsturz (wieder eingefügt) Thutmosis II.
kniend
- opfert Wein an einen Gott.
PM 328: Thutmosis III. thronend mit seinem Ka und Nil-Gottheiten,
die das "sma"Symbol binden, zwischen 2 Löwen auf der Basis
des Throns und 49 autobiographischen Texten vor dem König.
PM 329: Festkalender von Thutmosis III.
PM 330: id. Darstellung mit PM 328 - nur dass hier Sesostris I.
gezeigt
wird - der zugehörige autobiographischen Text ist hier leider
zerstört.
Plan nach PM XXIV, (PM² II [106-107]
modifiziert von Nefershapiland
|
Noch heute kann man an der Südostecke
der Südwand des sog „ Palast der Maat “ (PM
330) eine nur zum Teil erhaltene Darstellung des thronenden König Sesostris
I. sehen.
Die Darstellung stellt ein fast identisches Gegenstück zu einem Relief der
aus der Zeit Sesostris I., dessen Kalksteinfragmente sich heute im
Freilichtmuseum zu Karnak befindet.
|
Zeichnerische Darstellung der rechten
Trennwand (Südpassage)
zwischen Palast der Maat und den Magazinen - PM² II 106-107
(328-330)
Bild: Mariette, Karnak 1875 |
|
Südkorridor - Raum XXIV
Beginn der Darstellung auf der westlichen Seite der Wand ( PM²
II 106-107 [328-330] ) |
| Thutmosis III. (links im Bild) sitzt in einem Pavillon
auf einem Thron. Das Podium, auf dem sein Thron steht, wird von zwei
Löwen flankiert, die nach außen schreiten. Am Podest, zu welchem auf
der Vorderseite Stufen heraufführen, sieht man zwei Nilgötter, die
das "sma"-Symbol (Semataui-Symbol / Vereinigung von
Ober- und Unterägypten) binden.
Hinter dem König erscheint sein Ka.
Dieses ist eine Kopie einer älteren Darstellung, die sich an
den Wänden eines Vorgängerbauwerks von Sesostris I. aus dem
Mittleren Reich befand und wodurch Thutmosis III. seine
Verehrung für seinen großen Vorgänger zeigt.
Vor dem thronenden König befinden sich die Überreste eines
autobiographischen Textes, der in der Ägyptologie als "Texte de
la Jeunesse" in 49 Spalten bekannt ist. Des weiteren befindet
sich auf der obigen Nordwand des Korridors XXIV ein Kalender mit
religiösen Festen. Die Inschrift besteht zum größten Teil aus einer
Rede des Königs an seine Beamten, während einer Thronsitzung. Darin
schildert Thutmosis III. seine wunderbare Erhebung zum König durch
das "aktive" Eingreifen seines Vaters Amun-Re und seine
Dankbarkeit, die er durch ein Bauprogramm zum Ausdruck bringen will.
Da der König in seiner Rede noch von der "Roten
Kapelle" spricht, die er wohl vollendete, muss die Inschrift
früh in der Zeit seiner Alleinregierung entstanden sein, bevor
Hatschepsut der Verfolgung anheim fiel. Zwei der Tore der "Roten
Kapelle verwendet der König nach deren Abriss anderweitig im
Karnaktempel.
".........Meine
Majestät errichtete nun für ihn eine herrliche xm–Kapelle
(namens) „Lieblingsplatz des Amun“, seine s.t
wr.t (ist)
wie der Horizont des Himmels, aus Sandstein vom „Roten Berg“, sein
Inneres überzogen mit Elektron [ … ]. Meine Majestät [ … ] das
erste Tor (Mencheperres)| (namens) „Amun, mit heiligem Ansehen“,
das zweite Tor (namens) (Mencheperre)|, mit bleibendem Lob bei
Amun“, das dritte Tor (Mencheperres)|, (namens) Amun......."
(Textauszug:
nach Schwaller de Lubicz, Temple of Karnak, S. 623 - übersetzt durch
Nefershapiland) |
|
Bild: Courtesy to Kairoinfo4U
- alle Rechte vorbehalten - |
|
Der Festkalender von Thutmosis III.
- westliche Seite des Südkorridors (PM² II 106-107 [329] ) |
Bild. mit freundl. Dank Peter
Alscher 2009
- alle Rechte vorbehalten - |
Funde:
In der Passage XXIV. fand sich der untere Teil einer Schreiberstatue
Haremhabs aus Sandstein, aus der Regierungszeit Tutanchamuns – heute Kairo, JE
42129
Nördliche Kapellen an der
Umfassungsmauer
- PM² II 124 (440-448) - |
Thutmosis III. ließ
eine Serie von länglichen Kapellen im Norden des Tempels (nördlich des
Mittleren Reich-Hofes), östlich der Sed-Fest-Kammern, bauen und umgab dann das
Ganze mit einer 3. Umfassung. Die Dekoration dieser nördlichen Kammern
erfolgte zumeist unter Thutmosis III. Nach Porter & Moss wurden diese
Räume im Verbund mit dem Achmenu errichtet.
Diese Räume werden in der einschlägigen Literatur
meist als "Magazinräume" bezeichnet, wobei ihre Einordnung - neben
der Lage der Räume - auch auf ihren erhöhten Boden basiert. Diese Art von
Räume findet man ebenfalls im Ach-Menu von Thutmosis III und ebenfalls noch
in den nur noch fragmentarischen Räumen von Thutmosis I. zwischen dem
Mittleren Reich Hof und dem Ach-Menu.
Die Räume beginnen mit dem
"Raum 9"(bei PM nicht benannt), der sich heute in einem sehr desolaten Zustand befindet
und wo sich auch einer der Zugänge (im Westen) zu den Kapellen befindet. Eine
Dekoration ist nicht mehr zu erkennen - außer ein Rest von einer
hieroglyphischen Inschrift und eine Inschrift außerhalb des Raumes, welche
sich auf dem Türrahmen befindet. Im Gegensatz zu den Räumen 4-8 (nach
Traunecker / XLIV, XLIII, XLII, XLIA und XLIB) scheint dieser Raum keinen
Trennboden für ein oberes Stockwerk gehabt zu haben. Die Funktion dieses
Raumes ist unbekannt.
Lt. Traunecker - und auch nach
Porter & Moss gibt es einen direkten Zugang vom Mittleren Reich Hof aus in
Raum 9 und von hier aus gab es einen Zugang in den Altarraum (Raum XXXV nach
PM) mit einem Sonnenaltar.
Der Raum XVA
(unten) hat aber nur einen Zugang vom Mittleren Reich
Hof (nicht wie bei PM fälschlicherweise angedeutet, auch vom unteren Raum
XV). Uns liegen keine Informationen über die Funktion von Raum XVA vor (Raum
3 bei Traunecker). In
Raum XLIV befindet sich eine Treppe, die aber bei PM nicht eingezeichnet ist
(siehe dazu Traunecker: Le "Chateau de l'Or" de Thoutmosis III et
les magasins nord du temple d'Amon, 1989). In Raum XV (Traunecker Raum 2)
befindet sich ein Mundöffnungsritual mit der rituellen Reinigung aller
Objekte (Barguet, Karnak 1962)
|
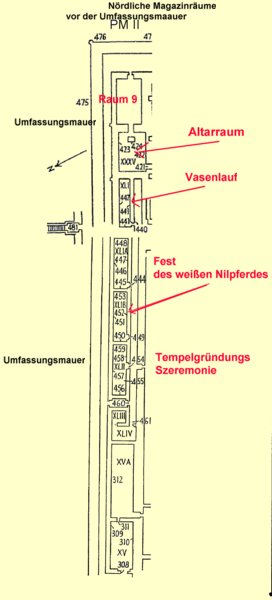
|
Nördliche Räume vor der Umfassungsmauer
PM² II 124ff (440-461)
Zwei Türen ermöglichen den Zugang zu den
Nordkapellen an der nördlichen Umfassungsmauer, in denen Szenen des
"Rituals der Grundsteinlegung" dargestellt sind.
Diese rituellen Szenen zeigen u. a.:
-
Vasenläufe und Opferzeremonien
-
Das Fest des weißen Nilpferdes
-
und Tempelgründungs-Zeremonien
a) Errichten des Shenet (sHn.t) für
Amun (Aufrichten eines
Mastes vor Amun-Re)
b) Reinigen des Geländers mit Natron
c) Anfertigen von Lehmziegeln u.a.
Plan: nach Porter & Moss XII
- modifiziert von Nefershapiland - |
Gründungszeremonien
und Weihe des Tempels mit Natron (Salz)
- Raum 5 (nach Traunecker) und Raum XLII nach Porter & Moss - |
| Die Inschrift dazu lautet: S. M. ordnet an, dass die
Gründungszeremonie bei der Annäherung an den Tag des Neumond-Festes
vorbereitet werden sollte......Im Jahr 24, 2. Monat der 2. Jahreszeit,
dem letzten Tag (des Monats) am Tag des 10. Amun-Festes.......(und
Amun selbst leitete das erste Fest des "Spannens der Schnur mit
dem König) (Quelle: Schwaller de Lubicz, The temple of Karnak, S.
624-625).
Von links: (die Eingangsszene fehlt: Thutmosis III. beim
Betreten des Tempels)
- der König mit der Atefkrone beim "Aufhacken" des
Bodens,
- der König kniet und fertigt die Lehmziegel an, der König
- der König - mit der Göttin Seshat - beim Spannen der
Stricke (Einmessen des Tempels)
- der König mit der Atefkrone reinigt das Tempelgelände mit
Natrom (Salz)
|
|
Bild: Barguet, temples P. XXXIA 1962) |
In
der nächsten Kapelle (XLIB bei PM; Raum 6 bei Traunecker) befindet sich eine
äußerst seltene Szene, die eine Darstellung des "Festes des weißen
Nilpferdes" (Hb-HD.t) zeigt.
Es gibt wohl nur ein einziges weiteres Beispiel für diese Zeremonie, das auf
einem Fragment aus der Saitenzeit dargestellt ist, welches sich heute im
Museum Brüssel befindet.
Die
in den Nordkammern von Thutmosis III. dargestellte Szene zeigt den König
(Thutmosis III.) mit der roten Krone von Unterägypten, der in beiden Händen
einen Stab (Speer ?) und die weiße Keule in seinen Händen hält. An seiner
linken Schulter hängt ein langer Stoffstreifen (?) herab, der evtl. aus
Giraffenfell gearbeitet wurde (Quelle: Werner Kaiser, MDAIK 70/71). Hinter dem
König befindet sich eine Inschriftenkolumne (mit den Zeichen für
„die beiden halben Himmel“) welche die Szene als „großes Schreiten“
bezeichnet. Vor ihm stehen zwei - in einem kleineren Maßstab dargestellte -
"tanzende Figuren", über deren Köpfe jeweils der Name einer Stadt
steht: die Personifizierung (?) von "wTz.t"
(Edfu) und "jm.t"
(Buto).
Der König vor dem
"Weißen Nilpferd"
- und darunter zwei "tanzenden Figuren" als
Personifizierung für die Städte Edfu und Buto. |
Bild: Courtesy to Kairoinfo4U
- all rights reserved - |
Über ihnen befindet sich ein
Flusspferd auf einem Schlitten (die Darstellung des Flusspferdes wurde zu
irgendeinem Zeitpunkt ausgehackt), der Begleittext spricht vom „Fest des weißen
Nilpferdes" (PM² II 125 [451] ). Das weiße weibliche Nilpferd ist zu unterscheiden
von dem männlichen „roten Nilpferd", dem Feind von Horus, es
handelt sich beim Weißen um eine Erscheinungsform der Göttin Apet.
|
Umzeichnung der obigen Szene des Festes "des
weißen Nilpferdes" |
|
Bild: aus MDAIK 70/71 nach Werner Kaiser |
Im gleichen Raum, östlich der
obigen Szene ist eine Darstellung zu sehen (PM² II 125 [451, Szene 4] ),
welche die "Errichtung des Min-Mastes" zeigt. In dieser Szene trägt
der König die weiße Krone von Oberägypten und hält in einer Hand einen
langen Stock und die weiße Keule. In der anderen Hand trägt er das "nehbit"-Zepter
im Weihegestus. Die Inschrift darüber ist nicht sehr eindeutig (?): "
Errichten des Ka des shn.t für Amun
dem Herrn der Throne der Beiden Länder, wohnhaft in Ipet–sut “. Vor dem
König befinden sich zwei Reihen von Männer beim Aufrichten eines erhöhten
Mastes, der von vier Stangen gestützt wird. Kleine Figuren - jede mit einer
Feder auf dem Kopf - klettern auf die Stangen (PM² II 125 [451, 4). All diese Szenen beziehen sich
auf das Tempelfundament.
Raum 6 (nach Traunecker) - PM XLI B:
Auf den Eingangs-Türpfosten (innen
und außen) befinden sich die königlichen Namen und Titel (PM² II 125 [449]
). Über dem inneren Türsturz sind Opfergaben zu sehen. Auf der westlichen
Querwand weiht Thutmosis III. Opferständer mit Vasen vor Amun-Re-Kamutef
(PM² II 125 [450].
|
Raum 6 (Traunecker) - Nördliche Räume PM XLI B
westliche Querwand PM 450 |
| Thutmosis III. weiht Ständer mit Vasen an
Amun-Re-Kamutef |
|
Bild: Courtesy to Kairoinfo 4U
Alle Rechte vorbehalten - |
Raum 8 (nach Traunecker) - PM XLI:
Porter und Moss sahen die nördlichen
Räume im Verbund mit dem Achmenu und trennten diese in zwei Teile. Die Räume
4-8 werden unter der Gesamtüberschrift "Festival Temple"
beschrieben und die Räume 2-3 unter "Räume nördlich der Umfassungsmauer.
|
Nördliche Magazinkammern - Raum XLII (PM² II,
126 [456] ) mit erhöhtem Boden
- Westwand, (Raum 5 bei Traunecker) - |
In einer Doppelszene umarmt Thutmosis
III. jeweils den ithypalischen Gott Amun-Re-Kamutef.
Die Götterfiguren wurden in der Amarna-Zeit gelöscht und später
wieder eingesetzt. |
|
Bild: Courtesy to Kairoinfo 4U
Alle Rechte vorbehalten - |
Die Nordwand dieses Raumes zeigt vier Szenen:
Thutmosis III. wird durch Thot und Horus gereinigt; zweimal der thronende
König, vor den Göttern Thot und Seshat
und zwei Reihen mit je 3 mal den knienden Seelen von Nechem und Pe. In der
dritten Szene ist der König mit Thot zu sehen, der den "heb-sed"
Text auf die Palmrippe schreibt und die letzte Szene zeigt den thronenden
König, der auf eine Tafel schreibt und eine "heb-sed" Rispe, in
Anwesenheit von weiblichen Opferbringern vor Amun-Re.
|
Nördliche Magazinkammer Raum 5 (Traunecker) / PM
Raum XLII - nördliche Wand |
| Der thronende König (PM² II 126 [457] ) schreibt
"heb-sed"-Texte auf eine Schreibtafel. Davor die knienden
Seelen von Nechen und Pe. Über dem König befinden sich seine
Kartuschen. |
|
Bild: Courtesy to Kairoinfo4U
- alle Rechte vorbehalten - |
Auf der Südwand (PM² II 126 [459] ) erscheint
der König mit der Doppelkrone auf dem Haupt in einer Doppelszene und weiht
die Opfergaben eines Opferaufbaus vor dem thronenden Amun-Re.
Raum 4b - (XLIII nach PM):
In diesem Raum befindet sich ein Türdurchgang, der
zwischen der inneren Umfassungsmauer durch die nördlichen Kammern zur
äußeren Umfassungsmauer führt. Auf der Südseite des Raumes (äußerer
Türpfosten PM 460+461) befinden sich die königlichen Titel und Namen. Die
Treppe, die zu Raum 4b führt ist die einzige heute noch erhaltene in diesem
Bereich. Der Raum weist ansonsten keine Dekorationen auf.

Achmenu - siehe hier
Außenmauer des
Tempelhauses
- Südseite
- |
|
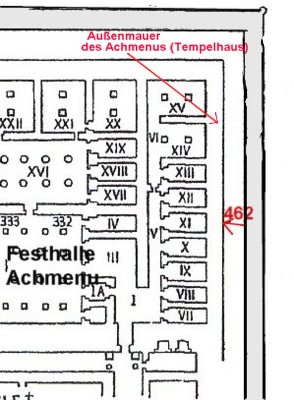
|
Umfassungsmauer
des Achmenus außen
Auf der Südseite der
Mauer - außen in Höhe der Magazinräume (PM² II 126 [462] ) - befinden
sich Reste eines langen Textes von Thutmosis III, in dem er sich bei
Amun-Re für den Sieg in Megiddo bedankt. Erwähnt wird in diesen
Inschriften auch sein "Ältester Sohn Amenemhet" (früh
verstorben) mit Szenen des thronenden Könis links und einem
Festkalender auf der rechten Seite.
Plan
nach PM XII
- bearbeitet von Nefershapiland - |
Gefunden wurden in diesem Bereich:
-
Eine Statue Thutmosis III. aus Granit. Die Beine
sind zerstört. Die Statue wurde im langen Korridor V-VI gefunden und
befindet sich heute im Museum Kairo (CG 594)
|

|
"Beter"-Statue
Thutmosis III.
(Museum Kairo CG 594)
rötlicher Granit, H. 1,77 m
- gefunden 1860 Südseite der Außenmauer um das Achmenu -
Bild : gemeinfrei
Ludwig Borchardt (1863-1938 Statuen
|
2. der untere Teil einer Kniestatue von
Thutmosis III. aus Alabaster - heute im Museum München (GI 88)
|

|
Kniestatue Thutmosis III.
München Gl 88
Kalzit, H. 51cm, B. 36cm, T. 63cm
Fundort: Festtempel Thutmosis III, Karnak
Bild:; Courtesy to Elvira Kronlob
- alle Rechte vorbehalten - |
3. Kopf Thutmosis III. (oder Amenophis II.) aus
Granit, gefunden in diesem Bereich (oder in der Pfeilerhalle ?) Kairo, CG
42067 (siehe
Legrain, Statues pl. xl, p. 40) JE 34627.
4. Torso, Thutmosis III aus
Sandstein - gefunden nahe der nordöstlichen Ecke der Umfassungsmauer -
heute im Museum Kairo CG 42064,
(siehe Legrain, Statues, i. pl. xxxvii, p.38) JE 38238.
5. Opfertisch (Thutmosis III)
mit Erwähnung des Achmenus aus Granit, Originalherkunft evtl. Achmenu
(siehe PM² II, 127 Finds)
6. Kopf von Thutmosis III mit
Falkenkopf (von einer Szene auf einem Pfeiler) (siehe Lepsius III, 33)
Nilometer
- zwischen Haupttempel und
Heiligem See - |
Thutmosis III. ließ
zwischen dem Haupttempel des Amun-Re und dem Heiligen See ein Nilometer
errichten. An den Seitenwänden - rechts vom Eingang - befinden sich Fragmente
eines "heb-sed"-Textes (mit dem Namen von Thutmosis III).
| Der Osttempel Thutmosis III. /
Gegentempel |
Auf der
Rückseite des Achmenus (Ostmauer) und der Rückseite des Amun-Sanktuars
befinden sich noch einige Überreste eines weiteren, ungewöhnlichen Baus in
Karnak, das aus der frühen 18. Dynastie stammt. Bei der Errichtung des
Achmenus unter Thutmosis III. wurde ein kleines Heiligtum der Hatschepsut
verändert oder sogar entfernt welches auf die aufgehende Sonne ausgerichtet
war. Von diesem kleinen Heiligtum der Hatschepsut sind noch weniger Spuren
erhalten als vom Osttempel Thutmosis III.
Dieser sogenannte
Osttempel (oder Gegentempel) war von außen an die damalige Umfassungsmauer
des Karnak-Tempels angelehnt. Das Gebäude bestand im Kern hauptsächlich aus
einem Götterschrein für Amun.
Der Osttempel Thutmosis
III. besteht in seinem jetzigen Zustand aus einem riesigen Alabastermonolithen
von Thutmosis III - flankiert von zwei seitlichen Kammern zwischen einem
großen Saal, der sich nach Osten öffnet und dessen Fassade von viereckigen
Säulen geschmückt ist, die außen mit Statuen im Osiris-Gewand dekoriert
sind und die durch Interkolumnial-Mauern verbunden sind.
|
Alabasterschrein mit Doppelstatue |
|
Bild: Peter Alscher, Kümmersbrück 2009 |
|
Frontseite des Osttempels Thutmosis III. mit
osiden Statuen |
|
Bild: Osttempel
Autor: Olaf Tausch 2011
Lizenz: CC
BY 3.0 |
Die gesamte Gruppe von
Strukturen wird von den Basen von zwei zerbrochenen Obelisken der Königin
Hatschepsut eingerahmt, die heute in je einer Kapelle (Süd- und Nordkapelle)
von Nektanebos I. eingeschlossen sind.
|
Plan-Zeichung Oststempel
Thutmosis III. |
PM 4-9 = Fassade mit 6 osiden Figuren Thutmosis III.
PM 18+19 = Alabaster Naos - enthält Reste einer Doppelstatue
Thutmosis III. mit Amun (verstümmelt unter Echnaton).
PM 32+33 = Südl. Obelisk mit Basis in situ und Architrav von
Thutmosis III. auf dem Kopf gestellt;
Nördl. Obelisk, Teil des Pyramidion lt. PM gegen die Ziegelwand
östlich des Tempels gelehnt - Amun auf der einen Seite. |
PM 10-13 = Interkolumnar-Wände mit Nil- und
Feldgottheiten und text, königl. Titeln (er überlagert einen
früheren Text)
PM 20+24 = Pfosten und Durchgang, Titel von Thutmosis III |
|
Zeichnung Plan: nach Porter & Moss
- bearbeitet von Nefershapiland - |
Hinter der Front mit den osiden
Pfeilerstatuen folgt eine schmale, rechteckige Querhalle, von der nach Osten
vier Räume abgehen. Thutmosis III. ersetzte das in der Mitte befindliche
Sanktuar von Hatschepsut durch einen neuen Naos, der aus einem einzigen
monolithischen Alabasterblock gefertigt war. Diese Kapelle enthielt eine heute
- teils zerbrochene - Doppelstatue des Königs, gemeinsam mit dem thronenden
Amun-Re. Der Naos wurde flankiert von zwei Kammern mit Szenen, die den
Iunmutef-Priester vor einem Opferaufbau zeigen. Von der südlichen Wand ist
der östliche Teil zerstört, hier hat sich auf der Innenseite auch eine
Dekoration befunden. Auf der nördlichen Außenwand des Naos ist der König zu
sehen, der sich an zwei übereinander angeordneten Reihen von je fünf
Göttern wendet, bei denen es sich um Amun-Re ("in all seinen
Namen") handelt. Auf der südlichen Außenwand hat sich, wie die zwei
erhaltenen Götterreihen zeigen, eine identische Szene befunden (Quelle:
Dissertation Ute Rummel, Pfeiler seiner Mutter - Beistand seines Vaters)
Unter König Nektanebos I. wurde
links und rechts dieser Kapelle je ein weiterer Raum an den Osttempel angebaut.
Der älteste Teil des
heute fast 45m langen und etwa 10m breiten Ptah-Tempels besteht aus Kapellen,
denen ein Portikus und ein Innenhof im Namen von Thutmosis III. vorangehen.
Thutmosis ließ den Tempel nach seinem 23. Regierungsjahr nördlich der
damaligen Umfassungsmauer des Amun-Re-Tempels (heute innerhalb der
spätzeitlichen Umfassungsmauer beim Nordtor) erbauen und ihn für den
memphitischen Gott Ptah weihen. Der Gott Ptah ist ein sehr alter ägyptischer Gott, der wohl aus
dem Alten Reich stammt, wo sein Kult in der Region Memphis entstanden ist.
Sein Tempel in Karnak besteht aus drei miteinander verbundenen Heiligtümern,
die zusammen mit Ptah und der memphitischen Triade geweiht sind, zu der auch
Sachmet und Nefertum gehören. Die vorgebauten Pylone stammen aus der
Ptolemäerzeit. Interessant ist, dass die
Ptolemäer die königlichen Kartuschen ihrer Vorgänger nicht usurpierten,
sondern sie reparierten und Beschädigungen beseitigten sowie fehlender Teile
mit den Namen der ursprünglichen Erbauer restaurierten.
Die Wanddekorationen des
thutmosischen Tempelkerns zeigen Veränderungen aus der Ptolemäerzeit - der
Rest zeigt Thutmosis III beim Opfer vor den Gottheiten. In der Vorhalle
befinden sich Szenen mit Ptah, Amun-Ptah-Chons-Mut-Hathor (davor ein
Restaurierungstext von Haremhab), Ptah, Amun-Ptah und drei Nilgötter. Hier
dominiert eindeutig der Gott Ptah. In der zentralen Kapelle des Sanktuars
sehen wir Thutmosis III. beim Weinopfer vor den Göttern Amun-Re, Ptah und
Mut. In einer anderen Szene wird der König vor Ptah von Amun-Re umarmt.
Legrain begann seine
Ausgrabungsarbeiten am Ptah-Tempel um 1900 und entdeckte dabei eine Statue von
Djehuty (Vorsteher der Getreidehäuser des Amun unter der Regierung von
Thutmosis III.) aus schwarzem Granit. Die Statue war 0,84 m hoch und wurde in
der nordöstlichen Ecke des Ptah-Tempels entdeckt (Cat.-Nr. Legrain: 42123),
und wurde dann nach Kairo verschifft.
Zu einem späteren Zeitpunkt
wurden fünf Tore zu dem schmalen Bauwerk aus der Zeit Thutmosis III.
hinzugefügt. Zwischen dem 4. und 5. Tor fand man eine große Granitstele,
welche den Namen von Thutmosis III. trug, die den folgenden Text trug:
"Meine Majestät befahl, dass der Tempel des
Ptah südlich seiner Mauer in Theben gebaut wird, der eine
Station.......meines Vaters Amun-Re, des Herrn von Theben ist. Siehe, Meine
Majestät fand diesen Tempel, welcher aus Ziegeln und Holzsäulen erbaut war,
und seine Tür aus Holz fing an, zu verfallen. Meine Majestät befielt, die
Schnur über diesen Tempel, der aus feinem, weißen Sandstein errichtet ist,
und die Wände ringsum aus Ziegeln neu zu spannen, als ein Werk, das für die
Ewigkeit Bestand hat. Meine Majestät errichte dafür Türen aus neuem
Zedernholz, der besten der Terrassen [Libanon], montiert mit asiatischem
Kupfer.......Ich überzog für ihn seinen großen Sitz mit Elektron aus den
besten Ländern. Alle Gefäße waren mit Gold und Silber, und jeder
prächtige, kostbare Stein, Kleider von feinem Leinen, weißem Leinen.....um
seine gefälligen Zeremonien bei den Festen zu Beginn der Saison
durchzuführen" (Quelle:
Breasted, Anient Records, vol. 2 §§ 614-15).
Während der Regierungszeit von
Thutmosis III war die große Umfassungsmauer des Amun-Bezirks viel kleiner als
die heute noch sichtbare (die wahrscheinlich aus der 30. Dynastie stammt). Das
ursprüngliche Heiligtum von Thutmosis III. stand wahrscheinlich in einer
Verbindung mit einem Prozessionsweg zwischen der Domäne des Amun-Re und den
nördlichen Heiligtümern von Karnak. Unter den Ptolemäern wurde die
Westseite des Gebäudes von Thutmosis III. renoviert und erhielt einen neuen
Seitenzugang von Süden her, zwei kleine Räume und eine Treppe. Auch der
Innenhof aus dem Neuen Reich wurde radikal verändert und erhöht, überdacht
und zu einem durch Obergadenfenster erhellten Raum umgebaut.
Bauinschriften:
Aus der
Zeit von Thutmosis III. sind nur wenige Bauinschriften erhalten - der Rest
einer Weiheformel befindet sich an der um das Hofdach herumlaufenden
Brüstung: "[(Werk des) Men-cheper-re, das
er gemacht hat für seinen Vater] [.......] aus Sandstein....."(5).
Zwei weitere sekundäre
Bauinschriften befinden sich in der Osthälfte des Hofes und wurden am
westlichen Ende des Portico auf dessen Seitenwänden in Form von drei
Textkolumnen niedergeschrieben.
Auf der Rückseite der
Eingangstür des Tempelhauses befinden sich beidseitig des Durchgangs
ebenfalls Weiheformeln, welche den Bau des Tempels aus Sandstein behandeln: "(Werk
des) Men-cheper-Re, das er gemacht hat als sein Denkmal für seinen Vater
Ptah, Herrn der Maat (nämlich) das Machen für ihn eine Hw.t–nTr
aus Sandstein......."(5).
Insgesamt gab es 7 Tore, durch
die man ins Sanktuar des Ptah gelangte. An der Außen- und Innenfassade des 1.
Tores, das durch eine Umfriedung aus gebrannten Ziegeln führt, sind die
Kartuschen von Ptolemaios VI eingraviert, und an den Innenfassaden des
Durchgangs befinden sich die von Ptolemaios XI und Ptolemaios XIII. Auf den
Torpfosten dieses Portals befindet sich eine Darstellung von Nefertum, der
eine Lotosfeder mit zwei langen Federn auf seinem Kopf trägt-
Die 2. und 4. Tür tragen den
Namen von Shabaka, der aber irgendwann später herausgehauen wurde. Während
die ersten beiden so konstruiert sind, dass sie einen Türsturz haben, sind
die folgenden drei, die dem Pylon vorangehen, vom Typ "gebrochener
Sturz" und werden von einem Gesims und einem Torus gekrönt. Der 3.
Durchgang trägt den Namen von Ptolemaios XIII und besteht aus zwei
ineinandergreifenden Säulen. Zuletzt dient das 5. Portal als Eingang zu einem
Portikus aus vier sehr eleganten Komposit-Säulen (Höhe 5,25 m) von
Ptolemaios III. Das Portal, das zum Portikus führt, trägt die Titeln und
Namen von Thutmosis III. (Quelle: nach Schwaller de Lubicz, S. 673, Thames
& Hudson). Auch das 6. Tor trägt eine Inschrift von König Thutmosis III,
der auf der Darstellung die weiße Krone von Oberägypten und auf der anderen
Seite die rote Krone von Unterägypten trägt.
Gründungs-Stele
des Thutmosis III. (PM² II 198 [6] )
Thutmosis III. ließ eine Stele mit der Gründungsinschrift des Tempels
aufstellen, die sich heute im Museum Kairo (CG 34013) befindet. Auguste
Mariette (siehe G. Legrain in ASAE 3, 1992: 107) fand diese Weihestele aus
grauem Granit 1899 in situ auf der Ostseite der Ziegelmauer (PM²
II 198 [6] ), welche das 4. Tor des Ptah-Tempels mit der Umfassungsmauer des
Amun-Re-Tempels verbindet. Nachdem unter Echnaton
in der Inschrift nicht nur der Name des Amun, sondern sämtliche Götternamen
getilgt worden waren, wurde bei der Restaurierung unter Sethos I. einige Stellen,
an denen zuvor eindeutig der Name des Ptah gestanden hatte, fälschlich durch
den des Amun ersetzt.
Im Bildteil (Lünette) der Stele
befindet sich eine Doppelszene, in welcher der König - jeweils gefolgt
von der Großen königlichen Gemahlin Sitioh mit dem Schmuck einer
Gottesgemahlin, in einer antithetischen Szene vor dem auf einem kleinen Podest
mit einem Komposit-Szepter in der Hand stehenden Gott Ptah, steht. Der König
opfert aus zwei "nw"-(nun-) Gefässen: links Wasser (das Wasser der
Reinigung) und rechts Wein. Er trägt das "nemes"-Kopftuch
und den Uräus. Die Große Königliche Gemahlin Sitioh bringt eine Opferspende
von Salb-Öl dar. Diese Darstellung der Sitioh/oder Sat-Jah gehört zu den
wenigen Denkmälern, die von der 1. Hauptgemahlin Thumosis III. erhalten ist.
Ursprünglich stand bei dem Namen der Königin ein anderer Name, denn der Name
"Sa.t JaH" (Sat-Jah)
füllt die Kartusche (nach Urk. IV 764) bei weitem nicht aus (siehe Anm. 1348
in ÄAT Bd. 54, Peter Beilage - Aufbau der königlichen Stelentexte,
Harrassowitz-Verlag 2002, S., 452).
|
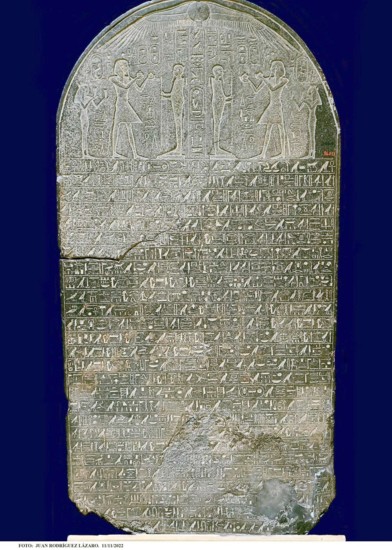
|
Stele Thutmosis III. -
Ptahtempel
heute im Museum Kairo CG 34013 /JE 34642
- Höhe 1,44m x Breite 0,75m -
In der Inschrift der Stele erwähnt der König,
er habe einen im Verfall befundenen Ziegelbau vorgefunden, dessen Säulen
und Türen aus Holz bestanden, und habe an dessen Stelle einen Bau in
dauerhaften Stein errichtet.
Lünette der Stele aus dem Ptahtempel
Bilder: Courtesy to Juan R. Lazaro
- all rights reserved - |
Zum Tempel
selbst:
Der älteste Teil des Tempels wurde unter Thutmosis
III. erbaut und besteht aus einem Dreifachschrein, mit einer axialen Kapelle
und zwei Seitenkapellen. Die zentrale Kapelle war dem Reichsgott Amun-Re
geweiht war - die südliche Kammer gehörte der Göttin Hathor und die
nördliche dem Namensgeber des Tempels, dem Gott Ptah. Der Bau war
ursprünglich wohl als Stationskapelle für die Götterprozession gedacht. Vor
den Kapellen befindet sich ein Portikus mit zwei oktogonen Säulen, davor ein
kleiner Vorhof.
|
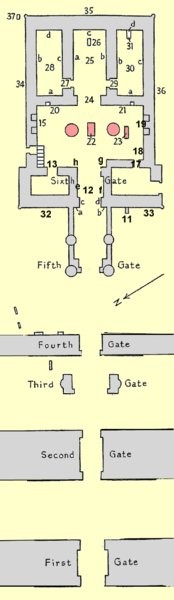
|
Tempelplan Ptah-Tempel, Karnak
PM 11: Oside Statue Thutmosis III
PM 12a-b: Ecke, Erneuerungs-Text Ptolemäios IV, Türsturz,
Restorations-
text für Thutmosis III,
Torpfosten: Thutmosis III beim Eintreten mit
Torname, erneuert von Ramses III (ptolemaische
Arbeit) darüber
PM 12c+d: Ptolemäisch
PM 12e-f: zwei Szenen: Thutmosis III vor Amun-Re; vor Ptah - mit
Erneuerungs-
Text von Ptolemäios IV; f)
Erneuerungstext von Ptolemäios IV.
PM 12g-h: Türsturz, Titeln Thutmosis III, Torpfosten: Erneuerungs-Text
Takeloth I.
und von Thutmosis III. bei
h).
PM 13+14: Halle: Ptolemäios IV Philopator vor den Göttern
PM 15: Thutmosis III mit seinem Ka, opfert Weihrauch an Ptah
(zwischen Nischen)
mit Weihetext von Thutmosis III oben.
PM 18: Amun, Ptah, Chons, Hut und Hathor mit Priesterliste hinter ihnen
und Reste
eines
Restorationstextes (Jahr 1) Haremhab oben.
PM 19: 2 Nischen mit kgl. Titeln auf Türsturz und Torpfosten; Szene
darüber:
Thutmosis III mit seinem Ka und Weihetext, opfert Wein an Ptah.
PM 20+21: 2 Register an jeder Seite des Durchgangs: Thutmosis III
übergibt
Weihegaben an Amun und Ptah, II. Reg.: 3 Nilgötter und Nischen mit
Titeln
bei PM 20 und 3 Nilgötter und Nische mit Titeln bei PM 21.
PM 22: Opfertisch Thutmosis III aus Granit
PM 23: Opfertisch von Amenemhet I. aus Granit; Statuenbasis des Mahu,
Richter
der südlichen Stadt (Fragment aus Granit).
Sanktuar:
PM 24: Äußerer Türsturz: Doppelszene: König opfert Wein an Amun,
Ptah und
Hathor (linke Hälfte) und an Mut (rechte Hälfte) Türpfosten: König
wird
von Amun umarmt vor Ptah und König beim Eintreten (Ptolemäisch ?) |
Plan:
Temple of Ptah, Karnak
(nach Porter & Moss² II 200 [11ff )
- modifiziert von Nefershapiland - |
PM 25: a) König opfert Weihrauch und opfert vor
Ptah b) Wein und Opfergaben an Hathor c) weiht Opfergaben an
Amun-Re.
PM 26: Statue des Ptah (kopflos) mit König kniend davor (Fragmente
aus Granit und unbeschriftet)
- ebenfalls hier gefunden: kopflose Statue der Hathor aus Granit -
jetzt in Kairo, CG 38888.
PM 27: Äußerer und Innerer Durchgang: Thutmosis III mit Opfergaben
oben auf dem Inneren Türsturz
PM 28: a) Thutmosis III streut Sand vor Ptah b) opfert Natron;
reinigt; anbetend c) zwei Szenen: Thutmosis III
vor Ptah: opfert zwei Vasen und wird umarmt d) Thutmosis III. salbt
Ptah.
PM 29: Durchgang wie PM 27
PM 30: Szenen wie bei PM 28 mit Hathor anstelle von Ptah
PM 31: Statue der Sachmet
PM 32: König vor Ptah und Gottheit mit demotischen Graffiti
dazwischen
PM 33: Ptah, Falke und Graffiti einer Gottheit
PM 34: Ptah vor Osiris und Graffiti
PM 35: Ptolemäische Szenen, Ptah,
PM 36: Doppel-Szene, Spätzeit: Thot vor Ptah und Hathor links und
Ptah und Thot rechts.
PM 37: Statue des Djehuti, Aufseher der Getreidesilos des Amun
(Kniestatue und hält Statuenbasis vor sich (?)
Granit, Zeit Thutmosis III - heute in Kairo CG 42123. |
Das Fundament des Baus
besteht aus zwei Schichten grob verlegter Blöcke, wobei die erste Schicht aus
Kalksteinblöcken und die zweite aus Sandsteinblöcke besteht. Es handelt sich
bei diesem Material um wiederverwendete Blöcke, welche den Namen von
Hatschepsut, aber auch den von Thutmosis III. tragen. Sie stammen von
Türpfosten einer heute nicht mehr vorhandenen Toranlage eines unbekannten
Bauwerks, das dem Reichsgott Amun-Re geweiht war. Die Dekoration an den
Innenwänden der Kapellen und an den Mauern des Portikus stammen von Thutmosis
III, während die am südlichen Teil des Vorhofes von König Eje und Haremhab
stammen. Am nördlichen Teil des Vorhofes stammt die Dekoration von König
Ptolemaios IV.
Der Tempel besteht aus sechs
kleinen, dicht beieinander gebauten Toren. Das erste im Westen (siehe Plan
oben) wurde von den Ptolemäern erbaut. Das zweite Tor ist eine Nachbildung
des ersten, wirkt aber viel geschlossener. Der dritte Durchgang enthält zwei
verbundene Säulen, die mit dem vierten Tor verbunden sind. Das fünfte Tor
dient als Eingang zum Portikus aus vier zusammengesetzten Komposite-Säulen.
Das sechste und letzte Tor durchquert die Pylone und führt direkt in das
zentrale Heiligtum. Hier befindet sich eine Statue des Gottes Ptah und die
Heiligtümer von ihm und Sachmet.
|
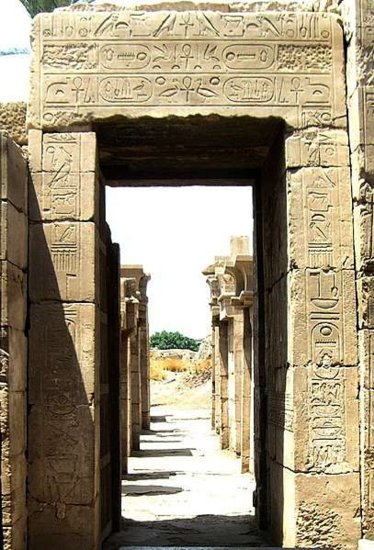
|
Rückseite des 6. Tores
von Thutmosis III.
gesehen vom Tempelinneren nach aussen
Auf dem rechten Türpfosten und
dem Türsturz befinden sich die Kartuschen von Thutmosis III. Auf dem
linken Pfosten sind die Namen von Takelot II. eingraviert. |
Bild:
Karnak
Ptah 07.jpg
Autor: Neithsabes, Wikipedia 2005
Lizenz: CC
BY 3.0
|
|
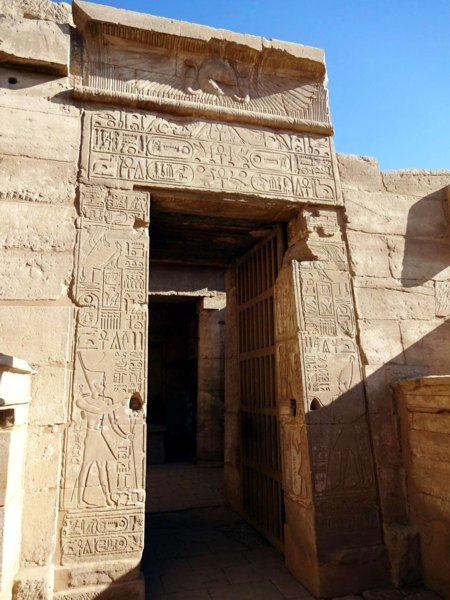
|
Fassade des Tempelhauses des Ptah
mit Tor Nr. 6 von Thutmosis III.
PM² II 198 [12a+b].
Erneuerungstext von Ptolemäios IV auf dem Türsturz
mit Restaurationstext für Thutmosis III auf den Torpfosten
Dekoration auf den Türpfosten:
Thutmosis III. beim Eintreten in den Tempel
links: mit unterägyptischer Krone;
rechts: mit oberägyptischer Krone
- darunter Name des Tores, erneuert von Ramses III (ptolemäische Arbeit
darunter). |
|
Bild: mit frdl. Dank Saamunra
- alle Rechte vorbehalten -
|
Die größten Veränderungen und
Anbauten erlebte der Tempel wohl unter den Königen Ptolemaios III. und IV.
Das originale Zugangstor aus der Zeit Thutmosis III. wurde stark veränderte
und es wurden zwei begehbare pylonartige Anbauten links und rechts an das Tor
angesetzt. Außerdem wurde ein Säulenportikus von Ptolemaios III / IV
davorgesetzt. Der bislang offene Vorhof bekam eine Abdeckung mit Steinbalken.
Von Ptolemaios IV stammt das Tor 1, der eigentliche Zugang zum Tempelbezirk
und als letztes Bauprojekt am Ptahtempel entstand das Tor 3, das von
Ptolemaios XII errichtet wurde - es lag zwischen den beiden Toren, die von
König Schabaka aus der 25. Dynastie erbaut wurde. König Takelot II. ließ an
der Rückseite des Tores 6 (von Thutmosis III) am linken Türpfosten seine
Kartuschen anbringen. An der äußeren linken Tempelvorderfront
(PM² II 201 [32] ist Thutmosis III. vor Ptah und einer Göttin zu sehen - mit
demotischem Graffitti dazwischen. Auf der rechten Seite der Tempelvorderfront
befindet sich ein Relief das Ptah, einen Falken und ein Graffiti einer
Gottheit zeigt - dazwischen eine oside Statue Thutmosis III (PM 11). Auf der
linken Außenwand des Tempelhauses (PM² II 201 [34] ) steht Ptah vor Osiris
und einem Graffiti.
|
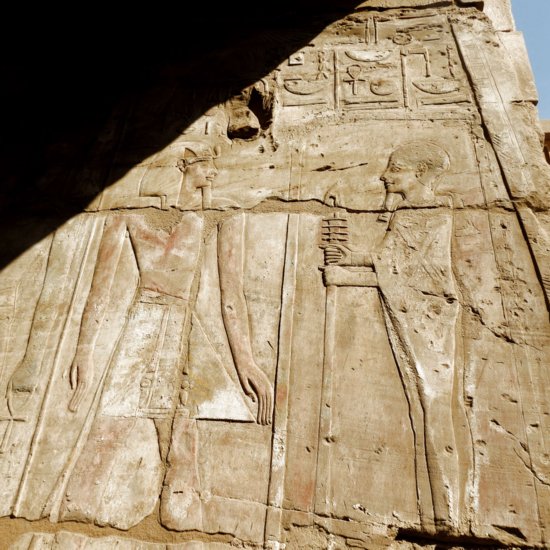
|
Blick durch den Toreingang von
Innen
- linke Wandseite (PM² II 199 [12e] )
Nordwestliche Seite des Durchgangs mit Darstellungen:
Der König (Thutmosis III) vor dem Gott Ptah, der in einem Kiosk
steht.
Bild: mit freundl. Dank Elvira Kronlob
- alle Rechte vorbehalten - |
Die Dekoration im Inneren des
Heiligtums wurde von Thutmosis III. fertiggestellt. Die Wände des Portikos
(Vorzimmer) wurden von den letzten Königen der 18. Dynastie dekoriert (Eje
und Haremhab) sowie die nördliche Wand von Ptolemaios IV. An der nördlichen
Wand des Portikus übergibt Ptolemaios IV die Statuette einer Sphinx mit
Kosmetika an den Gott Ptah, der in einem Naos steht und das "was",
ein "anch" und ein "djet"-Symbol in seinen Händen hält.
Hinter ihm steht die Göttin Hathor, gefolgt von Imhotep, dem Sohn des Ptah
(dieser wurde in der ptolemaischen Zeit vergöttlicht und verschmolz mit dem
griechischen Heilgott Asklepios. Hinter der Figur des Imhotep befindet sich
unter dem Architrav des Portikus eine Inschrift mit einem Text aus drei
vertikalen Linien, die eine Rede im Namen von Thutmosis III. wiedergibt:
".....an seinen Vater Ptah, der mit der
schönen Erscheinung, Herr der beiden Länder.....Er baute das Haus von Ptah
neu aus feinem weißen Sandstein, die Türverkleidungen aus Zedernholz von den
besten Terrassen [des Libanons].....Als Meine Majestät dieses aus Ziegeln
erbaute Haus fand."
Dieser Text entspricht fast
genau dem auf der Granitstele, die zwischen dem 4. und 5. Tor des Ptah-Tempels
gefunden wurde. Unter dem Portiko - über einer schmalen Nische, befindet sich
ein Flachrelief, ähnlich dem an der gegenüberliegenden Südfassade, welches
Thutmosis III., gefolgt von seinem Ka, zeigt.
Am östlichen Teil Teil der
inneren, südlichen Seitenmauer des Portikos - zwischen zwei Nischen mit den
königlichen Titeln auf dem Türsturz und den Türpfosten befinden sich
Darstellungen des Königs (Thutmosis III), der den blauen Helm trügt und zwei
Gefäße mit Wein opfert (PM² II 200 [19] ). Hinter ihm folgt sein ka, der
den Horusnamen des Königs ("Mächtiger Stier, der in Theben
erscheint") auf seinem Kopf trägt. In seiner linken Hand hält der ka
einen langen Stab, an dessen oberen Ende sich ein Königskopf befindet,
während sich in seiner rechten Hand hält er das "anch"-Zeichen
(Symbol für Leben) und die Feder der Göttin Mut.
Tempel des Ptah in Karnak -
Portico
Südliche Wand PM² II 200 [19] |
| Der König steht - zusammen mit seinem Ka - vor dem
Gott Ptah, der in einem Schrein steht - und opfert Wein in kugeligen
Gefäßen. |
|
Bild: Courtesy to Wilfried Ullrich 2007 |
Ebenfalls auf der südlichen
Innenwand des Portiko - (westlicher Teil der Wand) - Richtung Ausgang -
befindet sich eine weitere Darstellung (PM² II 200 [18] ), welche die Götter
Amun-Re, Ptah, Chons, Mut und Hathor zeigen, die vor einer Liste mit
Priesternamen stehen. Rechts über dem Szepter des Amun-Re befinden sich vier
vertikale Linien einer Inschrift. Haremhab ließ Inschriften und Darstellungen
restaurieren, die während der Amarna-Zeit getilgt oder beschädigt
wurden.
Als Mariette damals den Tempel
betrat, sah er diese Inschrift und Darstellung noch in ihrem kompletten
Zustand, während Legrain bei seinen Arbeiten um 1900 nur noch die untere
Hälfte vorfand. Der verlorene Teil ermöglichte es aberden Historikern, das
hier erwähnte "Fest des Ptah" auf zwei Monate nach der Krönung von
König Haremhab zu datieren, das mit dem Fest "des schönen
Talfestes" zusammenfiel. Merkwürdigerweise scheint aber die Kartusche in
der Restaurationsinschrift von Haremhab usurpiert zu sein (siehe dazu:
Erika Schott, AAWL N.N. 10, 1950, 970 (90), Nr. 65; Gabolde, in BSEG 11, 1987,
39 m. Anm. 1 (i)). und die Flachreliefs ähneln in keiner Weise denen, die
wir aus seiner Herrschaft kennen, deshalb gehen wir davon aus, dass die
Darstellungen schon von Thutmosis III. gestaltet wurden, ebenso die
Inschriften dazu. Evtl. stammt auch die Restaurationsinschrift schon von einem
seiner Vorgänger (Tutanchamun - oder wie Schott und Gabolde rein
hypothetisch vermuten, König Eje, siehe Grallert, Bauen, Stiften, Weihen,
Achet-Verlag 2001).
Der rechte Teil der Inschrift wurde durch das später eingefügte Bauteil
aus der Ptolemäerzeit überdeckt.
Tempel des Ptah in Karnak -
Portico
Südliche Wand PM² II 200 [18] |
| Von links: Amun-Re, Ptah
("Herr der Maat, König der beiden Länder, mit dem schönen
Gesicht in Theben"), der auf einem Sockel der "Maat"
steht, Chons-in-Theben-Neferhotep (der hier den Zopf des Kronprinzen
trägt und ein Diadem) und in seinen Händen verschiedene Szepter
hält (darunter die Djet-Säule, das Was-Szepter, das Anch-Zeichen,
den Heka-Stab und das Nechacha-Szepter (?). Dazu trägt er die
Menat-Kette mit einem Gegengewicht um seinen Hals. Hinter ihm folgen
die Göttinnen Mut und Hathor. |
|
Bild: mit freundl. Dank Saamunra
- alle Rechte vorbehalten - |
|
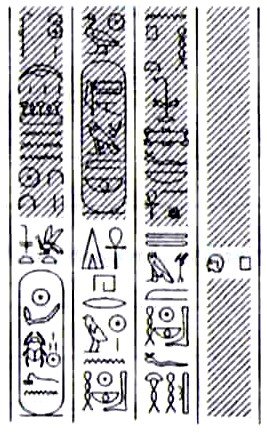
|
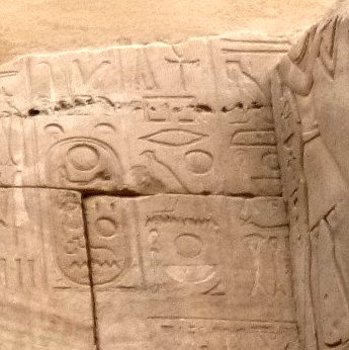
|
|
Umzeichnung Mariette
- Inschrift Haremhab |
Bild: Saamunra
Restaurationsinschrift mit Kartusche
- Bildausschnitt von Bild oben -
- alle Rechte vorbehalten - |
Links im Vordergrund
befindet sich der innere Türpfosten, auf dem eine Darstellung des Gottes Ptah
zu sehen ist, die mehrmals "herausgemeißelt" und erneuert wurde.
Darunter ist eine Widmungsinschrift von Ptolemaios III., die besagt, dass er
dieses Monument restauriert hat. Auf der nördlichen der beiden Säulen des
Portikos befinden sich die Kartuschen von Thutmosis III.
Auf den beiden Rückwänden des
Portiko befinden sich an jeder Seite des Türdurchgangs Opferszenen Thutmosis
III. vor Amun-Re und Ptah (PM² II 200 [20-21] ). Im 2. Register sind drei
Nilgötter zu sehen und in den Nischen die Titeln von Thutmosis III. Im
Portiko wurde auch ein Ständer mit den Kartuschen von Thutmosis III (PM 22)
aus Granit und ein Opfertisch mit den Namen von Amenemheit I. aus Granit /PM
23) gefunden
Sanktuare
Im hinteren Bereich des
Heiligtums befinden sich drei Kammern. Die
zentrale Kammer ist dem Hauptgott Amun-Re gewidmet. Ursprünglich war der
Tempel einst als Zwischenstation für die heilige Barke des Gottes während
der Prozession für sein Jahresfest errichtet worden. In dieser Kammer
befindet sich eine kopflose Statue des Ptah aus schwarzem Granit (PM² II 201
[26] ), der in seinen Händen die gleichen Szepter hält, wie auf dem Bas-Relief an der nördlichen Wand des Portikos. Vor dem Gott, auf demselben
Sockel, befindet sich das Fragment (unbeschriftet) des unteren Teils einer
Kniefigur (wohl der König selber). In der rechten (südlichen) Kammer wurde
eine Statue einer Hathorfigur aus Granit gefunden, die sich lt. PM in Kairo
(CG 38888) befindet (PM² II 201 [31] ). Später wurde diese Statue wieder an
ihren ursprünglichen Standort zurückgebracht. Die Statue aus schwarzem
Granit wurde von Legrain in vielen Teilen zersprungen gefunden und wieder
zusammengesetzt. Die Göttin trägt den Uräus mit einer abgeflachten Scheibe.
Sie hält das Wadjet-Zeichen mit einer Lotosblume und dem Anchzeichen in ihren
Händen.
|
Kopflose Statue des Gottes
Ptah
- gefunden in der mittleren Kammer - |
State der Göttin Sachmet/Hathor
- gefunden in der Südkapelle (rechte Kapelle) - |
|
Bild: Courtesy to www.meretsegerbooks.com
- Fotograf: Francois Olivier - |
Bild: Courtesy to www.meretsegerbooks.com
- Fotograf: Francois Olivier - |
Auf dem äußeren Türsturz
über der zentralen (mittleren) Kapelle befindet sich eine Doppelszene: der
König (Thutmosis III.) opfert Wein an Amun, Ptah und Hathor auf der linken
Seite und an Mut auf der rechten Hälfte des Türsturzes. Auf den Türpfosten
wird der König von Amun-Re umarmt und steht vor Ptah. In der 2. Szene wird
der König beim Eintreten in die Kapelle (Ptolemäische Imitation) gezeigt
(PM² II 200 [24] ).
Untere Szene des Türpfostens links
PM² II 200 [24] )
(Eingang zur mittleren Kapelle des Amun-Re)
der König beim Eintreten (Darstellung ersetzt von den Ptolemäern) |
Barkenuntersatz (Ständer) für die
Barke des Amun-Re
(PM² II 200 [22] ) aus Granit mit Kartuschen Thutmosis III vorne
|
beide Bilder: Courtesy to
Elvira Kronlob
- alle Rechte vorbehalten - |
An den Wänden des mittleren Sanktuars (PM² II 201
[25a-c) ist Thutmosis III. bei Opferhandlungen vor den Göttern zu sehen: an
der linken Wandseite opfert er Weihrauch und Opfergaben vor Ptah; an der
rechten Wandseite: Wein und Opfergaben vor Hathor und an der Sanktuarrückwand
übergibt er Opfergaben an Amun-Re. Im hinteren Teil der Kammer befindet sich
eine kopflose, unbeschriftete Statue aus Granit des Gottes Ptah (PM 26).
Die Nordkapelle (linke Kapelle)
war für den Namensgeber des Tempels, dem Gott Ptah, geweiht. Der Zugang
erfolgte von der mittleren Kapelle aus. Am äußeren und inneren Durchgang
befinden sich Darstellungen des Königs (Thutmosis III.) mit Opfergaben auf
dem Türsturz (PM² II 201 [27] ). In der Nordkapelle erscheint nochmals der
König an allen vier Wänden (PM ² II 201 [28a-d] ) (siehe Plan weiter oben)
a) er streut Sand vor Ptah; an der nördlichen Wand b) opfert er Natrum,
reinigt er Ptah und wird im Anbetungsgestus vor Ptah dargestellt. An der
südlichen Eingangswand c) befinden sich zwei Opferszenen des Königs vor
Ptah: 1) Thutmosis III. opfert zwei Vasen vor Ptah 2) Thutmosis III wird von
Ptah umarmt. An der westlichen Wand d) salbt der König Ptah.
Die Südkapelle (rechte Kapelle)
(PM² II 201 [29] und (PM² II 201 [30-31] ) zeigt auf dem inneren Türsturz
die gleichen Szenen wie bei dem Durchgang in der Nordkapelle: Der König mit
Opfergaben. Die Szenen an den Innenwänden der Südkapelle sind mit denen von
der Nordkapelle gleich - nur mit der Göttin Hathor anstelle von Ptah. Im
hinteren Teil der Kapelle befindet sich die weiter oben gezeigte Statue der
Sachmet.
| weitere Obelisken von Thutmosis III.
aus Karnak |
Thutmosis III. ließ
in Karnak 7 Obelisken aufstellen - einschließlich einen, den er selbst nicht
mehr vollenden konnte und der heute in Rom steht - von denen heute jedoch
keiner mehr an seinem ursprünglichen Aufstellungsort steht (und zwei weitere
in Heliopolis). In Rom, auf der
Piazza San Giovanni in Laterano befindet sich der größte Obelisk, ein
Einzelstück, der im sog. Sonnenheiligtum von Thutmosis III. (östlich des
Amun-Tempels - ein kleines Heiligtum, das Thutmosis III. begonnen und Ramses
II. erweitert, sowie Taharqa vollendet hatte) aufgestellt war und von
Thutmosis III. in Auftrag gegeben,
aber erst unter Thutmosis IV. fertiggestellt wurde. Seine frühere Basis
wurde von den Archäologen identifiziert.
Es ist aber unter den
Wissenschaftlern strittig, ob es sich bei diesem Bauwerk um einen Obelisken
handelte, dessen Gegenstück nicht fertig wurde oder zerbrach, oder ob dass
Thutmosis III. gar nicht die Absicht hatte, einen Einzelobelisken aufzustellen
und ihm eine solche Absicht erst von seinem Enkel Thutmosis IV.
"unterschoben" wurde (lt. Inschrift). Tatsache ist aber, dass
Thutmosis IV. im Heiligtum seines Großvaters einen Einzelobelisken aufstellen
ließ und dass dieses ein höchst ungewöhnlicher Vorgang in Karnak war. Das
ergibt sich aus der von ihm an der Vorderseite des Obelisken angebrachten
Inschrift, die zunächst seine aus den üblichen 5 Namen bestehende Titulatur
wiedergibt und dann lautet: ......"Zum ersten Mal wurde errichtet ein
einzelner Obelisk in Theben. Er tat (es), damit (ihm) Leben gegeben
werde" (Quelle des Zitats: Dondelinger, dere Obelisk, Adeva-Verlag, Graz
/ Austria 1977, S. 86).
|
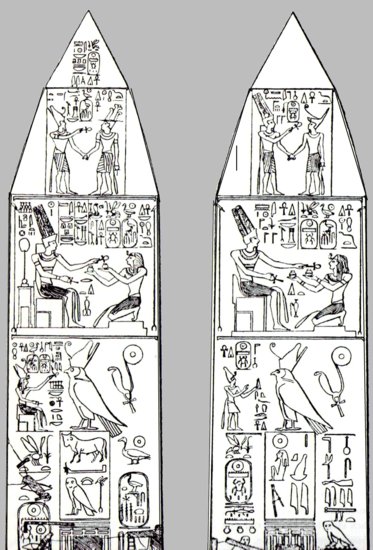
|
Das Oberteil des
Lateran-Obelisken
Auf der jeweils mittleren nach
unten führenden Inschriftenreihe des sog. Lateran-Obelisken wird der Name von Thutmosis III. genannt,
gefolgt von den auf die Errichtung des Obelisken Bezug nehmenden Formel:
" Er (Thutmosis III.) machte es als sein Denkmal für seinen Vater Amun,
den Herrn der Throne der Beiden Länder, dass er ihm einen einzelnen Obelisken
im oberen Hof des Tempels im Bezirk von Karnak errichtete, als erste
Aufstellung eines Einzelobelisken in Theben".
Thutmosis IV., der Enkel
des Stifters des Obelisken fügte dann diesen Inschriftenreihen seines
Großvaters auf allen vier Seiten des Schaftes noch jeweils die beiden
äußeren Textreihen hinzu.
Das Pyramidion zeigt den Gott Amun-Re und den König
Thutmosis III. "sich gegenüberstehend" bei der Handlung der
"Anchübergabe". Der Gott reicht dem König das Lebenszeichen
und hält es vor dessen Nase; der König hält in seiner herabhängenden
Hand ebenfalls ein Anchzeichen.
Die Darstellung darunter - auf dem Schaft des
Obelisken - zeigt die Titulatur von Thutmosis III.. Der König kniet vor
dem thronenden Gott Amun und bringt ein Trankopfer dar. |
Zeichnung:
nach Budge, Needles S. 145
- bearbeitet von Nefershapiland - |
Aus einer dieser Kolumnen erfahren wir, dass der
Obelisk 35 Jahre lang von den Handwerkern der zum Tempel gehörenden
Werkstätten auf der Seite liegengelassen worden war. Weiter wird berichtet,
dass Thutmosis IV. den Obelisken am Oberen Tor, auf der östlichen Seite des
Tempelbezirks von Karnak, habe aufrichten lassen (Quelle und Zitat: Labib
Habachi / die unsterblichen Obelisken Ägyptens / Phillip v. Zabern-Verlag
Mainz, 1982, S. 149 ff.)
Der römische Kaiser Constantin
(306–337 n. Chr.) beschloss den Obelisken abzubrechen und nach
Konstantinopel zu bringen. Beim Abbruch des Obelisken wurde der Sockel und ein
Großteil des Fundaments zerstört, außerdem wurde ohne Rücksicht auf
Verluste ein Transportweg errichtet, der über den sog. "Seetempel"
(der dabei erheblichen Schaden nahm) und weiter durch den Cachettehof (wobei
große Lücken in die östliche und westliche Mauer gebrochen wurden) und dann
in Richtung Nil führte. Der Obelisk blieb dann wegen des Todes des Kaisers im
Hafen von Alexandria liegen bis der Sohn und Nachfolger des Kaisers, der
Constantin II. (337-361 n. Chr.) hieß, den Obelisken dann
weitertransportieren ließ. Aber nicht wie es sein Vater vorgesehen hatte,
nach Konstantinopel, sondern er wurde nach Rom gebracht und im Jahre 357 n.
Chr. im Zirkus Maximus aufgestellt. Zu einem unbekannten Zeitpunkt stürzte
der Obelisk um. Im 16. Jahrh. ließ Pabst Sixtus V. nach dem Obelisken suchen
bis er schließlich in drei Stücke zerbrochen aufgefunden wurde. Erst 1588
wurde der nun restaurierte Obelisk auf der Piazza San Giovanni in Laterano
wieder aufgestellt.
|

|
Obelisk Thutmosis III.- aus dem Osttempel in
Karnak
- heute in Rom auf der Piazza San Giovanni in Laterano -
Ein Einzelstück, das ursprünglich im
Sonnenheiligtum im Osttempel Thutmosis III. stand - aber von ihm nicht
mehr fertiggestellt werden konnte - sondern erst von Thutmosis IV.
Dieses geht aus einer Inschrift von Thutmosis IV. hervor, die dieser am
Obelisken anbringen ließ.
Mit großer Wahrscheinlichkeit hat ein gewisser Min
(Ortsvorsteher von Thinis und Oberster der Onurispriesterschaft) als
Beauftragter von Thutmosis III. die Arbeiten für den Obelisken
überwacht. Bei einem Gewicht von 45,5 Tonnen beträgt seine heutige
Höhe noch immer 32,18 m, obwohl im 16. Jh. bei seiner
Wiederaufstellung, ein Stück abgeschlagen wurde. Das Pyramidion des
Obelisken, das einst ebenso wie der obere Teil des Schaftes mit Gold
überzogen war, ist beschädigt.
Es zeigt auf seinen 4 Seiten (ganz oben) den König,
der von Amun-Re bzw. Amun-Atum gesegnet wird. Darunter - am oberen Ende
des Schaftes) befindet sich der König in Opferhaltung vor den Göttern. |
Bild:
Obeliscolateranense
Autor: AndrewRM, Wikipedia 2009
Lizenz: CC
BY-SA 3.0 |
Obelisken-Paar von
Thutmosis III. in Karnak-Süd
Ein Obeliskenpaar ließ Thutmosis
III. in Karnak-Süd vor dem VII. Pylon aufstellen. Von diesem Obeliskenpaar
ist nur noch westlich vom Durchgang das Fundament und östlich vom Durchgang
das Fundament mit Obeliskenbasis und darauf einige Fragmente des Obelisken zu
erkennen.
Fragmente des westlichen Obelisken vor dem
7. Pylon (PM² II 171 [K] ) |
| Das zurückgebliebene, zusammengesetzte Fundament
des nach Konstantinopel gebrachten westlichen Obelisken. Erhalten
hat sich vor Ort von diesem westlichen Obelisken nur das aus großen
Steinblöcken mit Hilfe von Schwalbenschwanzdübeln zusammengesetzte zurückgelassene
Fundament. |
|
Bild: mit frdl. Dank Saamunra
- alle Rechte vorbehalten - |
Basis
und Rest des Obelisken vom 7. Pylon ausgesehen
(PM² II 171 [L] )
|
|
Bild: mit frdl. Dank Saamunra
- alle Rechte vorbehalten - |
|
Fragmente des östlichen Obelisken vor dem 7.
Pylon mit Basis |
| Lt. dem engl. Ägyptologen Dr. Aidan M. Dodson sehen
die Kartuschen auf der Basis nach Ramses II aus. In der Kartusche (auf
der seitlichen rechten Seite der Obeliskenbasis) ist die Hieroglyphe
(sitzende Figur) von Ra zu sehen - gefolgt on den Zeichen für
"ms-s". Aber wie man deutlich sieht, ist die Figur des Re
tiefer eingeschlagen wie die nachfolgenden Zeichen, was bedeutet, dass
die Kartusche von Ramses II. usurpiert wurde und lt. Dr. Dodson
"definitiv original für Thutmosis III. gemacht wurde"
(original lautete die Kartusche: Djhwty-ms
= Djehuti-ms) |
|
Bild: mit frdl. Dank Saamunra
- alle Rechte vorbehalten - |
Von dem östlichen Obelisken
liegen noch heute einzelne Fragmente in der Nähe seines einstigen Standortes
vor dem Pylonturm. Eines zeigt den Rest einer Weiheformel, an deren Schluss
sich noch der Reste der Hieroglyphe "Sohn" befindet. Dahinter
befindet sich der linke Teil einer Kartusche, auf der wir nur noch die
Hieroglyphe einer "sitzenden Figur der Maat" erkennen. Allerdings
führt Jürgen von Beckerath ("Handbuch der Pharaonen" diesen
Geburtsnamen des Königs nicht auf (aber bei von Beckerath sind nicht alle
Schreibweisen aufgeführt.
|
Fragment eines der beiden Obelisken
vor dem 7. Pylon |
Fragment eines der beiden Obelisken vor dem 7.
Pylon
- mit "merkwürdiger" Kartusche - |
| Beide Bruchstücke des Obelisken
gehörten lt. den Kartuschen (in einer ungewöhnlichen Version) zu
Thutmosis III. Wir danken Dr. Aidan Dodson für die Identifizierung. |
|
Bild: mit frdl. Dank Saamunra
- alle Rechte vorbehalten - |
Bild: mit frdl. Dank Saamunra
- alle Rechte vorbehalten - |
Ein weiteres Fragment des
gleichen Obelisken zeigt wiederum den Geburtsnamen des Königs, auch hier in
einer etwas merkwürdigen Schreibweise - am ehesten könnte evtl. Beckeraths
"Handbuch der Ägyptischen Königsnamen" E 8 in Frage kommen. Wegen
des abermaligen Vorkommens des Geburtsnamens kann das Fragment nicht von der
gleichen Seite des Obelisken wie das oben beschriebene stammen
Noch ein weiteres schmales
Fragment befindet sich noch in der Nähe, es zeigt die Reste eine Inschrift,
jedoch keinen Königsnamen.
|

|
Inschriftliche Erwähnung eines
Obeliskenpaares
auf der Südseite des VII. Pylons
Inschrift und Darstellung im Annalensaal von Thutmosis III.
Auch von einem
inschriftlich erwähnten Obeliskenpaar (nach L. Habachi, die
unsterblichen Obelisken, S. 102 sind damit jedoch nach der darunter
stehenden Zahl, zwei Obeliskenpaare gemeint), das
im Karnaktempel an der inneren Nordwand des Raumes VIII. (PM 282 -
Annalensaal) zusammen mit dem König dargestellt ist. Die Darstellung
zeigt den König bei der Weihung der Obelisken und wie er Amun-Re
Schätze als Gaben darbringt zur Verherrlichung der Feldzüge, in denen
ihm der Gott Erfolg beschieden hatte (3).
Wahrscheinlich waren diese
Obelisken für das erste Regierungsjubiläum von Thutmosis III. bestimmt
und scheinen unter der Oberaufsicht des Beamten "Puim-re"
angefertigt worden zu sein - eines hohen Beamten, der nacheinander in
den Diensten von Hatschepsut und Thutmosis III. gestanden hatte. In
seiner großen Grabanlage (Nr. 39) befindet sich eine Szene, welche den
sitzenden Grabinhaber und ihm gegenüber zwei Reihen Untergebener, sowie
ein Obeliskenpaar zeigt (siehe Norman de Garis Davies, The tomb of
Puyem-re at Theben, Bd. 1, 1922).
Bild: Jon Bodsworth,
Wikipedia 2006
- Copyright free - public domain -
|
Einer der beiden Obelisken (nur
das obere Teil des westlichen) wurde in römischer Zeit in die Hauptstadt des
Oströmischen Reiches (Konstantinopel) gebracht und dort auf dem Hypodromplatz
(heute auf dem Atmeidan) aufgestellt. Die Inschrift nennt den
König "Herr des Sieges, der alle Länder unterwirft" und berichtet
uns, dass der König zu diesem Zweck sogar den Euphrat überschritten hätte. Vom zweiten (östlichen) Obelisken ist heute nur noch
der Sockel vorhanden und vor Ort einige einzelne Fragmente des Obelisken.
|

|
Einer der beiden Obelisken
Thutmosis III.
- ursprünglich auf der Südseite des VII. Pylons
aufgestellt -
Heute befindet sich das obere Teil des Obelisken von
Thutmosis III. in Istanbul/ehem. Konstantinopel (Sultan-Ahmed-Platz)
Die Höhe des Obelisken in Istanbul beträgt
heute nur noch 19,6m, ein gutes Drittel fehlt. Jedoch wird geschätzt,
dass er original ca. 30m in der Höhe gemessen hat als er im Karnak-Tempel
stand. |
Bild:
Obelisk
of Thutmosis III. of Hippodrom
Autor: Winstonza 2012, Wikipedia
Lizenz: CC
BY-SA 3.0 |
Der Sockel eines weiteren
Obeliskenpaares wurde bei den Ausgrabungen unter dem 3. Pylon gefunden (siehe
weiter oben) - westlich des Paares von seinem Großvater Thutmosis I. - am
Eingang des Zentralheiligtums. Von den beiden Obelisken ist heute nur noch in situ
die Basis des rechten erhalten - sowie ihre
beiden Pyramidion und Bruchstücke eines Schaftes (siehe weiter oben).
Amenophis III. ließ beide Obelisken für den Bau seines III. Pylons
entfernen.
Von dem dritten Obeliskenpaar
aus der Zeit von Thutmosis III. kennen wir lt. Habachi (S. 106 - die
unsterblichen Obelisken) nicht einmal den ursprünglichen Standplatz und es
wurde auch nie eine Spur von ihnen gefunden
Der 7. Pylon galt zur Zeit des Thutmosis III
wohl als eigentlicher Haupteingang des Karnak-Tempels in der Süd-Nord-Achse.
Der 8. Pylon von Hatschepsut wurde dadurch dann zu einer Art
"Hoftor" degradiert. Vor der Nord- und Südseite des 7. Pylons
standen kolossale Standbilder.
Thutmosis III. errichtete seinen
Pylon zwischen dem bestehenden Pylon der Königin Hatschepsut (dem 8.) und dem
südlichen Eingang zum "Festhof" von Thutmosis III. Lt. Inschriften
in einer der Königskapellen ersetzte er einen vorhandenen Lehmziegelmast, der
ursprünglich an dieser Stelle stand. An den Türmen des Pylons wurden große
Fahnenmasten aus Holz angebracht, an deren Spitze sich bunte Stoffbanner
befanden. Die Masten standen auf Steinsockeln und waren an Aussparungen im
Mauerwerk des Pylons angebracht.
Beachtung verdient die Tatsache,
dass der 7. Pylon in seinen Abmessungen und in seiner Architektur fast ein
genaues Abbild des 4. Pylons darstellt (Gabolde 1993, S. 115). Die Themen der
Reliefs in den Tordurchgängen - die sich auf das Regierungsjubiläum von
Thutmosis III. beziehen - wiederholen sich hier, wobei die am 4. Pylon
allerdings weniger gut erhalten sind wie die am 7. Pylon.
Vor der Südseite des 7. Pylons
erhoben sich einst zwei Obelisken auf mächtigen Fundamenten. Wahrscheinlich
ist dies das Obeliskenpaar, dass in dem Tempelrelief dargestellt ist, das sich
an der Nordwand des Umgangs der Barkenkapelle Thutmosis
III. befindet. Hier ist der König
gezeigt, wie er eine große Menge von kostbaren Opfergaben an Amun–Re übergibt.
Auf den Schäften dieser
Obeliskendarstellungen sind Weiheformeln wiedergegeben (siehe "weitere
Obelisken" Artikel oben).
Vor dem östlichen Flügel des
7. Pylons (Südseite) und vor dem westlichen Pylonflügel stehen zwei
kolossale Statuen von Thutmosis III. - aus rotem Assuan-Granit gearbeitet.
Unterhalb des linken Beines der kolossalen Figur I ließ Ramses III. (PM² II
171) eine Abbildung von sich mit dem Nemes-Kopftuch und mit Heka-Szepter und Flagelum
und an der Basis Gefangenendarstellungen im versunkenen Relief hinzufügen.
Auch vor dem westlichen
Pylon-Flügel ließ Thutmosis III. eine kolossale Standstatue (J) von sich
aufstellen - an der Basis befinden sich die Reste von Gefangenendarstellungen.
Diese Standstatue ist nur noch bis in Höhe der Knie erhalten.
An der Südseite des 7. Pylons befinden sich an beiden
inneren Fahnennischen Weiheformeln:
1. Fahnennische am östlichen Turm: "(Bauwerk)
des Men-cheper-Re, das er gemacht hat als sein Denkmal für seinen Vater
[......] (nämlich)
[das Errichten für ihn herrliche Fahnenmaste, dessen
Höhe] die Leiber der Sterne [erreichen], deren Spitzen aus Elektron [vom
Besten der
Fremdländer] sind [...]".
2. Fahnennische am östlichen Turm: "[Bauwerk
des] Men-cheper-Re, das er gemacht hat als sein Denkmal für seinen Vater [Amun]-Re,
Herrn des
Himmels, (nämlich] das [Er]richten für ihn herrliche
Fahnenmaste, die er ausgewählt hatte im Libanon, heruntergebracht von den
Bergen [des
Gottes]landes durch die Asiaten von Retjenu [..ö..] Holz
der Fremdländer.....". (Quelle für die
Übersetzungen: Silke Grallert, Bauen-Stiften-Weihen,
Achet-Verlag Berlin, 2001)
|
Planzeichnung des 7. Pylons mit Seegebäude
Thutmosis III.
PM A+B = Kolossale Statuen Thutmosis III. vor dem 7.
Pylon
PM C+D = Kolossale Statuen Thutmosis III. vor dem 7. Pylon
PM E+F+G = 3 königl. Statuen (2 Sitzstatuen), Dynastie XIII (eine
Sebekhotep), 1 Amenophis II,
und 1 Standstatue Amenophis II.
PM H: Stele Haremhab vor Amun und Mut, usurpiert von Tutanchamun
PM I: Kolossal Statue Thutmosis III (usurpiert von Ramses
II)
PM J: Kolossal Statue Thutmosis III (Fragment unterer Teil)
PM K+L = ehemals 2 Obelisken Thutmosis III - einer heute in Istanbul
(Basis von L, usurpiert von
Ramses III./Ramses II (?) in situ) und K nur noch das Fundament
vorhanden.
PM 496: Restszenen: Thutmosis III. erschlägt asiatische Feinde vor
Amun-Re mit kleiner Figur
eines Gottes darunter und 359 Namens-Ringen
PM 497: wie bei 496, aber mit nubischen Feinden und 269 Namensringen
PM 498a+b: Thutmosis III, restauriert von Sethos I. Torpfosten mit Text
und Szene darunter an
der Basis, Merenptah sitzend vor
einem Naos mit Thot - gefolgt von Opferbringern an Basis.
PM 498 c: Text von Thutmosis III
PM 498 d: 2 Register - zwei Szenen: 1) Thutmosis III wird von dem
sitzenden Amun umarmt
2) wird von Horus und Thot geführt, Sethos II. kniend mit Mut und
erhält heb-seds von
Amun-Re und Chons und zwei Statuennischen mit Titeln von Merenptah
zwischen
beiden.
Türpfosten: Thutmosis III vor einem Gott mit Erneuerungstext
Sethos I. und
Name des Tores von Thutmosis III darunter, sowie Kartuschen von Ramses
IV (Basis)
PM 499: Thutmosis III mit seinem Ka, erschlägt asiatische Feinde vor
Amun und der Göttin Waset
darunter und 119 Namens-Ringen
PM 500: König mit seinem Ka, erschlägt Nubische Feinde vor Amun mit
verkleinerter Darstellung
des Gottes Dedwen unten und Namens-Ringen
PM 501+502: Fahnenmast-Nischen
- in situ vor dem südlichen Turm des 7. Pylons:
Fragmente der beiden Obelisken Thutmosis III -
PM 503: Über dem Treppenzugang: Graffito -
kein Name - Dyn. XX.
Barkenstation Thutmosis III (Seekapelle)
PM 507+508: 2 kolossale Sitzstatuen Sesostris I. (Granit) heute im
Museum Kairo Nr. 38286-7
PM 509+510: Kartuschen von Ramses III. und IV.
PM 511: Türsturz Doppelszene: König mit Horusname, Türpfosten, der
König im Weihegestus -
mit Torname von Thutmosis III darunter. Texte mit Namen der Tür auf
Türpfosten.
PM 512: Torpfosten, Reste eines Weihetextes mit heb-sed Text an der
Basis.
PM 513: Unteres Register, König opfert Weihrauch an einen Gott und
König in "Barkenszene".
PM 514: 5 Szenen - von rechts nach links: 1) König weiht Opfergaben an
Min 2) Kultlauf mit Hap
und Ruder 3) übergibt Opfergaben an einen Gott 4) Weihrauch an
einen Gott 5) zerstört
|
|
Plan PM² II XIV - modifiziert von Nefershapiland |
|
Südliche Seite des 7. Pylons (rechter) Turm des 7. Pylons
Östlicher Pylonturm - der König beim Erschlagen der Feinde
- darunter die Namensringe der besiegten Fremdvölker -
am linken Rand ist die Nische für die Fahnenmasten zu sehen.
|
|
Bild: Courtesy to Jon
Bodsworth
- gemeinfrei - |
|
Östlicher Turm des 7.
Pylons
- Namensringe mit den Namen der besiegten Feinde - |
|
Bild: Courtesy to Elvira
Kronlob
- alle Rechte vorbehalten - |
Südöstlicher
Torpfosten des 7. Pylons (PM² II 169-170 [498e] )
- mit Fragment (unterer Teil) der Standstatue Thutmosis III (PM
J)
- rechts an der Wand des östlichen Pylonturmes: der König beim
Erschlagen der Feinde
und darunter Namensringe. |
| Links an der Pylonwand (PM²
II 169 [498e] )- hinter der kolossalen Statue Thutmosis III. befindet
sich auf den Türpfosten des Durchgangs eine restaurierte Szene
Thutmosis III. vor einem Gott (wahrscheinlich Amun-Re) (mit einem
Wiederherstellungstext von Sethos I.) und der Name des Tores darunter
sowie die Kartusche von Ramses IV an der Basis. |
Bild:
Courtesy to Peter Alscher
- alle Rechte vorbehalten - |
Torpfosten
des westlichen (linken)Turmes des 7. Pylons (PM² II 169-170 [498e] ) |
| Gegengleiche Darstellung der
Szene des "Erschlagen der Feinde" durch den König
(Thutmosis III.). Darunter - ebenso wie auf dem gegenüber liegenden
Pylonturm: die Namensringe der besiegten Städte und Völker. |
Bild:
Courtesy to Peter Alscher
- alle Rechte vorbehalten - |
Durchgang im 7.
Pylon zur Nordseite:
Beidseitig im Inneren des Durchgang
des 7. Pylons zur Pylon-Nordseite befinden sich Szenen und Textkolumnen:
(PM² II 169 [498c-d] ):
Türdurchgang links: Text von Thutmosis III. (PM 498c)
Türdurchgang rechts: (PM 498d): zwei Register:
Register 1 - oben:
1. Thutmosis III. wird von dem thronenden Amun-Re umarmt
2. Thutmosis III. wird von Horus und Thot geleitet
Register II. unten:
Sethos II. (Kartusche usurpiert) kniend mit Mut erhält heb-sed von
Amun-Re und Chons
Es folgen zwei Statuennischen
zwischen denen sich die Titulatur Sethos
II. (usurpiert durch Sethos II. nach
PM von Merenptah)
befindet.
Um die Statuennischen läuft ein Rahmen mit den königlichen Namen und Titel
von Thutmosis III., darüber
befindet sich die geflügelte Sonnenscheibe
Am linken Ende noch einmal eine
größere Kartusche mit dem Namen Sethos
II. (anscheinend diesmal nicht usurpiert), die Kartuschen tragen
Doppelfedern mit einer Sonnenscheibe dazwischen und stehen auf dem Zeichen
für nub (Gold)
Rechte
Seite des inneren Tordurchganges und Torpfosten (PM² II 169 [498c] )
- gesehen von der Südseite des Pylons - |
| Auf der rechten Seite des Bildes befindet sich -
hinter der kolossalen Standstatue J in der bildlichen Darstellung der
König (Thutmosis III. vor einem Gott) mit einem Erneuerungstext von
Sethos II. und der Name des Tores darunter. Im Tordurchgang selber
befinden sich Texte von Thutmosis III. |
Bild:
Courtesy to Saamunra 2022
- alle Rechte vorbehalten - |
Linke
Seite des inneren Tordurchganges und Torpfosten (PM² II 169 [498d)
- gesehen von der Nordseite des Pylons - |
| Darstellungen an der linken Wand des Durchgangs auf
die Nordseite des 7. Pylons. Die Szenen im II. Register (rechts)
zeigen den knienden König Thutmosis II (usurpiert von Sethos II.) vor
dem thronenden Gott Amun-Re. Der König empfängt heb-sed Feste.
Hinter ihm steht die Göttin Mut und hinter dem thronenden Gott
Amun-Re der Gott Chons.
Um die Statuennischen läuft ein Rahmen mit den königlichen
Titeln und den Namen von Thutmosis III - darüber befindet sich die
geflügelte Sonnenscheibe. Zwischen den Nischen befindet sich die
Titulatur von Sethos II.
Die Darstellungen im oberen Register des Tordurchgangs zeigen
zwei Szenen:
1. Register oben: (nur noch im unteren Teil der Darstellungen - ohne
Köpfe - erhalten) Thutmosis III. wird von dem thronenden Gott Amun-Re
umarmt
2. Register: Thutmosis III. wird von Horus und Thot geleitet. |
Bild:
Courtesy to Saamunra 2022
- alle Rechte vorbehalten - |
Vor der Nordseite des 7. Pylons
stehen mehrere Statuen. Vier von ihnen (auf der linken Seite) stellen
Thutmosis III. dar, zwei gehören den Königen aus der II. Zwischenzeit und
eine der Statuen ist mit den Kartuschen von Amenophis II. beschriftet. Diese
Statuen stehen allerdings heute nicht mehr an ihrem ursprünglichen
Aufstellungsort.
Nordseite des 7.
Pylons mit Statuen davor |
| Die beiden Statuen auf der östlichen
Seite tragen die weiße Krone Oberägyptens. Die linke Statue ist ein
osider Koloss (PM A), der zwar die Kartuschen mit dem Namen von
Usermaatre Setepenamun (Ramses IV) aus seinen Schultern und auf dem
vertikalen Band auf seinem Unterkörper trägt, aber original
Thutmosis III. zeigt - ebenso wie der rechte Koloss (Standstatue PM B)
neben ihm (auch usurpiert durch Ramses IV).
Die 5 Figuren auf der westlichen Seite (rechts) neben dem
Durchgang sind (C) eine Schreit-Statue von Thutmosis III. aus rotem
Granit und daneben ein osirischer Koloss mit weißer Krone und dem
Anch-Zeichen in seinen überkreuzten Händen, der die gleichen
Kartuschen auf seinen Schultern und den Namen Usermaatre Setepenamun
(Ramses IV) auf dem vertikalen Schriftband trägt (wahrscheinlich auch
von Thutmosis III. usurpiert - wie sein östlicher Pedant).
Die Sitzstatue E ist unbekannt (wahrscheinlich aber auch aus der
II. Zwischenzeit, während die Sitzstatue (F) einem König aus der II.
Zwischenzeit (Sebekhotep I) und die Standstatue ganz rechts (PM G)
König Amenophis II. gehört.
Rechts neben der rechten Standfigur von Amenophis II. befindet
sich eine Sandstein-Stele aus der 18. Dynasty, welche original
Tutanchamun gehörte und von Haremhab usurpiert wurde (Stele H). Die
Szene in der Lünette zeigt den König, der vor Amun-Re und Mut steht. |
|
Bild: Courtesy to Jon Bodsworth
- public domain - |
|
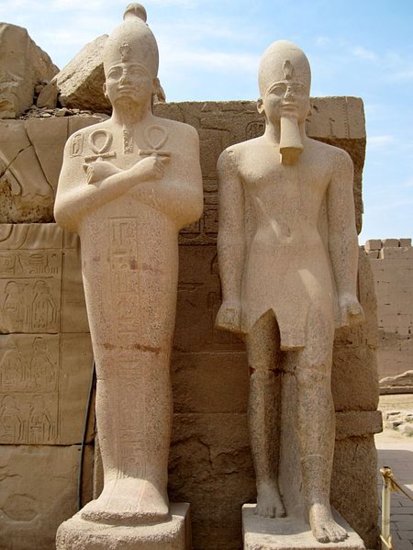
|
Standfiguren vor dem linken Torpfosten
- (Nordseite) des 7. Pylons -
Die beiden kolossalen Standfiguren auf der
östlichen Seite (A+B) - hinter dem Torpfosten des Durchgangs
des 7. Pylons tragen beide die Weiße Krone von Oberägypten - die
linke oside Standstatue ist zwar mit den Kartuschen von Ramses IV.
beschriftet, ist aber original - ebenso wie die Schreitstatue neben
ihm und wie die beiden Kolosse gegenüber vor dem rechten Torpfosten
des 7. Pylons ein Werk von Thutmosis III, das von Ramses IV usurpiert
wurde.
Bild: Karnak-Temple
14
Author: Olaf Tausch, Wikipedia 1.4.2009
Lizenz: CC
BY 3.0 |
|
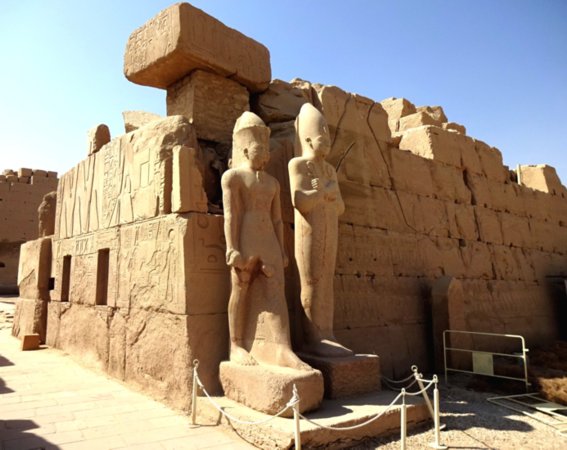
|
Standfiguren vor dem rechten Torpfosten
- (Nordseite) des 7. Pylons -
In neuerer Zeit wurden die 3 kleineren Statuen auf der rechten
Seite neben dem Torposten weggeräumt. Nur noch die beiden größeren
Standfiguren C+D blieben hier stehen.
C = Schreitfigur Thutmosis III
D = Oside Statue Thutmosis III
Bild: Mit frdl. Dank Saamunra
Nov. 2022
- alle Rechte vorbehalten. |
An den Wänden des östlichen Pylonturms befinden sich
Reste von zwei Szenen: Thutmosis III. erschlägt asiatische Feine vor Amun-Re
- dazu 359 Namensringe von den eroberten Ländern und Städten (PM² II 496).
Die Szenen auf dem westlichen Pylonturm zeigen Thutmosis III. der seine
nubischen Feinde vor [Anmun-Re] erschlägt - darunter befindet sich eine
kleine Gottheit und 269 Namensringe mit den eroberten Ländern und Städten.
Rechts oben befindet sich der untere Teil eines
Dekrets des Gottes Amun-Re betreffend dem Eigentum der Prinzessin Maatkare
(Tochter von König Psusennes II. und der späteren Gemahlin von König
Osorkon I.) (PM² II 167 [497].
Seekapelle/Alabaster-Barkenschrein
Thutmosis III.
- PM² II 173 [ab 512ff] - |
Thutmosis
III ließ in seinem 34. Regierungsjahr direkt an der Außenseite der östlichen Hofmauer angrenzend -
zwischen dem 7. und 8. Pylon - eine "Kopie der Alabaster-Kapelle
Amenophis I." erbauen. Die
Kapelle, welche auch als "Schrein des Sees / oder Seekapelle"
bekannt ist, bestand aus einer nach zwei Seiten offenen Kammer, deren Wände
und Decke von je einer monolithen Alabasterplatte gebildet wurden. Die Kapelle
öffnete sich zum Hof des 7. Pylons sowie zum Westufer - über eine Treppe,
die nur noch als älteren Zeichnungen bekannt ist - zum Westufer des Heiligen
Sees hin. Die Ägyptologen (Baguet 1965) nehmen an, dass diese Kapelle
wahrscheinlich als Stationsheiligtum für die Prozessionsbarke des Gottes
diente und man von hier aus verschiedenen Zeremonien auf dem See beiwohnte.
Der
König errichtete seine neue Kapelle auf einem
kleinen Podium, das von einem Peristyl mit 18 Säulen umgeben war. Der
thutmosidische Schrein erhielt den gleichen Namen wie der Schrein von
Amenophis I, und es besteht die Möglichkeit, dass die ursprüngliche Struktur
von Hatschepsut an einem Ort in der Nähe des Sees verlegt wurde.
|
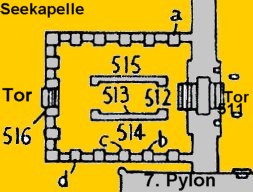
|
Seekapelle Thutmosis III
PM 511: Türsturz mit
Doppelszene, König mit Horusname, Türpfosten,
König im Weihegestus, mit Tornamen von Thutmosis III unten
PM 512: Torpfosten (Reste eines Weihetextes heb-sed-Text" an der
Basis.) PM 513: unteres Register: König opfert Weihrauch an Gott
und König in
(Barkenszene).
PM 514: 5 Szenen - rechts nach links: 1) König gibt Opergaben an Min
2) Kultlauf mit Hap und
Ruder vor Amun-Re 3) übergibt Opfer an
einen Gott 4) Weihrauch an einen Gott 5) zerstört |
PM 515: Szenen -
links nach rechts: 1) König führt 4 Kälber zu einem Gott 2)
Kultlauf mit Vasen zu einem Gott
3) Opfert 4 Kästen mit Kleidung an einen Gott 4) zerstört 5) opfert
Weihrauch.
PM 516: Außenseite der Kapelle:
[Ramses IX] und unterer Teil eines 31zeiligen autobiograph. Textes
von (evtl.) [Amunhotep], 1. Prophet
des Amun mit Erwähnung eines Totentempels von Ramses VI und Name von
Merubastet.
- Funde: Statue von Thutmosis III. - entdeckt 1907 - heute in Kairo
Mus. Fouilles No. 752 - |
|
Zeichnung: nach PM² II (Plan XIV]
modifiziert von Nefershapiland |
Die Kalzitkapelle hatte einen Durchmesser von 3,60m,
eine Tiefe von 6,75m und eine Höhe von 4,50m. Das von 18 Kalksteinsäulen
getragene Peristyl war 12,50m breit, 16,50m tief und 7,70 m hoch. Das Podium
befand sich 0,50 m über den Boden (Quelle: Digital Karnak / Carlotti,
Jean-Francois 1995 "Beitrag zur messtechnische Untersuchung einiger
Denkmäler des Amun-Re in Karnak". Karnak-Notizbücher, Bd. X, 65-127)
|
Westliche Hofmauer des 2. Hofes mit Tordurchgang
zur Seekapelle Thutmosis III. |
| In der Mitte des Bildes: Tor des kleinen Pylons, der
als Eingang zum 2. Hof zur Seekapelle diente. Links und rechts des
Durchgangs sind je eine Flaggennische zu sehen - davor befinden sich
noch die Basissockel von je einer Kolossal-Statue von Sesostris I. Auf
den Torpfosten des Durchgangs befinden sich noch die Reste eines
Weihetextes, an der Basis ein heb-sed-Text. |
|
Bild: Courtesy to Monika Jennrich
- alle Rechte vorbehalten - |
Die Kapelle wurde im 34. Regierungsjahr des Königs -
anlässlich seines 2. Sedfestes errichtet - wobei der Kernbau aber bereits in
das Jahr 30 Thutmosis III. - also zu seinem 1. Sedfest zu datieren ist. Außen
war die Kapelle an drei Seiten von Pfeilern umgeben - die Rückseite dieses
Umgangs war gleichzeitig die Mauer des Hofes zwischen dem VII. und VIII.
Pylon. Einige Ägyptologen vermuten, dass der Kernbau der Kapelle einst an
einem anderen - uns nicht bekannten Ort stand, dann aber wohl im Jahre 34 vor
dem seitlichen Durchgang der Westmauer, nahe des VII. Pylons versetzt wurde.
Gleichzeitig erweiterte man die Kapelle mit einem weiteren Pfeilerkranz an
drei Seiten und verband das Gebäude direkt mit der Außenseite der Hofwand.
Heute sind davon nur noch die Pfeilerstümpfe erhalten
(mit den dazwischen eingestellten Brüstungsplatten) und von dem
Barkenheiligtum aus Alabaster nur noch die verwitterten Ansätze der Wand. Die
Ägyptologen konnten den ursprünglichen Zustand des Bauwerks aber aus den
vorgeritzten Standflächen von Pfeilern und Wänden rekonstruieren. Anzumerken
ist, dass die beiden Durchgänge des Heiligtums nicht in seinen Maßen
identisch sind. Der westliche Eingang ist 2,20m breit und der östliche
Eingang nur 1,66m, was nun einen relativ leichten Durchgang der Barke von der
Hofseite aus zum Heiligen See fast unmöglich macht. So war ein "Umdrehen
der Heiligen Barke" im Inneren des Barkenschreins technisch unmöglich,
so dass für den Empfang eines kultausübenden Priesters nur die Vorderseite
der Barke zur Verfügung stand.
Vermutlich wurde also der
Barkenschrein für bestimmte Riten und Festgeschehen konzipiert und nicht als
Rastplatz für die Heilige Barke. Eine andere Möglichkeit wäre, dass die
Statue des Gottes innerhalb des Barkenschreins von der Prozessionsbarke
heruntergenommen wurde und die Priester sie zum Heiligen See trugen.
|

|
Ruinen des Barkenschrein/Seekapelle
Thutmosis III am Heiligen See
Reste der Seekapelle von Thutmosis III.
Das Barkenheiligtum Thutmosis III. wurde in zwei
Abschnitten errichtet. Zunächst war der zentrale Kiosk von einem
Peristyl aus quadratischen Säulen umgeben, die auf das erste Sedfest
des Königs im Jahr 30 zurückgingen. Ein zweiter und größerer Umgang
aus Säulen, die mit Zwischenschranken verbunden waren, bildeten einen
Hof um das Gebäude und tragen das Datum des 2. Thronjubiläums von
Thutmosis III, aus dem Jahr 33. Im inneren des Durchgang befinden sich 5
flache Stufen aus rosafarbenen Granit, die zu einer Plattform
hinaufführen, auf der ein Schrein oder Naos stand. Zwei Monolithwände
aus Alabaster befinden sich noch in situ (siehe Bild), die einst
ein Dach aus demselben Material trugen.
Bild: MDAIK 16 von 1937
- public domain - |
In der Mitte des Schreins sind noch die Überreste
eines Sockels zu sehen, auf dem die Barke ruhte, während an der Rückseite
des Schreins 5 weitere Stufen zum östlichen Eingang führen. Die Achse des
Barkenschreins war mit der des Heiligen Sees (der ebenfalls unter Thutmosis
III. erbaut / oder sein heutiges Aussehen und Größe erhielt) ausgerichtet.
Der östliche Eingang des Schreins führte auf eine Tribüne mit Blick auf den
See. Dieser Heilige See war ein wichtiges Element im täglichen Dasein des
Tempels und seiner Rituale und er hatte viele Funktionen und stand in einem
engen Zusammenhang mit dem Alabaster-Schrein von Thutmosis III (Quelle: nach
Karnak, Evolution of a temple, Elisabeth Blyth, Routledge-Verlag, London
2006).
|
Östlicher Zugang zum Hof zwischen dem 7. und 8
Pylon von Karnak
- durch die Seekapelle von Thutmosis III. - |
Bild:
Karnak Tempelkomplex 01
Author: Olaf Tausch, Wikipedia 4. 3. 2011
Lizenz: CC
BY 3.0 |
(einige
Informationen zu dem 8. Pylon stammen von der Seite von Herrn Dr. Karl Leser (www.maat-ka-ra.de)
- einer sehr informativen Seite über die Königin Hatschepsut).
Südseite:
Der
VIII. Pylon befand sich entlang der südlichen Prozessionsstraße, südlich
des VII. Pylons und nördlich des IX. Pylons. Thutmosis
III. ließ den von Hatschepsut begonnenen VIII. Pylon (aus Sandstein) - der
wahrscheinlich einem älteren Vorgängerbau aus Nilschlammziegeln ersetzte
(evtl. Amenophis I. ?) - in den
Jahren seiner Coregentschaft mit Hatschepsut (Jahr 5-20) vollenden und zum Teil
auch dekorieren. Dieses ergibt sich
aus der Schreibweise des Thronnamens von Thutmosis III., "Men-cheper-ka-Re",
die dieser nur in den Jahren seiner Co-Regentschaft verwendete (siehe
Brovarski in JEA 62, 1976). Sspäter wurden weitere Änderungen unter
Amenophis II., Tutanchamun und Sethos I vorgenommen.
|

|
Kartusche mit Thronname "Men-cheper-ka-Re"
- von Thutmosis III, -
Diese Schreibweise des Thronnamens von
Thutmosis III. wurde nur in den Jahren der Co-Regentschaft (Jahr
5-20) mit Hatschepsut verwendet (siehe JEA 62, 1976).
Bild: Peter Alscher 2006
- Bildausschnitt erstellt von Nefershapiland -
alle Rechte vorbehalten |
Die Länge des Pylons betrug 47,43m. Überall, wo der
Name oder die Darstellungen von Königin Hatschepsut am Pylon sichtbar waren,
wurden diese wohl zu einem späteren Zeitpunkt in der Alleinregierung von
Thutmosis III. abgeändert. An der Südfront des Pylons ließ Thutmosis
ebenfalls Änderungen an den dort befindlichen kolossalen Königsfiguren
vornehmen. Drei Statuen weisen noch heute Bauinschriften von Thutmosis III
auf, die sich auf die Vollendung der Rundbildnisse beziehen. Alle diese
Inschriften wurden an der Vorderseite der Thronsitze eingraviert und waren so
für jeden von Süden kommenden Besucher sichtbar.
Es
ist erstaunlich, dass dieser VIII. Pylon nirgendwo in den Inschriften von
Hatschepsut oder Thutmosis III. erwähnt wird (lt. Grimal und Larché (in
Cahiers de Karnak XII, 2007, S. 492).
|
Die Südfront des VIII. Pylons von Karnak |
| Ursprünglich standen 6 Kolossalstatuen (auf jeder
Seite 3) vor der Südfassade. Zum Zeitpunkt der Bildaufnahme sind nur
noch die Reste der drei Statuen vor dem westlichen Pylonflügel, sowie
eine Statue und 2 Sockel vor dem östlichen Flügel erhalten (PM² II,
1994, S. 176 und Plan XIV). Von den beiden anderen Kolossen vor
dem östlichen Flügel ist nichts mehr erhalten geblieben.
Vor der Fassade des linken Pylonflügels stehen lt. PM² II,
1994) folgende Statuen:
- links: Statue M: Amenophis II. (restauriert von Thutmosis IV.
- neben seinem rechten Bein befindet sich eine kleine Statue der
Königin Tia (Mutter von Thutmosis IV.
- in der Mitte: die besser erhaltene Statue N (Kalkstein; H.
8,84m, B. 2,22m, T. 4,29m) - beschriftet mit dem Namen von
Amenophis I. (Djeser-ka-Ra) und einem "Erneuerungstext"
von Thutmosis III aus dem Jahr 22. Der Rückenpfeiler ist nicht
beschriftet. Es befinden sich aber Inschriften auf der
Gürtelschnalle und neben den Beinen (siehe Loeben 2001)
|
- rechts: Statue O aus Quarzit (von Gebel el-Ahmar) beschriftet mit den Kartuschen
von Thutmosis II. (Aa-cheper-en-Re) und einem
"Erneuerungstext" aus dem Jahre 42 von Thutmosis III -
auf der Außenseite neben dem rechten Bein befindet sich eine
kleine Statue der "Königsschwester" Mut-neferet, der
Mutter von Thutmosis II.
Statue "O" mit Erneuerungstext von
Thutmosis III.
Vor der Fassade des rechten Pylons befinden sich lt. PM² II
1994 folgende Statuen:
- Statue P aus Kalkstein, H. nicht mehr bestimmbar; B. 2,13m;
T. 4,20m aus Kalkstein beschriftet mit den Kartuschen von
Thutmosis II. und einem "Erneuerungs-Text" aus dem Jahr
22 von Thutmosis III. Einen Teil des Kopfes (stark zerstört)
dieser Statue fanden die Ägyptologen direkt vor den Füssen der
Statue.
|
Bild: Achter
Pylon, Tempel Karnak
Author: Olaf Tausch, Wikipedia 4.3. 2011
Lizenz: CC
BY 3.0 |
|
Südseite des VIII. Pylons
(westlicher Flügel) |
| Auf dem Bild sind links des Durchgangs die Fragmente
von drei Sitzstatuen zu sehen - und rechts im Bild (rechts vom
Durchgang - östlicher Pylon-Flügel - nicht im Bild) die Fragmente der Statue
"PM P" aus Kalkstein - beschriftet mit den Kartuschen
Thutmosis II. und einem Erneuerungstext von Thutmosis III. aus dem
Jahr 22. Ein Teil des Kopfes dieser stark zerstörten Statue lag zum
Zeitpunkt der Bildaufnahme direkt vor den Füssen der Statue. |
Bild: Courtesy to Elvira
Kronlob, November 2023
- alle Rechte vorbehalten - |
Direkt
neben der neu rekonstruierten Statue "O" (links vom Durchgang) ist die linke Seite des Vorbaus des 8. Pylons (PM 525)
zu sehen, er wurde errichtet von König Ramses IX. Am inneren Türpfosten des
westlichen Teil des Vorbaus befindet sich eine Textkolumne mit den Namen von
Ramses IX. An der Front befinden sich mindestens drei Textkolumnen mit den
Namen Ramses IX. (siehe linkes Bild unten).
|
Kolossale Sitzstatue O aus Kalkstein vor dem
VIII. Pylon (Thutmosis II.) |
| In neuester Zeit wurde die kolossale
Sitzstatue aus Quarzit von Thutmosis II (Statue O nach PM - linkes
Bild Zustand vor der Restaurierung) restauriert
und wurde im August 2022 fertiggestellt. Die Statue wurde zur Zeit von
König Thutmosis II. angefertigt - blieb jedoch im Steinbruch am Roten
Berg liegen. Erst König Thutmosis III. (sein Enkel) ließ sie in
seinem 42 Jahr mit einer Inschrift auf ihrer Rückseite versehen und
vor dem VIII. Pylon aufstellen (siehe rechtes aktuelles Bild von
Elvira).
Neben dem rechten Bein des thronenden Königs (siehe Bild von
Hanne) sind die Reste (Füße) einer Frauenfigur erhalten (nur noch
sehr schlecht erkennbar), die die Beischrift oberhalb ihrer
Namenskartusche als "sAt ns.wt mrt=f
/ Tochter des Königs, geliebt von
ihm, Mut-neferet trägt.
Die aber die Mutter von Thutmosis
II. keine Königstochter war, ist hier zu vermuten, dass es sich bei
der Statue um eine umgewidmete Statue von Thutmosis I. und seine
Gemahlin handelt, die schon Königin Hatschepsut hat aufstellen lassen
und die dann im Zuge ihrer Verfolgung umgewidmet wurde. Anmerkung
der Autoren von Nefershapiland:
Nach der Restaurierung der Statue scheint die kleine Figur einer
Frauenstatue (wovon nur noch die Reste der Füße erhalten waren)
verschwunden zu sein. Der Sitz (Thron) wurde stark geglättet (evtl.
auch neu eingefügt). |
|
Bild: Courtesy to Hanne Siegmeier |
Bild: Courtesy to Elvira Kronlob Nov. 2023
- alle Rechte vorbehalten - |
An der Südfront des Pylons ließ
Thutmosis III. Änderungen an den dort befindlichen kolossalen Königsfiguren
vornehmen. Drei Statuen weisen noch heute Bauinschriften Thutmosis III. auf, die sich auf die Vollendung der Rundbilder
beziehen. Alle diese Inschriften sind an der Vorderseite der
Thronsitze eingeschrieben und waren so für jedem von Süden kommenden Besucher
sichtbar.
Kolossale Sitzstatue N
aus Kalkstein vor dem
VIII. Pylon (Thutmosis II.)
- umgewidmet für Amenophis I. - und kleine Sitzstatue rechts daneaben
(evtl. eine Gottesgemahlin? |
Die am besten
erhaltene Statue N vor dem westlichen Flügel der Südseite des VIII.
Pylons zeigt einen thronenden König, dessen Hände auf seinen Schoß
liegen. Die rechte Hand ist zur Faust geballt und er hält ein Tuch
darin (lt. Dissertation von Loeben 2001), die linke Hand liegt flach
auf dem Oberschenkel. Die Statue ist - mit Ausnahme des Gesichts -
noch relativ gut erhalten. Der Rückenpfeiler ist nicht beschriftet -
aber auf der Gürtelschnalle und neben den Beinen befinden sich
Inschriften:
Lt. Loeben ist der Text auf der Gürtelschnalle verändert worden.
Weitere Änderungen erfolgten in der Amarnazeit und in der
Ramessidischen Zeit. Der Erneuerungstext (neben dem linken Bein)
lautet (nach Loeben)
"Geliebt von Amun, dem Herrn der
Throne der Beiden Länder ist der Vollkommene Gott, der Herr der
Beiden Länder +Sr-ka-Ra, der
Sohn des Re, von seinem Leib, Amenhotep (I.). Nun gemacht worden ist
eine Vervollkommnen dieser Statue im Regierungsjahr 22 unter der
Majestät des Königs von Ober- und Unterägypten, Men-cheper-Ra, der
ewig leben möge".
Loeben
will in dieser Statue (und in der Statue P) ursprünglich
Darstellungen der Königin Hatschepsut erkennen, die Thutmosis III.
wegen ihrer beeindruckenden Erscheinung vor dem VIII. Pylon bei seiner
Verfolgung ihres Andenkens verschont und sie nur zugunsten seiner
Vorfahren "umgewidmet" hatte (Quelle: www.maat-ka-ra.de
(Dr. Karl Leser).
Rechts neben der
großen Statue PM N an ihrer rechten Seite eine kleine Sitzstatue, die
neben ihrem linken Bein den Rest einer nicht mehr lesbaren Kartusche
zeigt - möglicherweise den Titel einer "Gottesgemahlin",
wobei sich die Frage stellt, welche Gottesgemahlin hier gemeint ist -
wenn die große Kolossalstatue N ursprünglich der Königin
Hatschepsut gehört hatte, ist die kleine Sitzfigur vielleicht ihre
Tochter Neferu-Ra?
Porter und Moss
(1994) weist die kleine Statue für die Tochter von Thutmosis III. und
seiner Gemahlin Merit-Ra aus, also für Merit-Amun II. (nach
Sander-Hansen trug diese wohl ebenfalls den Titel einer
Gottesgemahlin. Aber da die große Statue nach der Umwidmung nun
für Amenophis I. datiert ist, könnte die kleine Statue auch seine
Mutter Ahmose Nefertari darstellen, die ebenfalls den Titel einer
Gottesgemahlin trug und später zusammen mit ihrem Sohn vergöttlicht
wurde. Das Oberteil dieser Statue befindet sich heute im Brit. Museum
(von Belzoni in der Nähe des 8. Pylon gefunden - erst 1970 erkannte
man, das die beiden Teile zusammengehören) und wird von Museum der
Ahmose Nefertari zugewiesen. Die Inschriften auf dem Unterteil der
Sitzstatue (heute noch in situ) nennen nach Angaben des Brit.
Museums den Namen der Merit-Amun I. als auch den ihrer Schwester
Sat-Amun, die beide auch Gemahlinnen ihres Bruders Amenophis I. waren. |
|
Bild: Courtesy Peter Alscher 2006
- alle Rechte vorbehalten - |
Bild: Courtesy Elvira Kronlob
- alle Rechte vorbehalten - |
Das untere Foto des Westflügels
zeigt (hinter den Statuen) auch deutlich die starken Beschädigungen an der
Südfront des VIII. Pylons - insbesondere im Bereich der Nischen, wo früher
die Fahnenmasten gestanden hatten.
|
Die linken beiden Sitzstatuen vor dem westlichen
Flügel
der Südseite des VIII. Pylons |
| Die linke (stark zerstörte) Statue (PM
"M"), von der nur noch Teile der Beine und der Füße
erhalten sind, gehören zu Amenophis II - restauriert von Thutmosis
IV. Neben dem rechten Bein befindet sich eine kleine Statue, die die
Kartuschen der Königin Tia (Mutter des Thutmosis IV) trägt.
Rechts
daneben die oben beschriebene - noch relativ gut erhaltene -
Kalkstein-Statue N, mit dem Namen Amenhotep I. (Djeser-ka-Ra) und
einem Erneuerungstext aus dem Jahr 42 Thutmosis III.
|
Bild: File
by Alexander Baranov
Author: Alexander Baranov 16. May 2011, Wikipedia
Lizenz: CC
BY 2.0
- modifiziert (beschnitten rechts) von Nefershapiland - |
|
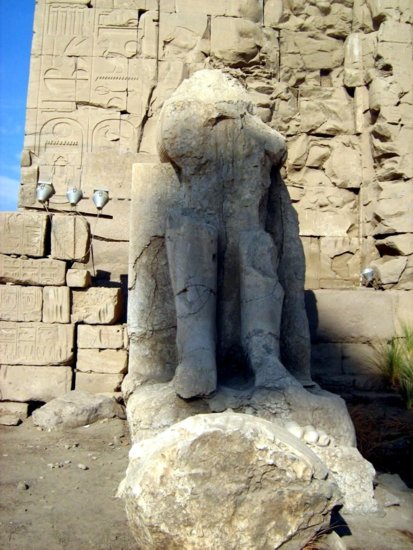
|
Der westliche Flügel der Südseite des VIII.
Pylons
mit Sitzstatue P (PM² II 177 [M] )
Reste der Statue PM² II (P) aus Kalkstein mit einer
Breite von 2,23m und einer Tiefe von 4,20m (Höhe lässt sich heute
nicht mehr bestimmen). Die Statue ist mit den Kartuschen von Thutmosis
II. beschriftet und einem "Erneuerungs-Text" aus dem Jahr 22
von Thutmosis III. Die Statue ist nur bis zur Hüfte erhalten - ein Teil
des Kopfes liegt zur Zeitpunkt der Aufnahme direkt vor ihren Füßen.
Foto: Courtesy to Elvira Kronlob
- alle Rechte vorbehalten - |
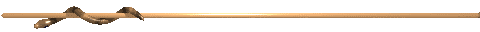
Die Dekoration der
Südseite des VIII. Pylons zeigt an seiner Außenwand auf beiden Seiten der
Pylontürme (PM² II 175+176 [521+522] ) die übliche Darstellung "Pharao
erschlägt seine Feinde vor Amun-Re". Lt. den Kartuschen zeigt die
Darstellung den König Amenophis II. (Sohn von Thutmosis III.), dem sein Ka
folgt mit einem Erneuerungstext von Sethos I. Amenophis II. ließ die
Südseite des Pylons neu gestalten und Sethos I. ließ ihn restaurieren. Lt.
PM² II 175 [521] befindet sich an jedem Ende, Reste eines langen Textes aus
einer früheren Zeit (evtl. Hatschepsut?),
|

|
Südseite des VIII. Pylons -
östlicher Turm
Zwischen den beiden zerstörten
Nischen auf dem östlichen Pylonturm befindet sich eine großformatige
"Erschlagen-der-Feinde-Szene" (PM² II 176 [522] ) vor
Amun-Re. Darüber ein Restaurierungstext von Sethos I.
Darüber befinden sich die Kartuschen
von "Aa-cheper-ka-re" (Amenophis II.) und Reste eines älteren
Textes auf beiden Seiten des Durchgangs, die aber heute nicht mehr zu
entziffern sind (evtl. aus der Zeit von Hatschepsut?).
Bild: Vor
dem 8. Pylon von Karnak
Author: Olaf Tausch, Wikipedia 1. 4. 2009
Lizenz: CC
BY-3.0
- Bild beschnitten an beiden Rändern und oben von Nefershapiland
-
|
|

|
Türpfosten des Durchgangs
Auf beiden Seiten der Türpfosten des
Durchgangs befinden sich Inschriften mit den Kartuschen - rechts: von
Thutmosis III. mit der älteren Schreibweise "Men-cheper-ka-Re"
(siehe weiter oben) und links (Westseite) von Thutmosis II. Der
Türsturz ist heute leider nicht mehr vorhanden.
Bild: Vor
dem 8. Pylon von Karnak
Author: Olaf Tausch, Wikipedia 1. 4. 2009
Lizenz: CC
BY-3.0
- Bild beschnitten an beiden Rändern
von Nefershapiland - |
Vor dem 8. Pylon befand sich zur
Zeit Thutmosis III. ein Hof der durch den Torbau Amenophis I. im Süden abgeschlossen wurde. Durch die Grabungen von
van Siclen III konnten zahlreiche Umbauten in diesem Bereich nachgewiesen
werden. Thutmosis
III. ließ gegen Ende seiner
Regierungszeit den Hof verkleinern und eine Mauer einziehen, welche den Hof
auf die Breite des VIII. Pylons verschmälerte.
Eine Seitentür (PM 527) und ein
Treppenaufgang (zur Seite des heiligen Sees hin) befinden sich im östlichen
Flügel des VIII. Pylons in Richtung "Torbrücke" hin. Da jedoch die
"Torbrücke" nicht mehr vorhanden ist, endet dieser Treppenaufgang
im "Nichts" und ist heute für die Besucher gesperrt. In der späten
19. Dynastie wurde an einer Seite dieser Tür eine lange Inschrift angebracht
(im Auftrag des Hohepriesters Roma-Roy). Rund 50 Jahre später ließ der
Hohepriester Ramsesnacht zwei Szenen, in denen er der thebanischen Triade
opfert - hoch über dem Text des Roma-Roy eingravieren - einschließlich einer
Opferszene.
|

|
Seitentür mit Treppenaufgang zum Dach
an der östlichen Seite des VIII. Pylons
(PM² 177 [527a-d] )
mit Inschriften und Darstellungen oben Sethos II. vor
dem thronenden Amun-Re und darunter Inschriften und Darstellungen des
HPA Roma-Roy und seinem Ka.
Am Ende des Treppenaufgangs befinden sich auf beiden
Seiten Graffiti aus späterer Zeit. Die Graffitis zeigen Zeremonien vor
dem 7. Pylon des Thutmosis III. und stammen vermutlich von
"privilegierten" Besuchern, die wahrscheinlich auf das Dach
oder die heute nicht mehr vorhandene Brücke des Pylons steigen durften,
um von dort aus die Zeremonien vor dem 7. Pylon Thutmosis III.
beobachteten. Die Seitenflügel des südlichen Toreinganges sind
im Namen von Thutmosis II. (Westseite) und Thutmosis III. (Ostseite)
dekoriert.
Bild: Courtesy to Kairoinfo4U
- alle Rechte vorbehalten -
|
Nordseite des VIII. Pylons
Nordansicht des VIII. Pylons. |
| Der Pylon ist der erste Bau im alten Ägypten, der
komplett aus Sandstein erbaut wurde. |
Bild:
Karnak
Author: Jorge Láscar from Melbourne, Australia, Sept. 2012, Wikipedia
Lizenz: CC
BY-2.0 |
Neben dem zentralen Durchgang - gesehen von der
Nordseite des Pylons steht vor dem westlichen Pylonflügel eine
fragmentarische Statue aus Grauwacke auf einer Basis aus Sandstein, die mit
dem Pylon verbunden ist, was lt. Loeben (2001) vermuten lässt, dass diese
Statue - von der heute nur noch die Füße und Teile der Beine vorhanden sind
- noch unter Hatschepsut oder Thutmosis III (in seiner Zeit als Co-Regent)
entstanden ist. Leider lässt sich heute nicht mehr feststellen, wem diese
Statue einst gehörte (2), obwohl sich an der linken Seite des Thronsessels
die Kartuschen eines ramessidischen Königs befinden (die aber evtl. später
eingefügt worden sein können). Bei PM ist diese Statue leider nicht aufgeführt? Evtl. hat ein ramessidischer König diese Statue später
"vervollkommnet".
|
Statue aus Grauwacke vor dem VIII. Pylon |
Inschriften und Kartuschen an der rechten
Thronseite der Statue |
| Vor der Nordseite (Westflügel) befinden
sich die Fragmente (nur noch die Füße und Reste der Beine sowie
Reste des Throns sind
erhalten) einer königlichen Sitzstatue aus Grauwacke, von hoher
handwerklicher Qualität. Die nackten Füße des thronenden Königs
"ruhen" auf den "neun Bogen" als Symbol für die
Unterwerfung der Fremdvölker durch ihn. Die Statue steht auf einer
Basis aus Sandstein, die direkt an den Torpfosten des Pylons
anschließt und mit diesem verbunden ist.. Christian E. Loeben (Beobachtungen
zu Kontext und Funktion königlicher Statuen im Amun-Rempel, 2001,
Verlag Helmar Wodtke und K. Stegbauer GbR, Leipzig) vermutet, dass
diese Statue bereits unter Königin Hatschepsut oder auch Thutmosis
III. (zur Zeit der Co-Regentschaft) gefertigt wurde. Leider lässt
sich heute nicht mehr feststellen, für wen diese Sitzstatue
ursprünglich mal angefertigt wurde. Bei Porter & Moss ist diese
Statue leider nicht beschrieben.
Auf der linken vorderen Thronseite (von vorne gesehen) - neben
den Resten der Beine - befinden sich Inschriften (aber keine Kartusche). Auf der
gleichen Seite des Thronsessels befinden sich zwar auf der rechten
Seitenfront teilweise erhalten der Thronname und der Geburtsname (mit
den königlichen Titeln) eines Königs, wobei es sich wohl
höchstwahrscheinlich um den Geburtsnamen (und bei den Kartuschen
links und rechts davon um den Thronnamen) von König Ramses IV.
handeln, der die Statue wohl "vervollkommnete"
(usurpierte).
|
|
Beide Bilder: Courtesy to Elvira Kronlob 2022
- alle Rechte vorbehalten - |
Westflügel des VIII. Pylons
Vor dem Westflügel des VIII. Pylons - rechts neben den
Fragmenten der Statue aus Grauwacke - befinden sich
die Überreste einer Mauer (?) oder
Einfassung aus Kalkstein, die bis zu einer Höhe des 1. Registers auf der
dahinterliegenden Pylonwand reicht. Es kann heute nicht mehr belegt werden,
inwieweit diese Mauer den Pylon umfasste - eine vollständige Umschließung,
wie es Baguet (Le Temple d'Amon-Re á Karnak, 1962, S. 258ff) es für möglich
hält, ist nicht nachweisbar. Die Funktion dieser Mauer ist unbekannt und die
Inschrift auf der Einfassung so stark zerstört, dass sie heute nicht mehr
lesbar ist - ebenso die Inschriften der Königin Hatschepsut auf der Nordseite
des VIII. Pylons, die weitgehend verändert, ausgelöscht oder überschrieben
wurden.
|
Westflügel des VIII. Pylons mit Überreste einer
"Einfassungsmauer" |
Vor dem westlichen Flügel des VIII. Pylons befinden
sich Reste eine niedrigen Einfassungs-Mauer (siehe Pfeil), auf der man
noch Spuren einer Inschrift erkennen kann. Die Mauer steht auf einem
Sockel aus Ziegeln und reicht bis zu einer Höhe des 1. Registers an
der Pylon-Außenwand. Es ist aber unklar, ob die Mauer den ganzen
Pylon umschloss - auch über Sinn und Zweck dieser Mauer gibt es keine
Informationen. Vor dem Ostflügel der Nordseite sind im übrigen keine
derartige Baureste zu erkennen.
Die Mauer auf der Ostseite ist nach oben hin wie eine Brüstung
abgerundet und in ihrer Art und Weise bislang einzigartig. Die
Inschrift ist zu zerstört, als dass man sie lesen könnte. |
Bild: Courtesy to Hanne Siegmeier
- alle Rechte vorbehalten - |
Westflügel der Nordseite des VIII. Pylons (PM²
II 174 [519] )
|
| Auf dem Westflügel des VIII. Pylons zeigt das 1.
Register (oben) in zwei Szenen von links, die Barke des Amun, die von
den Priestern auf ihren Schultern getragen wird und den König
Thutmosis II. (ursprünglich Hatschepsut), der von Month geführt
wird. Davor sieht man den König, der vor dem thronenden Gott Amun-Re
steht (hier sind deutlich Abänderungen bei der Figur des thronenden
Amun-Re und auch bei dem hinter ihm stehenden Gott Chons zu erkennen).
Hinter dem König steht die Göttin Weret-Hekau, die einen sehr langen
(?) Arm hat und ihre Hand auf seine Schultern legt. Zwischen Göttin
und König befinden sich Restaurationstexte von Sethos I. Der hinter
der Göttin stehende Thot notiert die "Regierungsjahre" des
Königs. |
|
Bild: Courtesy to Hanne Siegmeier - Ausschnitt
erstellt von Nefershapiland
- alle Rechte vorbehalten - |
In allen Szenen nennen die
Kartuschen den König Thutmosis II. als die dargestellte Figur - in allen
Fällen dürfte es sich - ebenso wie auf dem Ostflügel - jedoch um eine
nachträgliche Änderung der Kartuschen von Hatschepsut handeln, die im Zuge
ihrer "Verfolgung" getilgt und umgeändert wurden.
Die Darstellungen im 2.
(unteren) Register (vier Szenen) und im 3. Register (acht Szenen) tragen die
Kartuschen von Ramses III. und wurden auch original in dieser Zeit dekoriert.
Die Inschriften auf den beiden
Torpfosten (links und rechts des Durchgangs) zeigen links die Kartuschen von
Thutmosis III. (siehe weißer Pfeil auf dem nachfolgenden Bild) und rechts die
von seinem Vater Thutmosis II. (ursprünglich wohl Hatschepsut).
|
Tordurchgang Nordseite des VIII. Pylons |
| Die Inschriften auf den Torpfosten des Ostflügels
der Nordseite des VIII. Pylons zeigen die Kartuschen von
Thutmosis III. mit dem Thron- (Men-cheper-Re) und Geburtsnamen des
Königs mit je 2 Textkolumnen (ursprünglich Hatschepsut). Die
Kartuschen auf dem Torpfosten des Westflügels nennen die Namen von
Thutmosis II. |
Bild: Courtesy to Hanne Siegmeier
- alle Rechte vorbehalten - |
Auf der rechten Seite des
westlichen Flügels befindet sich ein kleines Tor (siehe "Tor" auf dem
Plan unten) - ein sekundärer Zugang zur Prozessionsstraße und wahrscheinlich
bis zur Herrschaft von Haremhab ein Eingang von außerhalb des Bezirks. Auf dem
östlichen Pfosten und auf dem Inneren des Durchgangs sind Ansammlungen von
Graffiti aus dem Neuen Reich zu sehen. Außerdem eine Darstellung von
Ahmose-Nefertari und Amenophis I. - einer großen Götterdarstellung in
Pavianform, göttliche Barken und Paviane.
|
Plan des VIII. Pylons Süd- und Nordseite |
|
Nordseite:
PM 517 zwei Register:
1) Thutmosis II, geleitet von
Weret-Hekau, vor der Barke des
Amun,
die von Priestern getragen wird.
2) Thutmosis I. vor der theb. Triade,
mit
Text, in welchem er Amun-Re dankt für
die
Anerkennung von Hatschepsut (später
umgeändert für Thutmosis II.)
wahrscheinlich
unter Thutmosis III.
PM 518 zwei Register:
1) Sethos I. vor Amun mit kl.
Götterneunheit
2) Sethos II. mit Renovierungstext,
opfert
Wein vor Amun-Re mit gr. Götterneunheit
Westlicher Pylonturm
PM 519 drei Register
1) Thutmosis II (urspr. Hatschepsut) mit
Erneuerungstext von Sethos I, 3 Szenen:
1. Barke d. Amun-Re, getr. von Priestern
2. der König geleitet von Month
3. der König geleitet von Weret-Hekau zu
Amun-Re und Chons mit
Thot, der auf der
Heb-sed-Wane am linken
Ende schreibt.
2) Ramses III., vier Szenen:
1. wird gereinigt durch Thot und Horus
2. wird gekrönt von Atum und Re-Harachte
3. wird geleitet von Chons und Mut
4. erhält heb-sed-Feste von Amun-Re + Ament
3) acht Szenen:
König mit Mut, opfert die Maat vor Amun-Re;
opfert Wasser vor Chons: opfert Wein vor
Mendes; weihräuchert und libiert vor Amun-Re
und Chons: der König mit Thot opfert die Maat
vor Re-Harachte und Iusas (?);
mit Buto beim Opfern von Wasser (?) an Atum
und Hathor; mit Weret-Hekau opfert heb-sed-
Feste vor Amun-Re und Mut; opfert Wein vor
Onuris-Schu und Tefnut.
Tordurchgang VIII. Pylon
PM 520a-b Türpfosten, je zwei Textkolumnen
Thutmosis III und II (ursprünglich Hatschepsut)
PM 520c zwei Register:
1) Ramses II erhält Leben von Bubastis
2) Ramses II opfert die Maat vor Amun-Re
PM 520 d: zwei Register
1) Ramses II. im Kultlauf mit Flagelum und
"mks" zu Mert, Amun-Re und Amente
2) zwei Szenen: 1. Ramses II. vor Amun-Re
2. Ramses II. geleitet von Chons und Mut
Text an der Basis: Oben Ramses III. - unten Ramses IV.
PM 520e-f [Türsturz von Hatschepsut und Thutmosis III] und Türpfosten
mit Namen und Titeln von Thutmosis II. und Thutmosis III.
|
Südseite des Pylons
Westlicher Pylonturm
PM 521 Amenophis II. mit seinem Ka, erschlägt
Feinde vor Amun-Re mit Erneuerungs-
Text von Sethos I. An jeder Seite, Reste
eines langen Textes von früherer Szene,
Zeit Hatschepsut.
PM 522 Amenophis II. mit seinem Ka erschlägt
Feinde vor Amun-Re mit Renovierungs-
Text von Sethos I.
PM 523+524 Flaggenmastnischen mit Text A. II.
PM 525+526 Pylonvorbau Ramses IX. Sandstein
Türsturz (später gefunden) Doppelszene:
rechts: Amenophis, 1. Prophet des Amun kniend
vor Amun-Re und Horusname und Kartusche von
Ramses IX.
Statuen: Südseite_ M-P
M: [Amenophis II] restauriert d. Thutmosis IV.
heute zerstört außer Teile des Throns und der
Statuenbasis, und die Statuette Königin Tia am rechten Fuß.
Statue N:
Amenophis I. mit Restaurierungstext von Thutmosis III. aus Jahr 22
am Thron, und Statuette von Ahmose Mery-Amun (Tochter von Thutmosis III)
östlich davon
Statue O:
Unterer Teil einer Quarzit-Statue Thutmosis II.
- restauriert von Thutmosis III. aus Jahr 42, am
rechten Fuß. Statuette v. Prinzessin Mutneferet.
2022 wurde die Statue O restauriert.
Statue P:
Kolossalstatue aus Kalkstein, restauriert durch
Thutmosis III. im Jahr 22, Text am Gürtel
Granitstele Q:
Basis in situ, Fragmente der Stele hierher zurückgelegt - obere
Bildteil Doppelszene: Amenophis II. opfert Wein vor Amun-Re
Granitstele R:
Stele Amenophis II. mit Restaurierungsinschrift
Sethos I. - in situ.
Block S:
Ramses IV kniend erhält heb-sed-Feste von einem Gott, vor ihm der Persea-Baum mit Atum (?) schreibend den Königsnamen
PM 527: Treppe im Ostturm des Pylons
|
|
Plan nach PM² II XIV + S. 174ff
- modifiziert von Nefershapiland |
Auch vor dem östlichen Pyloneingang scheint einst
eine königliche Statue gestanden zu haben. Lt. dem Plan von Porter &
Moss, einem alten Foto bei Schwaller de Lubicz (Karnak, Platte 380-381) und
dem Werk von Grallert (Bauen-Stiften-Weihen) befinden sich vor beiden
Torpfosten an der nördlichen Pylonseite Überreste von Statuen, die auf einer
Basis aus Sandstein ruhten (siehe weiter oben), wobei vor dem östlichen Pylon
nur noch Spuren der Basis zu erkennen sind (auch nur auf dem Foto bei
Schwaller de Lubicz).
|
Ostflügel der Nordseite des VIII. Pylons |
| Die Inschriften der Königin Hatschepsut (Erbauerin
des VIII. Pylons) sind weitgehend verändert, getilgt oder
überschrieben worden. |
|
Bild: Courtesy to Hanne Siegmeier
- alle Rechte vorbehalten - |
|
Ostflügel der Nordseite des VIII. Pylons (PM²
II 174 [517-518] ) |
| Ostflügel des VIII. Pylons - oberstes Register: die
Göttin Weret-Hekau führt König Thutmosis II. nach links zu der
Göttin Hathor (die "njnj" macht). Hinter dem König
folgt eine Barke des Amun-Re (rechts), die von den Priestern auf ihren
Schultern getragen wird (PM 517).
Links hinter dieser Szene befindet sich eine Szene aus der Zeit
Sethos I. Der König vor Amun-Re mit "kleiner
Götterneunheit". |
|
Bild: Courtesy to Hanne Siegmeier - Ausschnitt
erstellt von Nefershapiland
- alle Rechte vorbehalten - |
|
Ostflügel der Nordseite des VIII. Pylons (PM²
II 174 [517-518] ) |
| Die Darstellungen im 2. (unteren)
Register auf dem Ostflügel zeigen Thutmosis I. vor der thebanischen
Triade (Amun, Mut und Chons) mit einer Rede. Der König bedankt sich
bei dem inthronisierten Gott Amun-Re dafür, dass dieser seine Tochter
Hatschepsut (später geändert auf Thutmosis II.) auf den Thron
gesetzt hat (PM² II, 174 [517] ) - Text: Urk. IV., Paragr. 271 ff -
Dahinter eine später eingefügte (oder geänderte) Szene:
Sethos I (mit Erneuerungstext) opfert Wein vor Amun-Re und der Großen
Götterneunheit (in einer vertieften Darstellung an der Pylonwand).
Auf dem Türpfosten (östlicher) rechts im Bild - befindet sich
die Titulatur von Thutmosis III. (mit einer Kombination seiner
Kartusche in einer Schreibweise, die dieser nur in den Jahren der
Co-Regentschaft Jahr 5-20 verwendete). |
|
Bild: Courtesy to Hanne Siegmeier - Ausschnitt
erstellt von Nefershapiland
- alle Rechte vorbehalten - |
| Karnak-Süd: Kamutef-Heiligtum |
Außerhalb der Umfassungsmauer des
Karnak-Tempels - unmittelbar nördlich vom Tempelbezirk der Mut - befinden sich
die Reste eines Heiligtums, das von seiner Größe her nicht unbedeutend war und
aus zwei Gebäuden (dem eigentlichen Tempel und einem Stationstempel) bestand.
Direkt gegenüber dem Kamutef- Heiligtum liegt auf der anderen Seite die
Crio-Sphingen-Allee der Hatschepsut, die jetzt den 10. Pylon des Amuntempels mit
dem Mut-Bezirk verbindet.
|
Blick auf die Prozessionsallee zum 10. Pylon
- rechts der Eingang zum Kamutef-Heiligtum - links zum Stationstempel - |
|
Bild: public domain (Neithsabes) Wikipedia |
Der Bau wurde lt. Ricke - aufgrund
der gefundenen Relieffragmenten - ursprünglich von Königin Hatschepsut erbaut
und dann von Thutmosis III. übernommen, der alle Namen wegmeißeln und in
einigen Fällen durch seine eigenen Kartuschen ersetzen ließ. Später wurde das
Bauwerk durch König Sethos I. restauriert, und Ramses IV. ließ ebenfalls seine
Namen im Tempel anbringen.
Schon in den Karten der "Description"
wird die Lage der Baureste angegeben, wenn auch nur schematisch und sehr
ungenau. In der Beschreibung der "Description" finden sich allerdings
dazu keine Hinweise auf die Bauwerke.
Auch während der
Lepsius-Expedition wurden die damals entdeckten Bauteile vermessen und in die
Pläne eingetragen, jedoch auch noch sehr ungenau in ihrer Lage. Im Text sind
nur die Sachmet-Statuen vor dem Eingang des Haupttempels erwähnt mit dem
Zusatz: "Dahinter noch Mauerreste". Erst Borchardt veranlasste die
Freilegung der Tempelreste und auf seine Bitte hin veranlasste die ägyptische
Altertumsbehörde im Frühjahr 1936 die Freilegung des Stationstempels durch
Chevrier. Weitere Untersuchungen erfolgten dann 1937 durch Ricke.
In den Folgejahren - unterbrochen
durch den 2. Weltkrieg - erfolgten dann weitere Grabungen, u. a. durch
Macramallah, Ricke (das Kamutef Heiligtum in Karnak), Gerhard Haeny und
schließlich brachte Labib Habachi zu zum Abschluss. Die Beschreibung des
Heiligtums erfolgt hier teilweise nach Ricke,
H. "Das Kamutef-Heiligtum Hatschepsut's und Thutmosis III. Bericht über
eine Ausgrabung vor dem Muttempelbezirk", 1954.
Beide Tempel (das
Kamutef-Heiligtum und der Stationstempel) sind heute weitgehend zerstört. Der
Tempel für den Gott Amun-Kamutef stand auf einer Fundamentplatte, deren
erhaltene Teile lt. Ricke etwa 2,20m dick waren und aus drei Schichten von
Sandsteinblöcken bestanden, die sehr tief in den Boden versenkt worden waren,
so dass der Flur des Tempels ehenerdig war.
Der gesamte Tempelbezirk war einst
von einer Umfassungsmauer umgeben, von der Ricke bei seinen Ausgrabungen
nördlich von der Nordost-Ecke des Erweiterungsbaues Reste der Ziegelmauer fand,
die auf einem Fundament von massiven Steinblöcken errichtet war. Reste eines
Tores wurden ungefähr 40m entfernt von dem ursprünglichen Tempelgebäude
nachgewiesen. Vor dem Tor fand man verstreut liegend die Reste von
Quarzitblöcken, die einst wohl zu mehreren Kolossalstatuen gehörten, die vor
dem Toreingang standen. Obwohl die Datierung des Tores als auch die
Ziegelmauerreste unsicher sind (da man keinerlei Gründungsziegel oder
Ziegelstempel fand, hält Ricke es für möglich, dass die Umfassungsmauer
bereits in der frühen 18. Dynastie (unter Hatschepsut oder Thutmosis III.)
entstanden ist.
|
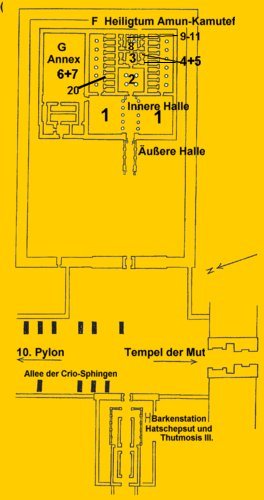
|
Grundriss des Kamutel-Tempels
und der Barkenstation (nach PM)
Zwischen den beiden Bauwerken verlief
die Sphingenallee, welche vom 10. Pylon des Zentral-Heiligtums von Karnak
zum Tempel der Mut von Ascheru und weiter zum Luxortempel führte.
Der Tempel befand sich außerhalb des Temenos an der Sphingen-Allee
zwischen Amun- und dem Mutbezirk.
Der Grundriss bestand zunächst aus
einem Hof (etwa 1/3 der Gesamtfläche) und einem Tempelhaus mit 3 Trakten.
Diese waren entlang der Hauptachse orientiert und besaßen jeweils eigene
Eingänge. Der ursprüngliche Tempelbau hatte eine Breite von 32m und eine
Tiefe von 39m (nach Ricke 1954) und stand auf einer Fundamentplatte, deren
erhaltene Teile etwa 2,20m dick waren.
Die mittlere Zone des Heiligtums wurde
von einem 4-Säulen-Saal, mehreren Kult- und Opferräumen und ein
dreigeteiltes Heiligtum im hinteren Bereich gebildet. In den beiden
Seitenflügeln reihten sich an der Innenwand je 9 Kapellen, sie sich zu
einem Korridor mit 6 Säulen öffneten. In späterer Zeit - evtl. unter
den Kuschiten (Quelle Donadoni, Theben, 1999) (?) - wurde diese
Architektur um eine zentrale Kolonnade im Hof und einen Säulengang vor
dem Tempeleingang bereichert.
Im Norden der Anlage befindet sich ein
Annex, der vermutlich etwa ebenso alt ist wie der Tempel selbst. Er
besteht aus einem offenen Hof, der sich hinter einem kleinen Gebäude
befindet mit einem Portikus (Quelle: Donadoni, S. 99) |
Erklärung:
1. Vorhof
2. überdachte Vorhalle (nach Ricke 1954) Breite 9,50m Tiefe 8,50m
3. quadratischer Raum - evtl. offen? - etwa 4m Seitenlänge
4-5 u. 6-7. Kapellen mit Vorraum - zu beiden Seiten von Raum 3
In Raum 5 fanden sich Reste von Darstellungen,
die einen König zeigten, der von einer Göttin vor einem links
befindlichen Gott geführt wurde. Aus dem Raum
7 wurde der Teil einer Rückwand gefunden, auf dem sich Reste einer
Darstellung des Amun-Re-Kamutef "hoch an
Federn, der sich seiner Schönheit rühmt (lt. Ricke)".
In Raum 7 gefundener Reliefrest - ein Teil der
Rückwand mit einer Darstellung des Amun-Kamutef, hoch an Federn.
- Zeichnung nach Ricke 1954 etwas ergänzt - modifiziert von
Nefershapiland -
8. zentraler Raum mit drei Statuenschreinen (9-11)
20. Raum - mit einer lebensgroßen Statuengruppe aus gelb-rotem Quarzit,
die hier gefunden wurde (mit zwei thronenden Personen - einer
männlichen und weiblichen Figur (heute befindet sich diese
fragmentarische Statuengruppe außerhalb der Tempelanlage - auf der
Seite liegend - rechts vor dem Eingang)
|
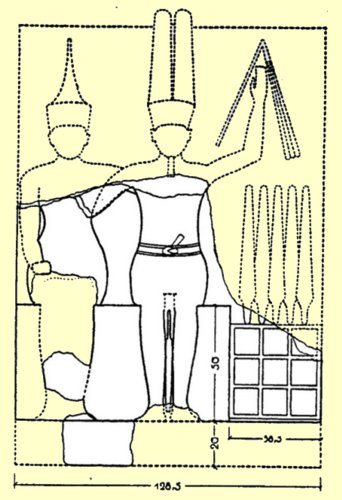
|
Rekonstruktionsversuch einer Umzeichnung
der Statuengruppe
- nach Ricke 1954 -
- modifiziert von Nefershapiland -
Die männliche Figur trägt den
Königsschurz, Gürtel und einen Stierschwanz. Die weibliche Figur
trägt ein eng anliegendes Kleid, rechter Arm mit Hand sind nicht mehr
vorhanden. Ricke schließt aufgrund der Modellierung des Körpers auf
Hatschepsut.
Auf dem unteren Teil neben der männlichen Figur
ist ein Lattichgarten in flachen Relief zu erkennen. Lt. Ricke
befand sich auf dem weggebrochenen Teil der erhobene Arme der
männlichen Figur, zweifellos mit einem Wedel darüber im hohen
Relief. Die männliche Figur zeigt also fraglos Amun in der
Verkörperung von Kamutef. |
Ricke vermutet - dass aufgrund der im Kernbau
vorgefundenen Reliefreste das ursprüngliche Tempelhaus in der
Regierungszeit von Hatschepsut errichtet worden ist. Diese Reste bestehen
vor allem aus Teilen von Namensfriesen verschiedener Größe, welche die
Wände des Kerntempels nach oben hin abschlossen und auch aus Resten des
Horusnamens und Thronnamens der Königin von Türgewänden (siehe Ricke
1954, S. 9).
Von den Wandbildern, die sich einst unter den Namensfriesen an der
Wand befunden haben, sind außer einigen größeren Stücken aus den
Kapellen 5+7 nur noch ganz geringe Reste erhalten, die aber erkennen
lassen, das das Relief sehr sorgfältig gearbeitet wurde. Name und Federn
des Amun sind darauf ausgehackt und wieder eingesetzt worden - als letztes
wohl von Sethos I, der seinen Namen in einer Erneuerungsinschrift mehrfach
auf der Wand angebracht hatte. So ist an einer Stelle der von Thutmosis
III. entfernte Horusname der Hatschepsut der Horusname von Sethos I.
eingesetzt worden und auf dem Fragment aus der Kapelle 7 ist in gleicher
Weise sein Thronname eingefügt worden (siehe Zeichnung aus Raum 7 weiter
oben)
|
Die äußere Halle aus zwei Reihen
von je drei Säulen war ebenso schlecht ausgeführt, wie die innere Halle. Die
Säulen der äußeren Halle waren mit dünnen Interkolumnien (Schranken)
verbunden und die am westlichen Ende durch ein Tor verschlossen war. Über die
Entstehungszeit der beiden Säulenhallen kann nur spekuliert werden, da es
keinerlei schriftliche Aufzeichnungen gibt. Ricke vermutet, dass der Tempel nach
der teilweisen Zerstörung durch die Assyrer (in der saitischen 26. Dynastie)
während der Herrschaft von König Psammetich I. von Montu-emhat (Gaufürst der
Provinz) restauriert wurde und dabei ließ er dann evtl. die beiden
Säulenhallen erbauen.
Amenophis III. ließ vor dem
Kerntempel (am Ende der Inneren Halle) des Amun-Kamutef zwei Sitzstatuen der
löwenköpfigen Göttin Sachmet aufstellen - die leider heute fast völlig
zerstört sind.
| Karnak-Süd:
Stationstempel/Barkensanktuar |
Gegenüber vom Tempel
des Amun-Kamutef - westlich von der Sphingenallee (siehe Plan oben) -
befinden sich Baureste eines Gebäudes, das vermutlich zum 6. Stationstempel der
Opet-Prozession gehörte. Dieser Tempel, der ebenfalls kein einheitlicher Bau
war, da sich auch hier lt. Ricke 1954 mehrere Bauperioden feststellen, war
formal und auch thematisch mit dem Kamutef-Tempel aus der Zeit von
Hatschepsut/Thutmosis III. verbunden.
Hatschepsut verkündete auf der
Südwand der "Roten Kapelle", dass sie 6 Stationstempel (oder
Barkenschreine) auf der Prozessionsstrasse von Karnak zum Luxortempel errichten
ließ. Die Königin machte - nachdem die Barke des Amun-Re beim Opet-Fest den
"Auserwählten Orte" (den Ipet-Sut-Tempel / Karnaktempel) verlassen
hatte - im Rahmen der heiligen Prozession an jeder dieser Barkenschreine Halt
und die Barke ruhte dann auf dem Barkenschrein - wie die Darstellungen auf der
Roten Kapelle uns berichten.
Bei den Ausgrabungen im
Luxortempel fand man Reste eines Stationstempels, die von Ramses II. im
Triple-Schrein verbaut wurden und wobei es sich vermutlich um Blöcke aus dem 6.
Barkenschrein handelte. Reste eines weiteren Barkenschreins befinden sich an der
Bodenoberfläche gegenüber dem Kamutef-Tempel. und gehörten evtl. zum 1.
Stationstempel/Barkenschrein der Opet-Prozession. Dieser 1. Barkenschrein, in
welchem Thutmosis III. auf der rechten Seite vor der Barke des Amun-Re opfert
und die dann im Stationstempel abgestellt wird, wird auf den Darstellungen der
Roten Kapelle erwähnt. Sein Name war "Amun von der Treppe vor dem pr-hn"
Von den anderen 4 Barkenschreinen
fand man keine Überreste - evtl. befinden sie sich - zusammen mit den Resten
der Sphingenallee unter der heutigen Stadt Luxor.
Ebenso wie der Haupttempel (Tempel
des Kamutef) stand der Stationstempel auf einer Fundamentplatte aus
Sandsteinblöcken, die unter dem ganzen Bauwerk reichten. Das Fundament war im
Hauptteil aus zwei Lagen von Steinblöcken, die in etwa 1,15m dick waren. Auf
die Fundamentsplatte, die sockelförmig (ungefähr lt. Ricke 35 cm hoch) aus dem
umliegenden Gelände herausschaute hat wohl ursprünglich von Osten her in der
Tempelachse eine flache Rampe geführt, die später abgerissen und in den Tempel
hineingelegt wurde, als dieser in späterer Zeit einen Pylon samt
Umfassungsmauer erhielt. Neben der Fundamentsplatte gehörte noch der östliche
Barkenraum mit einem Pfeilerumgang zur ursprünglichen Form des Bauwerks. Nur
noch die unterste Schicht aus Sandstein-Blöcken ist von dieser Mauer, die sehr
sorgfältig bearbeitet und aneinandergesetzt war, heute erhalten. Von den
meisten Pfeilern des Umgangs sind noch einige größere Teile der unteren
Blöcke erhalten - ebenso von den Schranken zwischen den Pfeilern.
Aufgrund der gefundenen
Pflaster-Resten war lt. Ricke nur der Durchgang im Osten des Tempels mit einem
zweiflügeligen Tor versehen. Ricke fand eines der oberen Zapfenlager aus
dunkelgrauen Granit, das offensichtlich bei einem Brand zerborsten war und auf
dem der Thronname der Königin Hatschepsut zu erkennen war. Evtl. war er sehr
versteckt und daher bei der Zerstörung der Kartuschen der Königin übersehen
worden. Die Königin wird hier als "nfr nTr nb
tAwj nb ir.t Ax.t" bezeichnet und mit
ihrem Thronnamen genannt, was lt. Ricke vermuten lässt, dass der Tempel
gegründet und das Fundament verlegt worden ist, ehe Hatschepsut die
Königswürde angenommen hatte, also etwa im 4. Jahr von Thutmosis III. Dieses
kann aber auch lt. Ricke bedeuten, dass die Gründungszeremonien eines von
Hatschepsut in ihren ersten Regierungsjahren begonnenen Tempels im Namen von
Thutmosis III. als "nominell regierenden Königs" vollzogen wurden.
Ebenso hatte man unter dem Eingang des östlichen Barkenraumes und unter den
beiden Eckpfeilern des offenen Umganges (im vorderen Teil des Stationstempels)
Gründungsgruben gefunden, welche lt. Ricke Gegenstände enthielten, die den
Namen von Thutmosis III. trugen, der hier als "nTr
nfr" (vollkommener Gott) bezeichnet
wurde. Lt. Ricke waren die gefundenen Gegenstände u. a.: eine Scheinvase aus
Alabaster, zwei Modellziegel, sechs Plaketten aus Fayence - alle Gegenstände
trugen den Namen von Thutmosis III.
In den
späteren Jahren wurde die Westhalle des Stationstempels mehrfach umgebaut, und
es lässt sich nicht mehr erkennen, wie die ursprüngliche Ausführung
ausgesehen hatte. Von dieser Westhalle ist heute nur noch die unterste Lage des
Mauerwerks erhalten, wobei die Blöcke hier mit "Schwalbenschwänze"
verklammert sind - wohl aber erst nachträglich, denn auf der Ostseite des
Tempels fehlen diese Klammern.
Nach dem
Rekonstruktionsvorschlag von Rickes wurde das Stationsheiligtum in insgesamt
drei Bauphasen errichtet, wobei in der zweiten und dritten Bauphase ihre Gestalt
grundlegend verändert wurde
|
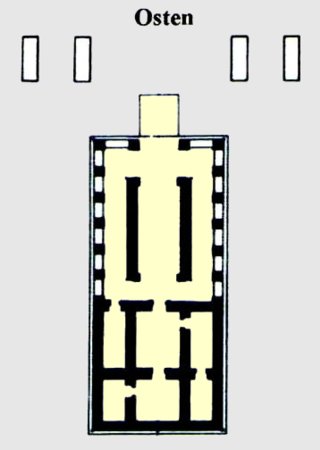
|
Stationstempel
Hatschepsut/Thutmosis III
- Umzeichnung nach Ricke 1954 -
- modifiziert von Nefershapiland -
- Bauphase 1 (nach Ricke) -
|
Im westlichen Barkenraum (im geschlossenen Umgang) fand Ricke bei seinen
Ausgrabungen in der Südwest-Ecke einen großen Sandsteinblock mit mehreren
Vertiefungen für Schwalbenschwänze, die sonst nur im Westteil des Tempels
auftreten. Auf der südlichen Seite des Blocks befanden sich Reste von
Darstellungen einer Königsfigur, die sich nach rechts einem Gott zuwandten.
Erhalten hat sich ein schwebender Falke, der über dem Kopf des Königs fliegt,
samt Teile der Beischrift. Reste einer sorgfältig abgeschliffenen Inschrift
(zwei Kolumnen mit Text) fanden sich hinter dem König und dem Falken, wobei die
zweite Zeile umgearbeitet worden ist. Ricke vermutete daher (aufgrund der Art
und Weise der Änderungen), dass der dargestellte König evtl. die Königin
Hatschepsut gewesen sein könnte, deren Figur während der Alleinherrschaft von
Thutmosis III. abgeschliffen wurde.
Der Stationstempel hatte lt. Ricke
wahrscheinlich in seiner letzten Ausbauform eine Umfassungsmauer mit mindestens
einem Tor auf der Ostseite. Ricke fand genau auf der Tempelachse liegend vor dem
östlichen Barkenraum die Reste eines etwa 2,20m breiten Tores, wobei er
aufgrund der Tatsache, dass er keinerlei Hinweise auf einen Türsturz fand, dass
dieses Tor in einem kleinen - heute nicht mehr vorhandenen - Pylon eingebaut
war. Dieser Pylon maß an der Basis 2,35m (Breite konnte nicht mehr ermittelt
werden - ebenso wie Lage und Ausdehnung der Umfassungsmauer). Der Pylon war
zwischen der Sphingen-Allee und dem Stationstempel eingezwängt worden, wozu
dann die östliche Rampe abgebaut und in das Innere des Tempels verlegt werden
musste. Ricke datiert - aus bauhistorischen Gründen - den Bau des Pylons und
des Tores zwischen der Zeit von Amenophis III. und spätestens der
spätramessidischen Zeit Ägyptens.
*
Lt. Ricke kann dieses
Bauwerk den Ausgrabungsergebnissen nach als eines im Namen von Thutmosis III.
gegründeten, von Hatschepsut errichteten, dem Gott Amun-Re geweihten und noch
in der Spätzeit wiederhergestellten und veränderten Heiligtum gedeutet werden,
das im Laufe der Dynastien immer wieder ergänzt und umgebaut wurde. Dieses
Heiligtum liegt - im Unterschied zu den anderen Tempelanlagen - als Haupttempel
und Stationstempel (Barkenschrein) in der gleichen Achse und wenden einander
ihre Fronten zu. Zusammen bilden sie eine Einheit und waren bei den
Prozessionen, die vom Haupttempel ausgingen nicht einfach eine Wegestation,
sondern waren lt. Ricke das Ziel selbst, wohl für eine besondere
Erscheinungsform des thebanischen Amunkultes (Ricke vermutet hier einen Kult
für die ithyphalische Form des Amun - also des Amun-Re-Kamutef) da der
Haupttempel noch in der Spätzeit mit Säulenhallen versehen worden ist und
möglicherweise sogar noch in ptolemäischer Zeit in Betrieb war. Es ist zu
vermuten, dass noch in ramessidischer Zeit (unter Ramses II. und Ramses III.)
hier "Min-Feste" gefeiert wurden (Min-Kamutef), wie im Tempel von
Medinet-Habu.
Im Westen des Mutbezirkes fanden sich die
Reste einer Toranlage aus der Zeit Thutmosis
III. / Hatschepsut.
Im Luxortempel wurde unter der gemeinsamen Regierung von Hatschepsut und
Thutmosis III. ein kleines Heiligtum errichtet, welches in der Zeit unter Ramses
II. in dessen großen Hof integriert wurde. Des weiteren fand man in der Nähe
von Luxor das Fragment eines Sandsteinarchitravs mit den Kartuschen von
Thutmosis III, das evtl. aus diesem Heiligtum stammen könnte. Erwähnt wird in
der Inschrift die Errichtung eines Gebäudes aus rotem Granit.
Im Luxortempel fand man einen Libationsaltar aus
Rosengranit von Thutmosis III - heute im Museum Kairo JE 28970 (Quelle: PM² II
(S. 339).
Stele
Kairo CG 34011/JE 36330 Granit
H. 1,42m x B. 0,98m
- siehe Urk. IV, 619-624 -
|
Vor
der Südseite des VII. Pylons von Karnak (am Fuße einer Kolossalstatue) wurden
1902 von G. Legraine die Fragmente einer Stele gefunden. Während von den Zeilen
8-14 lediglich die Anfänge fehlen, ist der Text ab Zeile 15 nur noch
fragmentarisch erhalten. Diese Stele ist lt. Peter Beylage (Aufbau der
königlichen Stelentexte in ÄAT 54 / Ägypten und das Alte Testament) eine
"teilweise Dublette der sog. Poetischen Stele" - siehe weiter oben).
|
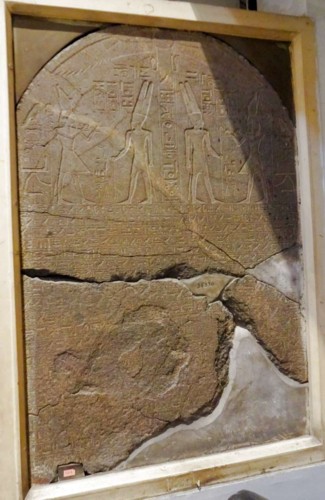
|
Dublette
der sog. "Poetischen Stele" Thutmosis III.
- gefunden südlich des VII. Pylons -
grauer Granit, H. 140-142cm, B. 95-98cm
heute Kairo CG 34011/JE 36330
- mit Restaurationsinschrift von Sethos I. -
Im
Bildfeld befindet sich unter der geflügelten Sonnenscheibe eine antithetische -
durch die Restaurationsinschrift von Sethos I. - getrennte Szene. Auf der
Innenseite steht jeweils Amun-Re, der in seinen Händen jeweils ein wAs–Zepter
und anx–Zeichen hält vor dem
König. Der König (Thutmosis III.) trägt die Doppelkrone und opfert Wein aus
zwei nw-Gefäßen. Hinter dem König befindet sich sein Horusname in der
üblichen Palastfassade eingeschrieben, auf dem der Horusfalke sitzt. Darunter
befinden sich zwei Arme, von denen einer die "maat"-Feder und das
"anch"-Zeichen hält, währen der andere eine Standarte greift, die in
einem menschlichen Kopf mit Nemes-Kopftuch, Uräus und Königsbart ausläuft.
Der Text besteht aus einer Rede des König an Amun-Re, der ihm königliche Siege
verheißt.
Der Restaurationstext von Sethos I. lautet:
"Erneuerung eines Denkmals, gemacht von dem König von Ober- und
Unterägypten, Men-maat-Re für seinen Vater Amun-Re, Herr der Throne der
beiden Länder". Bild. mit frdl. Dank
Saamunra
- alle Rechte vorbehalten - |
Stele
Kairo CG 34012/JE 15116
- berichtet über ein Wunder bei einer Tempelgründung -
|
Bei dieser Stele handelt es lt.
Jürgen v. Beckerath um den oberen Teil einer Stele aus dunklem Granit (Höhe
1,20m x Breite 1,54m, die sich heute im Museum Kairo befindet (CG 34012 / JE
15116) und die in 5 Fragmente zerfallen von A. Mariette im Abraum des
nördlichen Vorhofes des Amun-Tempel in Karnak gefunden wurde (vier weitere
Bruchstücke wurden von P. Lacau veröffentlicht). Der Erhaltungszustand der
Stele ist heute sehr schlecht - vom Gesamttext fehlen mindestens 12 Zeilen
(Leider haben wir kein Foto von dieser Stele).
Im Bildfeld ist lediglich die
geflügelte Sonnenscheibe dargestellt. Darunter beginnt direkt der Text. Zu
beiden Seiten der geflügelten Sonnenscheibe steht:
" BHd.t
j, der große Gott “.
Haupttext (1984) - Urk. IV 833-838 und 235
„Horus,
Mächtiger Stier, xaj–m–WAst
; die Beiden Herrinnen: wAH–nsjt–mj–Ra–m– pt
; Goldhorus: Dsr–xaw
sxm–pHt j; König von
Ober– und Unterägypten (Mencheperre)|, Sohn des Re (Thutmosis, Herrscher von
Theben,)|, geliebt von Amun- Re, erster in seiner Stadt ……………………
mit Leben beschenkt Ewiglich.
Der König selbst gab Befehl auszuschreiben, wie der Orakelspruch zur
Ausführung eines Denkmals gesagt wurde angesichts derer, die auf der Erde sind
(d. h. der Mensch), für die Ewigkeit.
Meine Majestät wünschte Denkmäler
zu machen für seinen Vater Amun in Karnak, (nämlich)
eine Gotteswohnung zu erstellen, den
Horizont ( = Tempel) herrlich zu gestalten und Theben (#ftt–Hr–nb.s)
für ihn zu verschönern, den Lieblingssitz meines Vaters, des Amun- Re, des
Herrn der Throne der Beiden Länder. Ich errichtet es ( = das Bauwerk) für ihn
auf einem Sockel aus Sandstein, wodurch ich (es) erhöhte und sehr vergrößerte
(soAj(w)saAw),
weil [das Wasser hochsteigt (oder ähnlich) und] die Flut den Tempel [erreicht]
seitens des Nun; ich habe es ihm errichtet aus liebenden Herzen; ich habe ihn
zufriedengestellt (beim) ersten Mal des Errichtens eines Tempels im Osten dieses
Tempelbezirks (rA–pr).
Als meine Majestät die
Umfassungsmauer (Snw) aus
Ziegel(n bestehend) vorfand und den Schutt (zATw)
im Begriff, die Mauer[n] zu verdecken, ordnete meine Majestät an, [seinen]
Schutt an ihm (weg)zubringen. Weit war (nun) der Tempelbezirk, den ich gereinigt
hatte.
Ich beseitigte, was in
schlechtem Zustand war (Dwt.f),
ich entfernte die Schutthaufen (Sdjt),
die an seinen Seite waren und die bis (zur Höhe des) Tempels (jwjt)
angestiegen waren.Ich richtete diesen Platz her (xwsj),
um dieses Denkmal in ihm ( = dem Tempelbezirk) zu erbauen, um dieses Heiligtum
meines Vaters [Amun in] Karnak zu weihen, das ich als etwas Neues gemacht und
nach Vorschrift entworfen habe. Nicht erstellte ich (es) über dem Denkmal eines
Anderen. Meine Majestät hat dies in Wahrheit gesagt, damit es jedermann weiß.
Mein größter Abscheu ist das Sagen von Lüge; kein
unwahrer Satz ist darin. Ich [bin ……. Ich
habe]es ....…….… , damit es richtig ist, den ich kenne das, womit er ( =
Amun) zufrieden ist.
Es hatte seine Majestät
angeordnet, das Strickespannen vorzubereiten beim Erwarten des
Neumondtages, um den Strick zu
spannen für dieses Denkmal, (nämlich) in Jahr 24, am 30. des II. prt–Monats, den 2 Tag des Festes des Amun in Karnak. Darauf ließ
[man alles Notwendige veranlassen (o. ä.), um den Strick zu spannen] in diesem
Tempel. Der Gott aber ruhte (noch) in seinem Sanktuar ( st
– wrt). Danach
schritt der Herr, um seinen Vater Amun erscheinen zu lassen, und der Gott zog zu
seiner Prozession aus, um dieses sein schönes Fest zu begehen. Da vollbrachte
die Majestät dieses Gottes viele Wunder wegen des Herrn (d. h. gab Orakel
zugunsten des Herrschers), und der König machte …….. [Da nahm] die Majestät
dieses Gottes ihren (?) Platz …. [ein] (?). Er setzte den König vor sich
(d.h. ließ ihn vor sich hergehen) zu diesem Denkmal, das der König entworfen
hatte, und die Majestät dieses Gottes jubelte über dieses Denkmal …..…..
die Majestät dieses Gottes …. [Darauf
sprach der König zu der Majestät] diese Gottes: Ziehe
hin und feiere Dein schönes Fest, mein Herr. Ich werde kommen (scil. Zur
rechten Zeit), um das Strickespannen auszuführen. Denn ……..
[Der Gott aber ….. Er setzte (?) den König] vor sich und führte (bs)
ihn auf den Thron der ersten Stelle (?) des Strickspannens. Es hatte aber die
Majestät dieses erhabenen Gottes gewünscht, das Strickspannen selbst auszuführen
an allen Stellen (?) dieser Arbeit, ausgestattet mit ……..…, [und so
spannte er den Strick, hackte die Erde(?)], befeuchtete Schlamm, formte einen
Ziegel, indem Staub hinter ihm war von der Hacke und von der Bodenlinie. Er
setzte ihn in …. [und zeigte ihm (o.ä.)] alles, was er getan hatte. Da
jubelte der König sehr. Als er die großen Wundertaten sah, die sein Vater Amun
für ihn vollbracht hatte. Nicht geschah Gleiches [seit der Urzeit (o. ä.)].
[Darauf sprach der König zu der Majestät dieses Gottes: „
….. Du tatest für mich Wunder (?)], (wie sie noch) nicht geschehen sind. Ich
freue mich auf Dein schönes Kommen, um dieses dauerhafte Denkmal
entgegenzunehmen, das Du zu vollenden befohlen hast. [Alles, was Du] befiehl[st,
wird geschehen (o.ä.) ….. “].
Ab hier ist der Text nur noch Bruchstückhaft:………..
darauf [sprach (?)] dieser Gott ………….. alle Namen der großen Neunheit,
die in Karnak ist, der Götter und Göttinnen ………..………….... als etwas
Neues. Danach stand ….... (und) alles Volk (rxjt)
brach in Jubel aus. Danach
……………………………………………………………………….…..
Weihrauch und alle guten Dinge,empfangen
von Lobpreisung ……………. [aus] Feingold, das ich ihm gemacht habe
………….……………….. hergestellt (bAk)
von den Vorfahren ……………….. Wein……………..………………".
Einige der Fragmente konnten später von den
Wissenschaftlern noch angefügt werden. Die Stele weist als Datum das Jahr 24
des Königs auf. Die Inschrift beginnt wie üblich mit dem Wunsch des Königs,
für den Gott Amun-Re (seinem göttlichen Vater) Denkmäler zu errichten. Im
leider heute nicht mehr vorhandenen Ende des Textes werden dann die vom König
getätigten Stiftungen für den Tempel aufgezählt.
Die Stele ist leider nicht datiert. Das im Text
erwähnte Datum 24 gehört ´zur Erzählung und war bei der Erstellung des
Textes schon vergangen. Interessanterweise - im Gegensatz zu anderen
Erzählungen - ist hier die Tatsache, dass der Könige nicht nur von den von ihm
errichteten Denkmälern berichtet, die prächtig ausgestattet waren, sondern es
wird im Hauptteil des Textes von einem "Wunder" berichtet, das sich
zur Beginn der Bauarbeiten ereignet haben soll. Dabei handelt es sich um das
"wunderbare Eingreifen" des Gottes Amun-Re bei der
Gründungszeremonie, worauf sich auch das im Text genannte Datum 24 bezieht
(Zeile 7). Zwar hatte der König in diesem Jahr mehrere Bauvorhaben indiziert,
aber hier ist nahezu sicher zu vermuten, dass es sich bei dem angeführten
Tempelbau um seinen Festtempel "Mn–xpr–Ra–Ax–mnw"
(Ach-menu) handelt.
Das Wunder, das hier auf der Stele
so ausführlich erwähnt wird, bestand darin, dass der Gott Amun-Re die bei der
Tempelgründung vorgeschriebenen Ritualhandlungen selbst vornahm - den König
also quasi in die "Zuschauerrolle" verwies. Diese
"Gründungslegende" hat ihre Parallelen in den Berichten über die
Geburt der Königin Hatschepsut - und in beiden wird beteuert, dass dieses die
Wahrheit und keine Lüge sei! Leider verhindern die großen Lücken am Ende des
Textes das Verständnis für diesen Text und eine Erklärung dafür, warum es
notwendig war, dass der Gott quasi die Zeremonie vorverlegte, da auch seine
Anwesenheit bei diesem Ritual weder notwendig noch vorgesehen - und wohl
auch vom König nicht beabsichtigt war. Die Handlung des "Strickesspannens"
hätte nach dem Befehl des Königs erst einen Tag später stattfinden sollen.
Aber der Gott - oder wer auch immer dahintersteckte (?) - setzte sich über den
Wunsch des Königs hinweg, die Tempelgründung am Neujahrsmond-Tag vorzunehmen
(Text nach Jürgen von Beckerath in MDAIK 37)
Gründungsstele
im Ptahtempel
|
Hierzu siehe weiter oben unter "Ptahtempel".
Die Stele befindet sich heute im Museum Kairo CG 34013 / JE 34642 und soll an
den Wiederaufbau und die erneute Widmung des Tempels an Ptah im Jahre 23
oder 24 des Thutmosis III. erinnern.
Stele
Museo Gregoriano Egizio Nr. 130
- die sog. "Cheftet-Her-Neb-s"-Stele
(xft.t-Hr-nb-s)
|
Diese Stele aus Kalkstein, die
sich heute im Vatikanischen Museum (Museo Gregoriano Egizio 266) befindet,
stammt wohl ebenfalls aus Theben. Sie wurde 1819 für das Museum aus einer
Privatsammlung angekauft und stammt aus der Zeit der "Mitregentschaft"
(Hatschepsut-Thutumosis III.) und ist recht gut erhalten (sie zeigt lediglich
"Hackspuren" aus der Amarnazeit, was bedeutet, dass sie der Verfolgung
der Denkmäler der Hatschepsut entgangen ist). Es handelt sich hierbei um eine
königliche Stele, wobei die Bezeichnung "Cheftet-her-nbeb-es" ein
Epitheton ist. Der Text der Stele ist in Urk. IV (311-312) publiziert:
"Denkstein zur Erinnerung an die Neuanlage der Befestigung.....auf dem
Westufer von Theben gegenüber von Karnak".
|
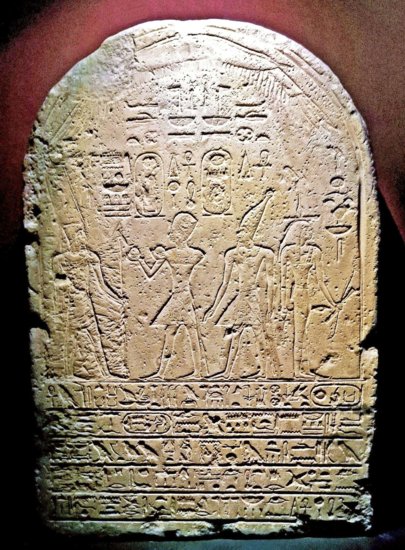
|
Stele im
Museum des Vatikans Museo Gregoriano
Egizio
(H. 1,15m x B. 0,80m, Durchmesser 25cm)
Material: Sandstein - Katalog-Nr. 22780
Beschreibung:
Unter der geflügelten Sonnenscheibe
opfert Hatschepsut – mit
Blauer Krone und Uräus – vor Amun–Re. Hinter ihr steht mit anbetend
in Kniehöhe vorgestreckten Händen, Thutmosis
III - Rücken an Rücken mit der Personifikation der Göttin für
das thebanischen Westufer, die das Gauzeichen des vierten oberägyptischen
Gaus auf dem Kopf trägt. In den Händen hält sie Pfeil und Bogen sowie
eine Keule und das anx (Anch-)Zeichen.
Die eingeritzten Hieroglyphen und Szenenbilder sind in roter Farbe
ausgeführt.
Siehe auch: M. Cozi, 1994 in Göttinger
Misszellen 143.
Courtesy to Juan R. Lazaro
- alle Rechte vorbehalten - |
Stelenfragment
Museum Kairo CG 34015/JE 27815
- gefunden im Totentempel des Königs -
|
Bei
diesem Bruchstück einer nach oben gerundeten Stele (heute im Museum Kairo: CG
34015 / roter Quarzit - Maße: ca. 56cm x 54cm) - gefunden von Arthur Weigall
bei seinen Ausgrabungen im Totentempel von Thutmosis III - schwebt im Stelenrund
die geflügelte Sonnenseibe und links und rechts davon hängt jeweils ein Uräus
herunter. Im Bildfeld war einst eine Doppeldarstellung zu sehen, in deren Mitte
eine Textkolumne als Trenner verlief. Thutmosis III. steht auf der rechen Seite
in "Beterhaltung" vor dem Gott Amun-Re. Hinter dem König befindet
sich in einem kleineren Maßstab seine "Große königliche Gemahlin, Isis,
die er liebt, Herrin von Ober- und Unterägypten" (offenbar die Mutter des
Königs). Diese Titel sind für Isis anderweitig nicht belegt und ihr Name ist
lt. Weigall (in seiner ersten Publikation der Stele) evtl. nachträglich in die
Kartusche eingearbeitet worden. Auch soll Weigall noch ein "Ra"
als ersten Teil des Namens in der Kartusche
gesehen haben, womit er vermutete, dass hier original "Neferu-Ra"
gestanden haben könnte. Piccione (2003 / The Women of Thutmose III in the
Stelae of the Egyptian Museum) will hier aber als ursprünglichen Namen "Merit-Ra"
identifiziert haben. Auch sprechen lt. Piccione (2003 JSSEA 30) die historischen
Umstände der Stele gegen den Namen "Neferu-Re", da die Stele aus der
spätejn Regierungszeit von Thutmosis III. stammt - entsprechend dem Datum und
Bau seines Totentempels - und es ist daher unwahrscheinlich, dass Neferu-Re
jemals hier genannt wurde, während in den dazwischenliegenden Jahren andere
Königinnen von Thutmosis III. hier sehr eindeutig dokumentiert sind.
|
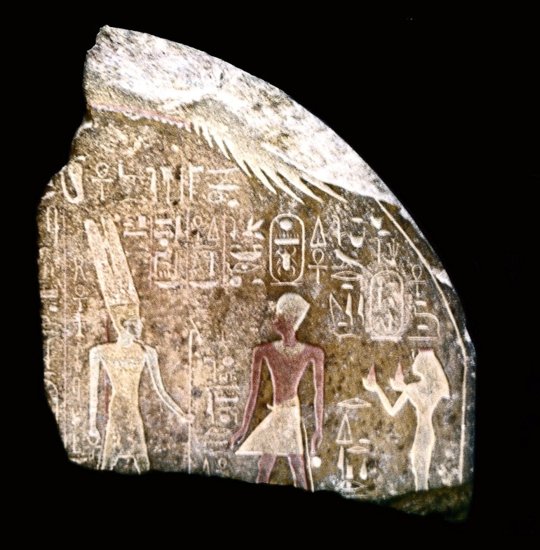
|
Fragment der Stele Kairo CG 34015 / JE27815
- ca. 56cm x 54 cm: roter Quarzit -
Erhalten blieb von der Stele, die Arthur Weigall 1905 im
Totentempel von Thutmosis III. mit dem Namen "@w.t
(Mn–xpr–ra)|@nk.t–anx"
fand, nur noch die rechte Hälfte
der Lünette. Die Oberfläche besitzt eine glänzende, braune Patina und
ist bemalt. Rechts steht der König mit nach unten ausgestreckten Armen
und in der Pose der Anbetung vor Amun-Re. Hinter dem König steht eine
Königin, die zwei Krüge Wein präsentiert. Ihr Titel lautet:
"Große königliche Gemahlin, geliebt von ihm, die Herrin von Ober-
und Unterägypten [Isis], möge sie leben ewiglich.
Bild: Courtesy to Juan
R. Lazaro
- all rights reserved - |
Die Stele Cairo JE
27815/CG 34015 erlitt ein ähnliches Schicksal wie die Stele CG 34013.
Wie schon oben ausgeführt wurde lt. Piccione (2003) - wohl schon gegen Ende der
Regierung von Thutmosis III - der originale Name der königlichen Gemahlin
Merit-Re-Hatschepsut abgeändert in den der königlichen Mutter Isis. In der
Amarnazeit wurden dann die Figur und der Titel von Amun-Re entfernt - das
Bildnis des Königs blieb unangetastet, jedoch der Name der Königin ebenfalls
gelöscht. Zur Zeit von Sethos I. (in der 19. Dynastie wurde dann die Stele
restauriert und der Name der Königsmutter wieder in die Kartusche
eingesetzt.
Die Stele CG
34015 stammt wohl aus der späten Zeit der Regierung Thutmosis
III., wobei uns aber nicht ganz klar ist, warum der Name von Merytre
– Hatschepsut in den der Königsmutter Isis
abgeändert wurde. Angesichts der Bedeutung von Meryt-Re ist diese Frage
berechtigt und es ist unverständlich, dass Thutmosis III. den Namen seiner noch
lebenden Frau (siehe Darstellung im Grab von Thutmosis III, wo sie als
"lebend" bezeichnet wird - die Mutter des Thronfolgers Amenophis II. -
streichen ließ, da sie bei Hof einen hohen Stellenwert hatte und diesen auch
weiterhin in der Regierungszeit ihres Sohnes innehatte - um ihn durch den Namen
seiner mit Sicherheit schon verstorbenen Mutter Isis, die nur eine
minderjährige Ehefrau seines Vaters war (ohne königliche Abstammung) zu
ersetzen?
Lt. Piccione (2003)
kann diese Vorgehensweise evtl. damit begründet werden, dass Thutmosis III.
seine "nichtkönigliche" Mutter rückwirkend in den Statues einere
"Großen Königlichen Gemahlin" erhob, quasi als Teil seines Programms
"zur Neupositionierung seiner eigenen Abstammung" - unabhängig von
dem Mentoring seiner Stiefmutter und Tante Hatschepsut um damit die Nachfolge
und Thronbesteigung seines eigenen Sohnes zu legitimieren, als politische
Zweckmäßigkeit.
Merytre–Hatschepsut
war auch auch die erste Königsgemahlin nicht-königlicher Abstammung die
den Titel „Gottesgemahlin“ trug. Sie folgte als "Große Königliche
Gemahlin auf Sitiah. Nach Gitton und Jean Leclant war Merytre-Hatschepsut die
Tochter einer Dame mit Namen "Huy/Hui", welche den Titel einer
Priesterin des Amun und Atum und einer königlichen Amme trug.
Stele
des Amenemhet mit Darstellung Thutmosis III
vor dem Gott Amun-Re
Ägyptische Museum Berlin ÄM 1638
Gefunden: El-Asasif (Westtheben)
|
Im Neuen Ägyptischen
Museum Berlin befindet sich eine Stele, die für den (schon verstorbenen) Sohn
Amenemhet von Thutmosis III., dem königlichen Verwalter des "Haus des Königs Aa-cheper-ka-Re"
(Thutmosis I) gewidmet war und im Bildfeld den König Thutmosis III. beim
Vollzug eines Weinopfers vor dem Gott Amun-Re zeigt. Dieser "älteste"
Sohn des Königs namens Amenemhet ist erwähnt in den Jahren 23-24 von Thutmosis
III. als junger Mann, der als Aufseher der Rinder und der Milchkühe des Amun
genannt wird. Im Jahre 42 seines Vaters war er wohl bereits verstorben und
Amenophis (II.) nahm seine Stelle ein.
|
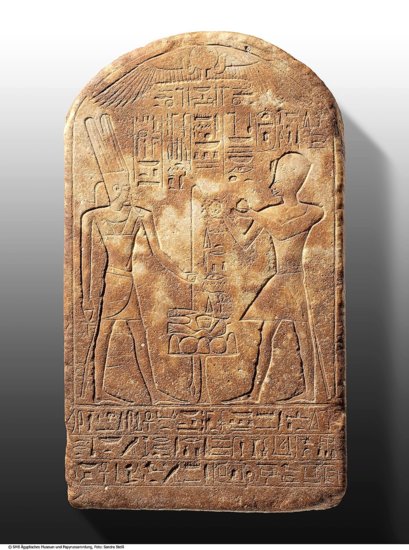
|
Stele des Amenemhet mit der Darstellung
Thutmosis III.
vor dem Gott Amun-Re
ÄM 138, H. 62,5cm x 36cm x 18cm, Gew. ca. 95 kg
Material: Quarzit
- gefunden: Al-Asasif aus Sammlung Bernardino Drovetti
Auf der Stele, welche dem ältesten Sohn des Königs,
Amenemhat, dem schon verstorbenen
königlichen Verwalter des "Haus des Königs Aa-cheper-Re"
(Thutmosis I.), - dem Großvater von Thutmosis III. - gewidmet war steht
Thutmosis III. vor dem Reichsgott Amun-Re. Der König mit der blauen Krone
auf dem Kopf trägt den königlichen Schurz mit Stierschwanz und dem
Prunkgehänge und er opfert zwei Weingefäße für den Gott.
Die Inschrift vor dem König lautet: "Eine
Weinspende, was (er) ihm macht, indem ihm Leben gegeben ist"
(Quelle: Karl-H. Priese (Hrsg.), Ägyptisches Museum Berlin, Museumsinsel
Berlin, Mainz 1991, S. 80)
Bild: Fotograf unbekannt
CC BY-NC-SA @ Ägyptisches Museum und Papyrussammlung, Staatliche Museen
zu Berlin |
Kleine Votiv-Stele
Thutmosis III. aus Stockholm (NME 021)
|
Es handelt sich um eine kleine Votiv–Stele aus
Kalkstein, die von einem gewissen Sennefer/Nefernefer
(?) gestiftet wurde. Unter der oberen Rundung befindet sich die geflügelte
Sonnenscheibe mit Spuren von roter Farbe. Während der Amarna-Zeit wurden oft
Darstellungen gewisser Götter zerstört.
|

|
Kleine
Votiv-Stele Thutmosis III.
- gemacht für einen Mann mit Namen Sennefer -
- heute im Nationalmuseum Stockholm,
Medelhavsmuseum -
Material: Kalkstein - NME 021
Die Darstellung auf dieser Stele zeigte ursprünglich
Thutmosis III. mit dem blauen Helm, der Opfergaben vor Amun-Re darbringt,
dessen Bild heute fast vollständig zerstört ist. Über dem Kopf des
Königs sind zwei Kartuschen zu sehen:
-
mn-xpr-ra (Men-cheper-Re)
-
_Hty-ms-HoA-mAat (Djehuti-mes-Heqa-maat)
Sie zeigt König Thutmosis
III. mit dem Blauen Helm auf dem Kopf opfernd vor Amun–Re. In der
Amarnazeit wurde der Namen und das Abbild Amuns gelöscht. Bild:
Courtesy Merja Attia
- alle Rechte vorbehalten - |

Bauten Theben West
Anmerkungen und Quellen
1. Wikipedia, Thutmosis III.
2. www.maat-ka-ra.de von Dr. Karl Leser
3. Labib Habachi, Die unsterblichen Obelisken Ägyptens, Ph. v.-Zabern-Verlag,
Mainz, 1982
4. Edmund Dondelinger: der Obelisk, Adeva-Verlag Graz, Austria 1977
5. Silke Grallert: Bauen-Stiften-Weihen, Achet-Verlag 2001, Berlin
6. Ricke, H. "Das Kamutef-Heiligtum Hatschepsut's und Thutmosis III.
Bericht über die Ausgrabung vor dem Muttempelbezirk", 1954
7. Wikipedia, Rote Kapelle
![]()